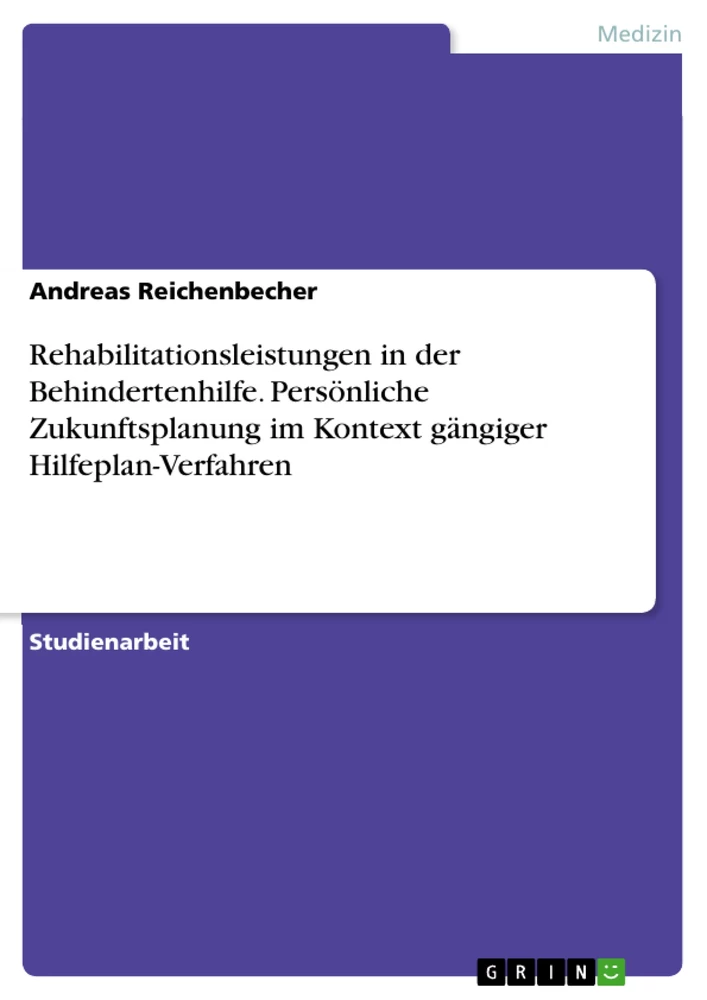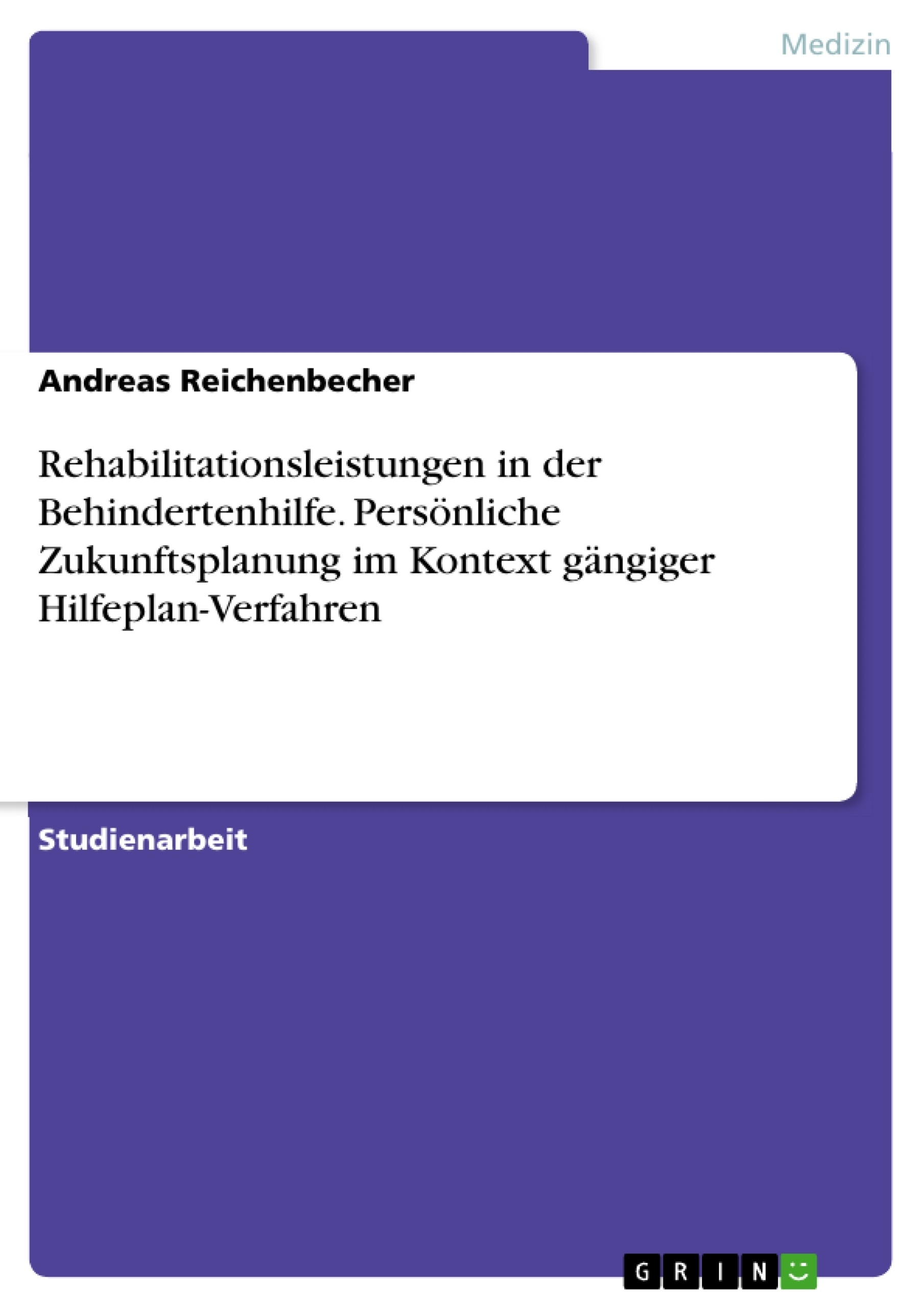Als zentrale Ziele von Rehabilitationsleistungen gelten nach dem SGB IX die Förderung der Selbstbestimmung und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Erbringung von Leistungen der Behindertenhilfe durch Organisationen basiert gesetzlich auf individuellen Teilhabezielen und persönlichem Bedarf.
Inwieweit die Umsetzung einer Personen- statt einer Institutionszentrierung im Rahmen von Hilfeplan-Verfahren gelingt und ob der Ansatz der Persönlichen Zukunftsplanung als eine Variante von personenzentrierten Planungen eine Alternative oder eine Ergänzung darstellt, soll im Folgenden betrachtet werden.
Vor dem Hintergrund veränderter Paradigmen in der Behindertenhilfe (Inklusionsgedanke, Entscheidungsbeteiligung, Individualisierung von Hilfe, gesetzliche Verankerung im SGB IX) und der Dienstleistungs- und Qualitätsorientierung in der Sozialen Arbeit allgemein sind die jüngeren Entwicklungen von Instrumenten zur Hilfeplanung insgesamt zu begrüßen. Allerdings ist zu bemerken, daß das Potenzial, das zur Verfügung steht, durch die sozialrechtlichen und -politischen Rahmenbedingungen zerfasert wird.
Es gibt daher in Deutschland eine trägerbezogene Hilfeplan-Vielfalt. Die jeweiligen Leistungsträger nutzen unterschiedlichste Verfahren zur Planung der Unterstützung. Die Art und die Intention können dabei stark voneinander abweichen. Ob und wie der betroffene Mensch am Planungsprozess beteiligt wird, variiert. Dies steht aber im Widerspruch zur postulierten Selbstbestimmungs- und Teilhabeforderung und dem gesetzlich festgeschriebenen Wunsch- und Wahlrecht des Menschen mit Behinderung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Ansatz Persönliche Zukunftsplanung
- 2.1 Ursprung und zentrale Aspekte
- 2.2 Das Konzept der Lebensqualität als Basis von PZp.
- 2.3 Inhalt und Methodik von PZp.
- 2.4 Grenzen der PZp.
- 3 Hilfeplan-Verfahren
- 3.1 Hintergründe der Individualisierung von Hilfeplan-Verfahren.
- 3.2 Beschreibung der Hilfeplan-Verfahren.
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ansatz der Persönlichen Zukunftsplanung (PZp) im Kontext gängiger Hilfeplan-Verfahren der Eingliederungshilfe. Sie beleuchtet die Ursprünge und zentralen Aspekte von PZp, stellt das Konzept der Lebensqualität als Grundlage von PZp dar und beschreibt die Methodik und Grenzen des Ansatzes. Darüber hinaus werden die Hintergründe und die Beschreibung der Hilfeplan-Verfahren im Kontext der Eingliederungshilfe erläutert.
- Persönliche Zukunftsplanung (PZp)
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
- Hilfeplan-Verfahren und ihre Individualisierung
- Selbstbestimmung und Teilhabe
- Lebensqualität und Ressourcenorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen dar und zeigt die Herausforderungen bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Leistungen. Sie beleuchtet das sozialrechtliche Leistungsdreieck und die Bedeutung der individuellen Hilfeplanung im Kontext der Eingliederungshilfe.
2 Der Ansatz Persönliche Zukunftsplanung
Dieses Kapitel beschreibt den Ansatz der Persönlichen Zukunftsplanung (PZp) als eine Form der personenzentrierten Planung. Es beleuchtet die Ursprünge und zentralen Aspekte von PZp, das Konzept der Lebensqualität als Grundlage von PZp und beschreibt die Methodik und Grenzen des Ansatzes.
3 Hilfeplan-Verfahren
Dieses Kapitel behandelt die Hintergründe der Individualisierung von Hilfeplan-Verfahren und beschreibt verschiedene Verfahren, die in der Eingliederungshilfe angewendet werden. Es beleuchtet die Bedeutung von Selbstbestimmung und Teilhabe im Kontext der Hilfeplanung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Persönliche Zukunftsplanung, Eingliederungshilfe, Hilfeplan-Verfahren, Selbstbestimmung, Teilhabe, Lebensqualität, Ressourcenorientierung, Empowerment.
- Quote paper
- Andreas Reichenbecher (Author), 2016, Rehabilitationsleistungen in der Behindertenhilfe. Persönliche Zukunftsplanung im Kontext gängiger Hilfeplan-Verfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428228