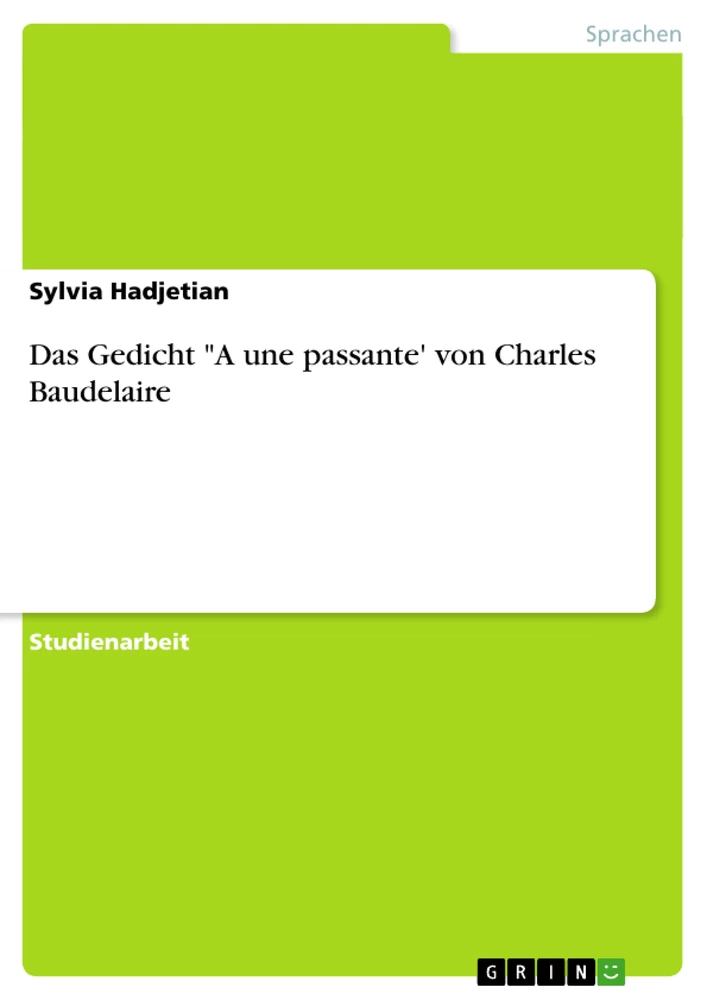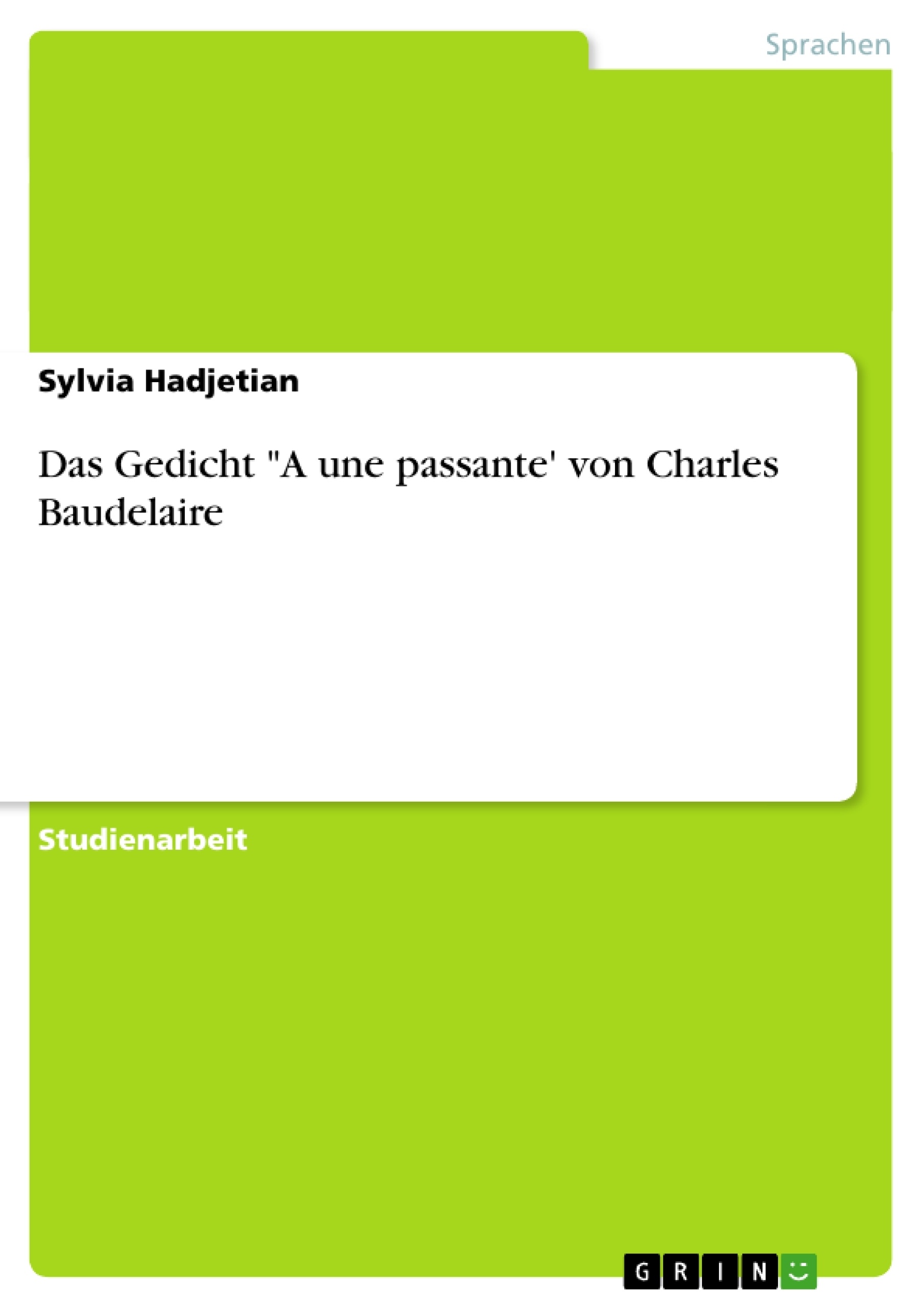Das Gedicht “A une passante“ von Charles Baudelaire (1821-1867) ist Teil des Gedichtbandes Les Fleurs du mal, mit dem er großen Erfolg hatte. “A une passante“ gehört zu Les Petites vieilles, die wiederum zu den Tableau Parisiens gehören, einer Reihe aus Les Fleurs du mal. Diese Straßengedichte beschreiben das Leben in der Großstadt, meist in Paris, das viele poetische Themen liefert. Das vorliegende Gedicht ist ein herausragender Vertreter moderner Großstadtlyrik, die von Bedrohung, Hässlichkeit, Einsamkeit, Kriminalität und Modernität handelt.
Das Gedicht wird hinsichtlich der pragmatischen, semantischen, syntaktischen und lautlichen Ebenen analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Die kommunikativen Instanzen Sprecher und Angesprochener
- Das Verhältnis zwischen Sprecher und textinternem Adressaten
- Der Monolog
- Zeitliche Ebenen des Gedichts
- Der Sprecher und die Welt
- Die Isotopien „Schönheit“ und „Traurigkeit“
- Die sprachlichen Mittel
- Tropen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Gedicht „A une passante“ von Charles Baudelaire (1821-1867) wird aus pragmatischer, semantischer, syntaktischer und lautlicher Perspektive analysiert. Die Analyse deckt die kommunikativen Instanzen im Text, das Verhältnis zwischen Sprecher und Angesprochener, die zeitlichen Ebenen, den Sprecher und seine Umwelt, die Isotopien und die sprachlichen Mittel auf.
- Kommunikative Instanzen
- Verhältnis zwischen Sprecher und textinternem Adressaten
- Sprachliche Mittel
- Isotopien
- Zeitliche Ebenen des Gedichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die kommunikativen Instanzen Sprecher und Angesprochener
Im Gedicht „A une passante“ sind die kommunikativen Instanzen Sprecher und Angesprochener deutlich markiert. Der Sprecher zeigt sich explizit durch das Rollendeikton „je“ und Personalpronomen wie „m’[en]“, „moi“. Der textinterne Adressat wird durch die Überschrift und Possesivbegleiter wie „sa“ und „son“, das direkte Objekt „te“ und Personalpronomen „tu“ präsentiert. Neben dem textinternen Adressaten gibt es den textexternen Adressaten, den Leser. In den ersten beiden Strophen richtet sich der Sprecher implizit an den Leser, in den beiden Terzetten richtet er sich an den textinternen Adressaten.
Das Verhältnis zwischen Sprecher und textinternem Adressaten
Der Sprecher sieht auf einer belebten Straße eine schöne Frau in Trauerkleidung, in die er sich sofort verliebt. Von ihrem Anblick ist er ganz erstarrt. Sie nimmt seine Blicke wahr, reagiert aber nicht, sondern geht einfach weiter. Der Sprecher ist deshalb verzweifelt.
Der Monolog
Der ganze Text ist ein Monolog. Die ersten beiden Strophen sind eine Beschreibung vom Sprecher für den Leser. In der dritten Strophe wird der Adressat zum ersten Mal mit einer rhetorischen Frage direkt angesprochen. Die letzte Strophe ist ein Dialog zwischen den beiden, aber nur in den Vorstellungen des Sprechers.
Zeitliche Ebenen des Gedichts
Der Großteil des Gedichts ist in der Vergangenheit geschrieben. Auffällig sind die vereinzelten Sätze im Präsens bzw. Futur. Die rhetorische Frage in Zeile elf ist im Futur geschrieben, was darauf hinweist, dass sich der Sprecher diese Frage immer noch stellt. Mit Zeile 13, auch im Präsens, drückt er eine Tatsache aus, die er sich immer wieder ins Gedächtnis ruft.
Der Sprecher und die Welt
Der Sprecher ist Teil der besprochenen Welt, er ist einer von vielen in der Menschenmenge auf der Strasse, auf der er plötzlich die Frau erblickt. Die Straße ist der Ort, der die Wege der beiden kurzzeitig zusammenführt, gleichzeitig ist das Gewimmel auf der Straße auch schuld daran, dass er sie aus den Augen verliert.
Die Isotopien „Schönheit“ und „Traurigkeit“
Die Thematik des Gedichts kann anhand der beiden dominanten Isotopien „Schönheit“ und „Traurigkeit“ rekonstruiert werden. Die Isotopie „Schönheit“ kann im mehrere Wortfelder eingeteilt werden: „Körperteile“, „schöne Eigenschaften der Frau“, „beeindruckende Tätigkeiten“, „schöne Umschreibungen bzw. Bezeichnungen für die Frau“. Die Isotopie „Traurigkeit“ kann man als erstes in das Wortfeld „Tod“ unterteilen. Dazu gehören Wörter bzw. Ausdrücke wie „en grand deuil“, „douleur“, „tue“ und „éternité“. Des weiteren gibt es das Wortfeld „Bedrohung“. Als letztes gibt es noch einige „schmerzhafte Adjektive, Adverbien und Tätigkeiten“. Im Text kommen zahlreiche Oppositionen vor, die für Baudelaire typisch sind, da für ihn Schönheit und Traurigkeit zusammengehören.
Die sprachlichen Mittel
Die Aussagen des Textes werden größtenteils mit Hilfe von vielen ausdrucksstarken Adjektiven realisiert. Da hauptsächlich die Schönheit der Frau und der Gefühlszustand des Sprechers beschrieben werden, kann sich der textexterne Adressat so ein sehr genaues Bild darüber machen. Es kommen ziemlich wenige Verben vor, d.h., dass es kaum eine Handlung gibt. Dies wiederum spiegelt das Verhältnis zwischen Sprecher und textinternem Adressaten wieder, nämlich, dass auch zwischen ihnen nichts passiert. Auffällig ist noch bei den Adjektiven, dass sie schnell hintereinander aufgezählt werden (Asyndeton).
Tropen
In dem Gedicht kommen zahlreiche Tropen vor. Im ersten Vers gibt es bei „rue“ eine Metonymie. Der Raum, in dem Fall die Strasse, steht für den Rauminhalt, dem Lärm. Der Leser kann mit der Metapher sofort Lärm verbinden. Bei “hurlaiť“ handelt es sich um eine Personifikation, da die Strasse nicht brüllen kann. Dies macht die Beschreibung der Strasse für den Leser anschaulicher. Der ganze Satz ist eine Metapher, die den Lärm um den Sprecher herum bildlich darstellt, damit man sich die Situation besser vorstellen kann. In Zeile fünf gibt es eine partikularisierende Synekdoche, d.h., dass der Teil für das Ganze steht, auch pars pro toto (“sa jambe“). Durch den Singular wird der Plural ersetzt. In der folgenden Zeile handelt es sich bei „crispé comme un extravagant“ um einen Vergleich. Dieser dient zur Veranschaulichung, zur genaueren Beschreibung des Zustands des Sprechers. Zeile sechs bis acht ist eine Metapher. Der Sprecher schaut ihr nicht nur ins Auge („oeil“), sondern in ihr ganzes Gesicht. Das Auge ist pars pro toto für ihr Gesicht. „Un éclair ... puis la nuit“ ist ebenfalls eine Metapher. Der Blick der Frau ist wie ein Blitz, er erhellt sein Leben, dann schaut sie wieder weg, verschwindet und alles ist wieder wie vorher. „Fugitive beauté“ ist wieder ein pars pro toto, die Schönheit steht für die ganze Frau, sie ist ein Teil von ihr. Damit wird ausgedrückt, wie schön die Frau ist, Schönheit ist ihr wichtigstes Merkmal.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Gedichts „A une passante“ sind: Schönheit, Traurigkeit, Stadt, Liebe, Begegnung, Tod, Verzweiflung, Kommunikation, Sprechen, Adressat, Zeitliche Ebenen, Sprachliche Mittel, Tropen, Metonymie, Personifikation, Synekdoche, Vergleich, Metapher.
- Quote paper
- Sylvia Hadjetian (Author), 2001, Das Gedicht "A une passante' von Charles Baudelaire, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42824