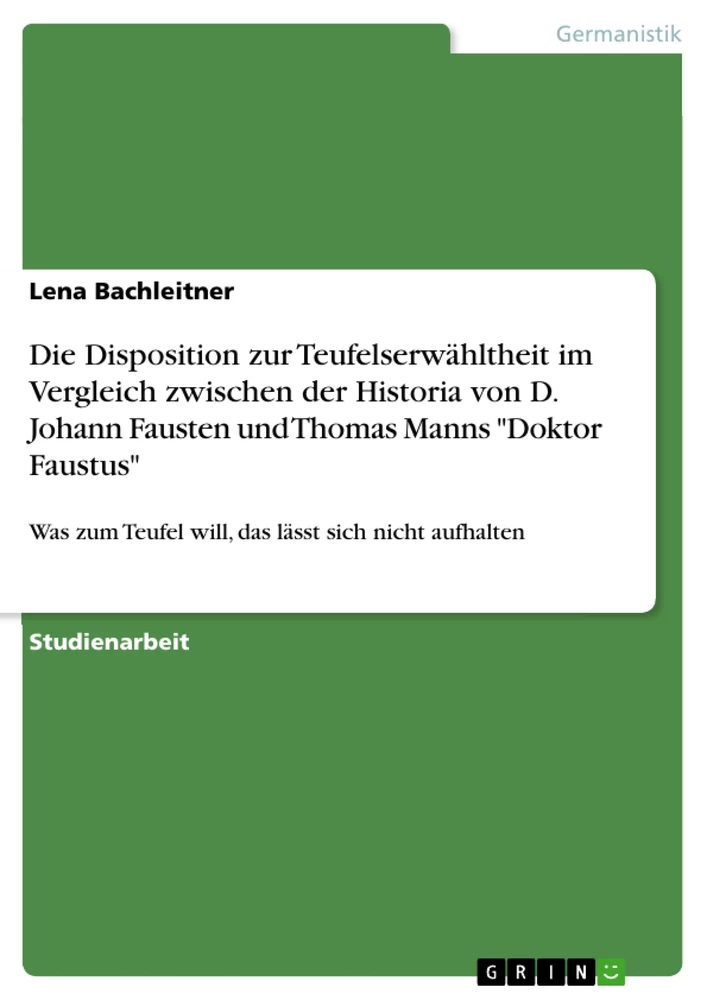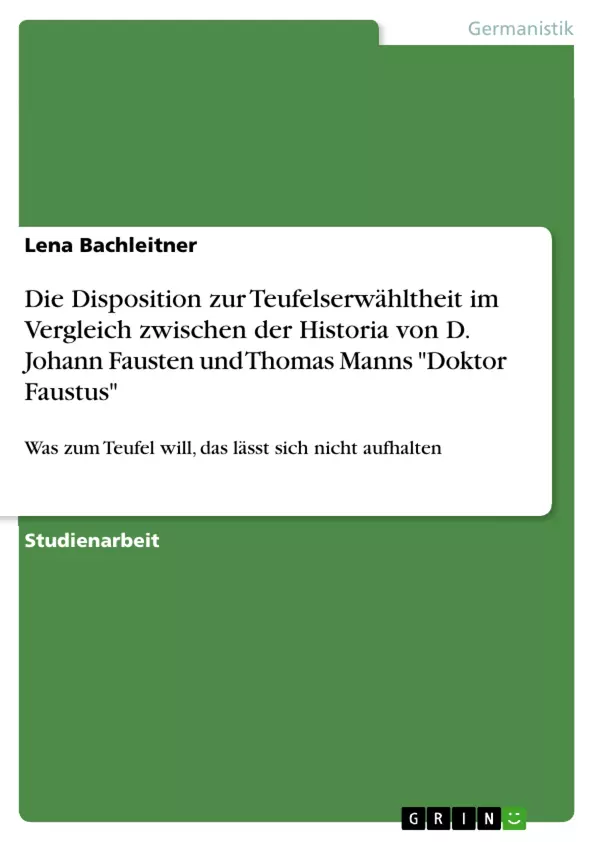Beide Protagonisten, D. Johann Fausten in der Historia sowie Adrian Leverkühn in Thomas Manns "Doktor Faustus", scheinen gewisse charakterliche Übereinstimmungen aufzuweisen, die eine Disposition zur Teufelserwähltheit nahelegen. Als Hintergrund kann die lutherisch-protestantische Lehre der Unfreiheit des Willens gesehen werden, die den Kontext der Historia ausmacht. Gerade Melancholie und innere Zerrissenheit bewirken wohl in besonderem Maße, sich dem Bösen anzuvertrauen durch selbstzerstörerische Tendenzen. Beide Protagonisten weisen außerdem eine überdurchschnittliche Intelligenz auf - denn in der Vernunft scheint das Teuflische vornehmlich am Werk zu sein.
Die vorliegende Seminararbeit behandelt also eingehender die Disposition zur Teufelserwähltheit in den beiden Werken durch den Versuch, charakterliche Übereinstimmungen zwischen Johann Fausten und Adrian Leverkühn zu konkretisieren. Es wird der These nachgegangen, inwieweit und durch welche Eigenschaften beide Charaktere für das Diabolische dispositioniert sind. Bezogen auf das Eingangszitat, sind Johann Fausten sowie Adrian Leverkühn individuelle, charakteristische Wesen, wodurch eine besondere Nähe zur Teufelsverfallenheit gezeigt werden soll.
Durch das Dokumentieren spezifischer Charaktermerkmale soll auf das Theorem geschlossen werden, dass es universelle Eigenschaften gibt, welche die Nähe zum Teufel besonders fundieren. Die Problematik, ob man den Teufel aus mittelalterlicher Perspektive in der Sünde zu erkennen glaubt oder aus neuzeitlicher Sicht als psychologisches Konstrukt im Menschen selbst, geht damit automatisch einher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt und Motivik des Teufelspaktes
- Die charakterliche Disposition für den Teufelspakt
- Melancholie
- Hoffart und Neugierde
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Disposition zur Teufelserwähltheit in der Historia von D. Johann Fausten und Thomas Manns Doktor Faustus, indem sie charakterliche Übereinstimmungen zwischen den Protagonisten, Johann Fausten und Adrian Leverkühn, beleuchtet. Die Arbeit geht der These nach, dass beide Figuren durch bestimmte Eigenschaften für das Diabolische prädestiniert sind und erörtert, inwiefern und durch welche Charaktermerkmale diese Nähe zum Teufel begründet wird. Die Problematik, ob der Teufel aus mittelalterlicher Perspektive als Repräsentant der Sünde oder aus neuzeitlicher Sicht als psychologisches Konstrukt innerhalb des Menschen zu verstehen ist, wird dabei ebenfalls in den Blick genommen.
- Charakterliche Gemeinsamkeiten zwischen Fausten und Leverkühn
- Die Rolle der Melancholie und der inneren Zerrissenheit
- Der Einfluss von Hoffart und Neugierde auf die Teufelserwähltheit
- Die Bedeutung der intellektuellen Fähigkeiten der Protagonisten
- Die Ambivalenz der Figur des Teufels
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die These der Arbeit vor: Sowohl Johann Fausten als auch Adrian Leverkühn weisen charakterliche Züge auf, die sie für den Teufelspakt prädisponieren. Die lutherisch-protestantische Lehre der Unfreiheit des Willens wird als relevanter Kontext für beide Werke betrachtet.
Inhalt und Motivik des Teufelspaktes
Dieser Abschnitt beleuchtet den Inhalt der Historia von D. Johann Fausten, einschließlich ihrer Gliederung und der zentralen Themen. Die Kindheit und Jugend Fausts, sein Studium der Theologie, seine Hinwendung zur Zauberei und der Abschluss des Pakts mit Mephostophiles werden dargestellt. Die Konsequenzen des Paktes und Fausts Lebenswandel bis zu seinem Untergang werden ebenfalls beschrieben.
Die charakterliche Disposition für den Teufelspakt
In diesem Kapitel werden charakterliche Gemeinsamkeiten zwischen Fausten und Leverkühn erörtert, die ihre Disposition zur Teufelserwähltheit erklären. Aspekte wie Melancholie, Hoffart und Neugierde werden im Detail analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Teufelserwähltheit, charakterliche Disposition, Melancholie, Hoffart, Neugierde, Intellektualität, Unfreiheit des Willens, Luthertum, Historia von D. Johann Fausten, Doktor Faustus, Johann Fausten, Adrian Leverkühn und die Ambivalenz des Teufels.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Seminararbeit?
Die Arbeit vergleicht die charakterliche Disposition zur "Teufelserwähltheit" in der 'Historia von D. Johann Fausten' und Thomas Manns 'Doktor Faustus'.
Welche Gemeinsamkeiten haben Fausten und Adrian Leverkühn?
Beide Figuren zeigen Melancholie, innere Zerrissenheit, überdurchschnittliche Intelligenz sowie Hoffart und Neugierde, was sie für das Diabolische anfällig macht.
Welche Rolle spielt die Melancholie?
Melancholie wird als Zustand beschrieben, der selbstzerstörerische Tendenzen bewirkt und dazu führt, sich dem Bösen anzuvertrauen.
Was bedeutet "Unfreiheit des Willens" in diesem Kontext?
Es bezieht sich auf die lutherisch-protestantische Lehre, die den Hintergrund für die Vorherbestimmung oder Disposition zur Sünde bildet.
Wie wird der Teufel in den Werken interpretiert?
Es wird untersucht, ob der Teufel als äußere Macht (mittelalterlich) oder als psychologisches Konstrukt im Menschen selbst (neuzeitlich) zu verstehen ist.
Warum ist Intelligenz ein Faktor für den Teufelspakt?
Die Arbeit argumentiert, dass das Teuflische vornehmlich in der Vernunft am Werk ist, wenn diese durch Hochmut (Hoffart) fehlgeleitet wird.
- Quote paper
- Lena Bachleitner (Author), 2018, Die Disposition zur Teufelserwähltheit im Vergleich zwischen der Historia von D. Johann Fausten und Thomas Manns "Doktor Faustus", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428356