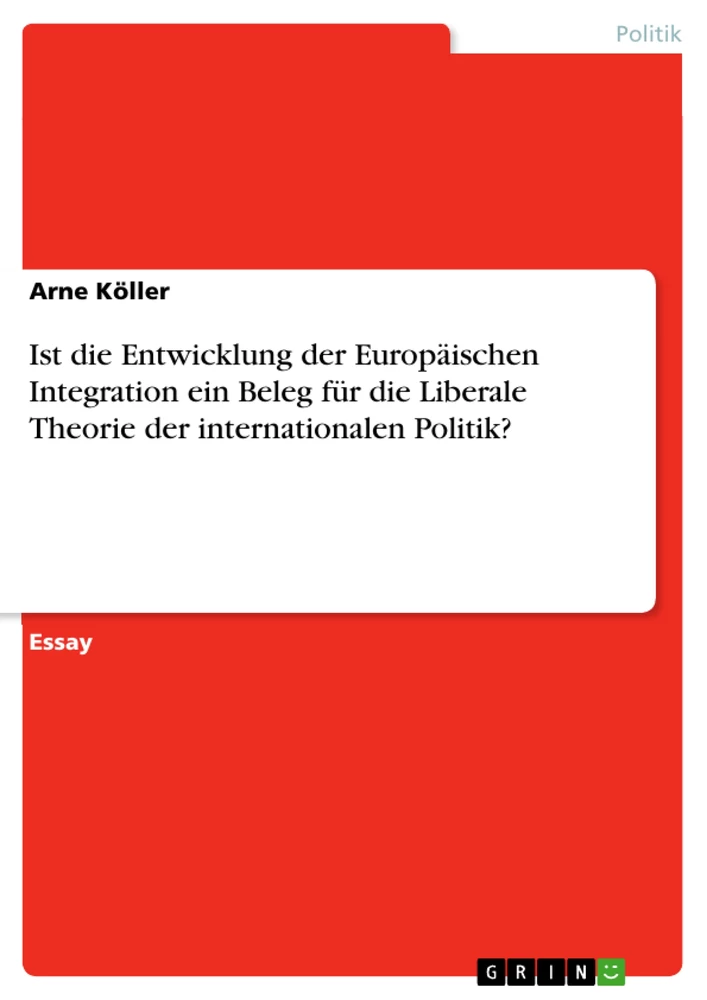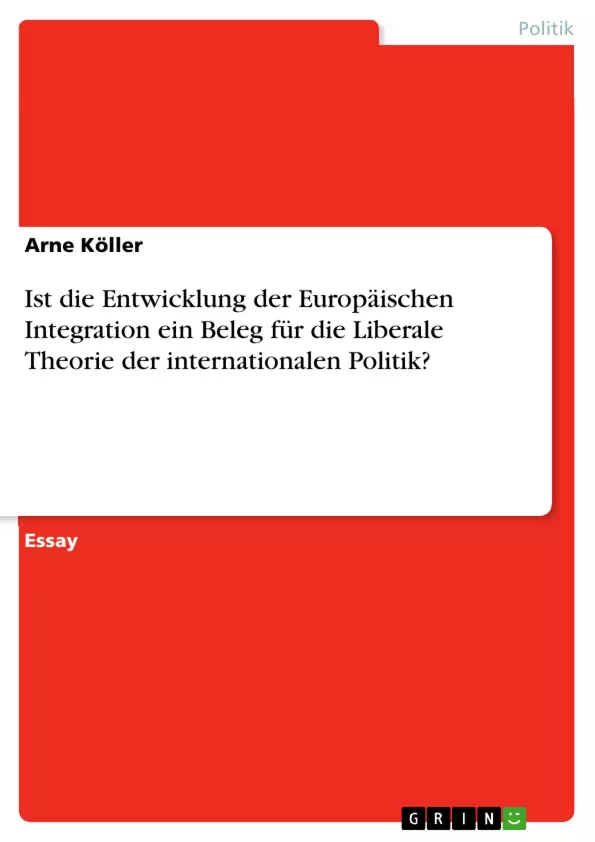Die Fragestellung, wie der Prozess der Europäischen Integration erklärbar ist, hat deshalb Relevanz, da hierdurch ähnliche vergangene, aktuelle und zukünftige Prozesse besser verstanden und gegebenenfalls vorhergesehen werden können.
Um die Frage, ob sich die Europäische Integration mit der Liberalen Theorie der internationalen Politik erklären lässt, ist zunächst eine Begriffsklärung notwendig: Was kennzeichnet die Liberale Theorie im Kontext der internationalen Politik? Was ist überhaupt „Integration“? Welcher Prozess im Einzelnen wird mit „Europäische Integration“ gemeint? Auf den folgenden Seiten werde ich die Liberale Theorie der internationalen Politik, im Speziellen den Liberalen Intergouvernementalismus sowie den Neofunktionalismus, und die Europäische Integration erläutern und verknüpfen. Als spezielles Fallbeispiel der Europäischen Integration habe ich die Osterweiterung der Europäischen Union im Jahre 2004 ausgewählt. Abschließend folgt ein Fazit, ob die Liberale Theorie geeignet ist die Europäische Integration hinreichend zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Einleitung
- Liberale Theorie der internationalen Politik
- Liberaler Intergouvernementalismus
- Neofunktionalismus
- Europäische Integration
- Fallbeispiel „Osterweiterung“ der Europäischen Union
- Liberaler Intergouvernementalismus und die Europäische Integration
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Frage, ob die Entwicklung der Europäischen Integration ein Beleg für die Liberale Theorie der internationalen Politik ist. Hierfür wird zunächst die Liberale Theorie der internationalen Politik, insbesondere der Liberale Intergouvernementalismus und der Neofunktionalismus, erläutert. Anschließend wird die Europäische Integration im Allgemeinen und die Osterweiterung im Jahr 2004 als Fallbeispiel vorgestellt. Schließlich wird die Frage beantwortet, ob die Liberale Theorie geeignet ist, die Europäische Integration hinreichend zu erklären.
- Die Liberale Theorie der internationalen Politik und ihre Kernprinzipien
- Der Liberale Intergouvernementalismus als analytisches Instrument für die Europäische Integration
- Der Neofunktionalismus und seine Bedeutung für die Europäische Integration
- Die Osterweiterung der Europäischen Union als Fallbeispiel für die Liberale Theorie
- Die Eignung der Liberalen Theorie zur Erklärung der Europäischen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Europäischen Integration ein und stellt die Fragestellung des Essays vor. Im folgenden Kapitel wird die Liberale Theorie der internationalen Politik und ihre zentralen Aspekte beleuchtet, wobei insbesondere der Liberale Intergouvernementalismus und der Neofunktionalismus näher betrachtet werden. Kapitel 4 befasst sich mit der Europäischen Integration im Allgemeinen, während Kapitel 5 die Osterweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004 als konkretes Fallbeispiel analysiert. In Kapitel 6 wird der Zusammenhang zwischen dem Liberalen Intergouvernementalismus und der Europäischen Integration untersucht. Schließlich wird im Fazit eine Antwort auf die Frage gegeben, ob die Liberale Theorie geeignet ist, die Europäische Integration hinreichend zu erklären.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Essays sind Liberale Theorie der internationalen Politik, Liberaler Intergouvernementalismus, Neofunktionalismus, Europäische Integration, Osterweiterung und Kosten-Nutzen-Kalkül. Diese Begriffe werden in der Arbeit verwendet, um die Entwicklung der Europäischen Integration und ihre Erklärung durch die Liberale Theorie zu analysieren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Liberale Intergouvernementalismus“?
Es ist eine Theorie, die besagt, dass die europäische Integration primär durch die rationalen Interessen der Nationalstaaten und deren Kosten-Nutzen-Kalküle vorangetrieben wird.
Wie erklärt der Neofunktionalismus die Integration?
Der Neofunktionalismus geht davon aus, dass Integration in einem Bereich (z.B. Wirtschaft) automatisch zu Integrationsdruck in anderen Bereichen führt (sogenannter Spill-over-Effekt).
Dient die Osterweiterung 2004 als Beleg für die liberale Theorie?
Die Arbeit untersucht die Osterweiterung als Fallbeispiel, um zu prüfen, ob die strategischen Entscheidungen der EU-Staaten mit den Vorhersagen der liberalen Theorie übereinstimmen.
Warum ist die Erklärung der europäischen Integration relevant?
Das Verständnis vergangener Integrationsprozesse hilft dabei, aktuelle Entwicklungen und zukünftige Erweiterungen oder Krisen der EU besser einzuschätzen und vorherzusehen.
Was ist das Fazit des Essays zur Eignung der liberalen Theorie?
Das Fazit bewertet, ob die liberale Theorie (Intergouvernementalismus und Neofunktionalismus) ausreicht, um die Komplexität der europäischen Einigung hinreichend zu erklären.
- Citation du texte
- Arne Köller (Auteur), 2018, Ist die Entwicklung der Europäischen Integration ein Beleg für die Liberale Theorie der internationalen Politik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428436