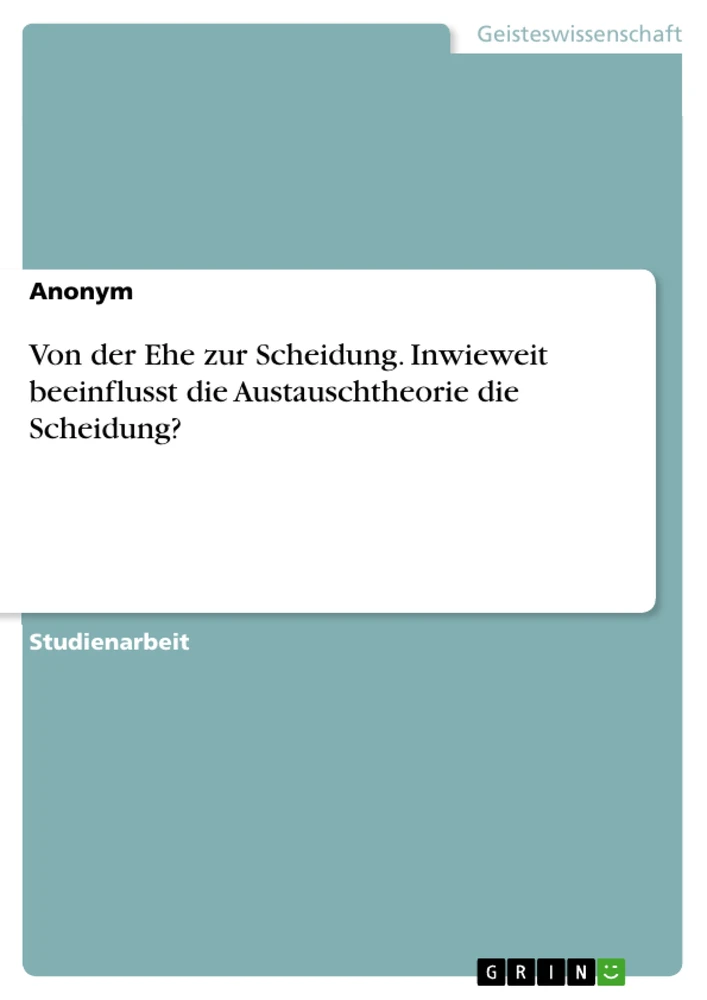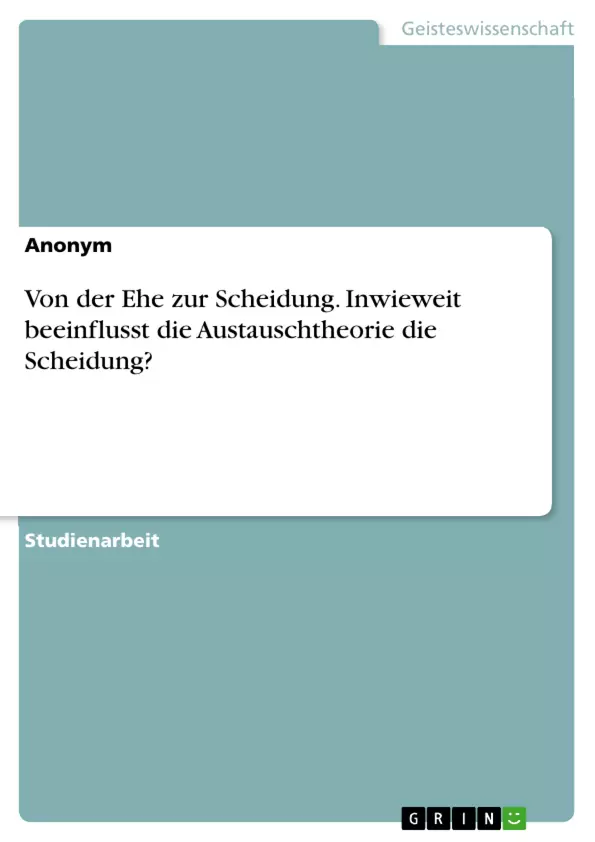„In guten wie in schlechten Zeiten – bis, dass der Tod euch scheidet.“
Dieses bei der Eheschließung oft verwendete Eheversprechen ist nur noch bedingt gültig, auch wenn viele Paare bei ihrer Hochzeit davon ausgehen, den Partner des Lebens gefunden zu haben und somit dieses Versprechen gedenken zu halten. Dem ist jedoch nicht immer so, sodass in einigen Ehen schon nach wenigen Jahren die Frage der Scheidung im Raum steht. Dabei gibt es das Konstrukt der Ehe schon so lange der Mensch zurückdenken kann.
Schon immer galt sie als ein sehr flexibles soziales Gebilde, auf das sich Ehepartner und Familienmitglieder stützen konnten und welches in vielerlei Formen auftrat. Doch anders als die meisten annehmen, wird der Ehe fälschlicherweise das Bild eines idyllischen, immer intakten Konstrukts unterstellt. Stattdessen stellt sie jedoch häufig eine Zweckgemeinschaft dar, die nicht „unbedingt Liebe und emotionale Zuneigung voraus[setzt]“. Traditionell gesehen stellt sie jedoch die einzig akzeptierte Form in der Gesellschaft dar, um eine sexuelle Beziehung zu führen und Kinder aufzuziehen.
Des Weiteren kristallisiert sich ein Familienbild heraus, indem der Mann als Alleinverdiener die Familie versorgt und die Frau zu Hause bleibt und als Hausfrau und Mutter fungiert. Dieses traditionelle Ehekonzept kann jedoch in der modernen Gesellschaft als problematisch angesehen werden. Demnach wird sich die vorliegende Arbeit mit der Frage beschäftigen, in wie fern die Austauschtheorie und das austauschtheoretische Modell der Ehescheidung den Entschluss zur Scheidung erklären können.
Im Folgenden werden zuerst zentrale Aspekte der Austauschtheorie nach Homans, Thibaut und Kelley näher erläutert, um im Anschluss auf das austauschtheoretische Modell der Ehescheidung einzugehen. Zur Verdeutlichung wird ein empirisch ermitteltes Fallbeispiel einer geschiedenen Frau interpretiert und auf die theoretischen Modelle angewandt. Im Anschluss werden die theoretischen Ansätze sowie die Analyse des Fallbeispiels kritisch betrachtet. Dafür werden einige weitere häufige Scheidungsgründe auf die Person im Fallbeispiel übertragen. Im Fazit wird letztendlich durch Analyse und Abwägen der zuvor genannten Aspekte die Ausgangsfrage kritisch beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Fundierung
- Die Austauschtheorie nach Homans, Thibaut und Kelley
- Austauschtheoretisches Modell der Ehescheidung
- Interpretation eines Fallbeispiels
- Kritische Betrachtung der Scheidungsmodelle in Bezug zum Fallbeispiel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Austauschtheorie und das austauschtheoretische Modell der Ehescheidung den Entschluss zur Scheidung erklären können.
- Zentrale Aspekte der Austauschtheorie nach Homans, Thibaut und Kelley
- Das austauschtheoretische Modell der Ehescheidung (Lewis & Spanier 1979)
- Interpretation eines empirisch ermittelten Fallbeispiels
- Kritische Betrachtung der theoretischen Ansätze und der Analyse des Fallbeispiels
- Zusammenfassende Beantwortung der Ausgangsfrage durch Analyse und Abwägung der genannten Aspekte.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Es wird ein kurzer Überblick über die Bedeutung der Ehe in der Gesellschaft gegeben und auf die Problematik des traditionellen Ehekonzepts in der modernen Gesellschaft eingegangen.
- Theoretische Fundierung: Dieses Kapitel erläutert die wichtigsten Aspekte der Austauschtheorie nach Homans, Thibaut und Kelley und des austauschtheoretischen Modells der Ehescheidung. Es werden die zentralen Annahmen der Theorie und die verschiedenen Arten des Austauschs beleuchtet, insbesondere der soziale oder reziproke Tausch.
Schlüsselwörter
Austauschtheorie, Ehescheidung, Homans, Thibaut, Kelley, Lewis & Spanier, Ressourcen, sozialer Tausch, Nutzenmaximierung, Kosten, Gewinn, Fallbeispiel, Scheidungsgründe.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Von der Ehe zur Scheidung. Inwieweit beeinflusst die Austauschtheorie die Scheidung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428449