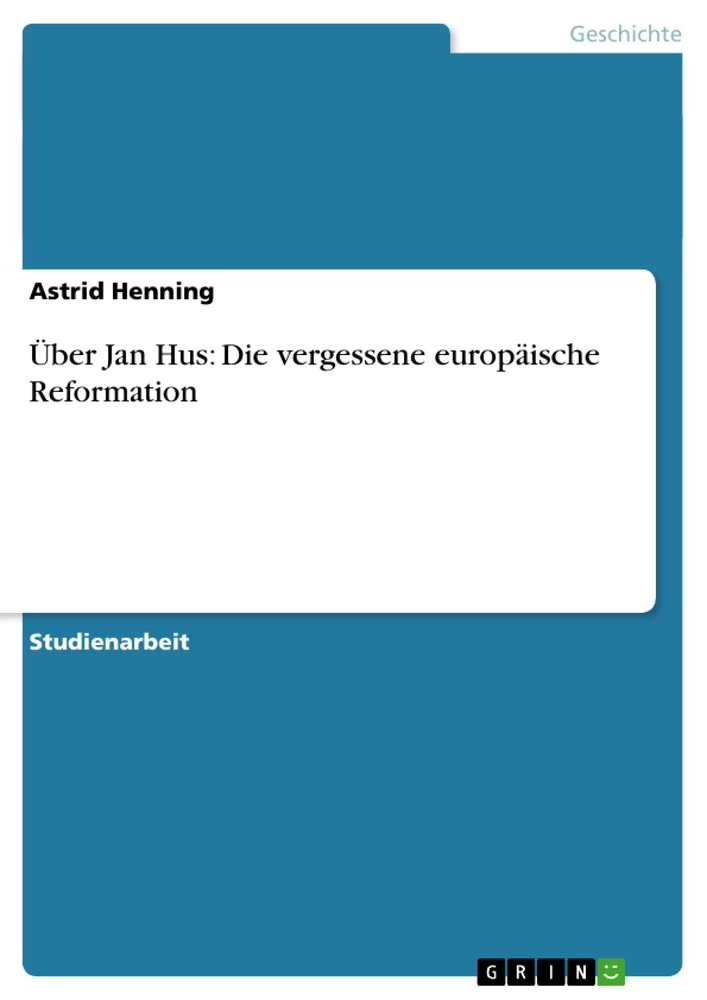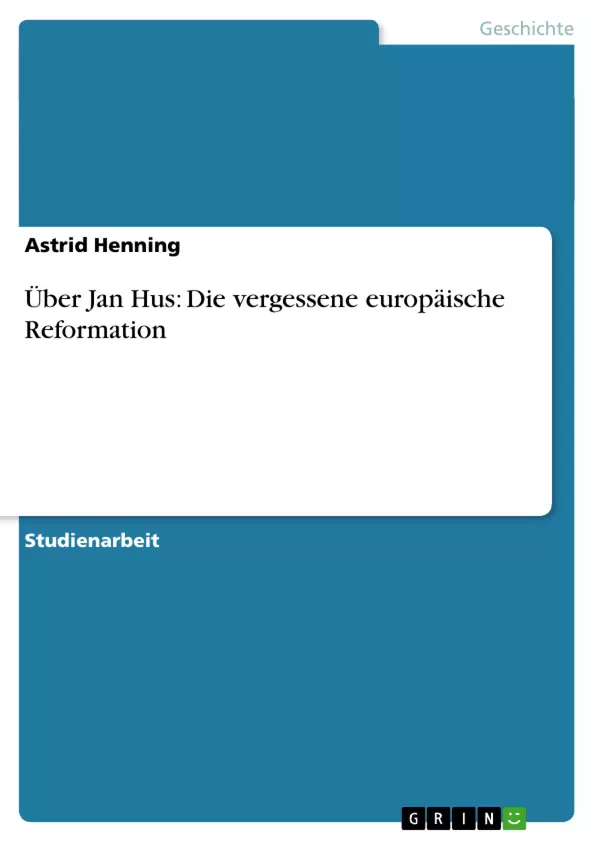Die Arbeit will nun also den Nutzen beleuchten, den eine Mystifizierung Luthers und ein „Vergessen“ des Reformators Hus für die deutschen Gesellschaftsverhältnisse 2004 mit sich bringt. Die methodische Grundlage findet sich dafür bei Michel Foucault und seinem Macht- und Diskursbegriff. Die Verfasserin ist sich bewusst, dass selbiger Begriff bei Foucault einem Wandel und einer Veränderung unterliegt. Von der Macht der „seriösen Sprecher“, also anerkannter „Koryphäen“, bestehende und auch vorherrschende Diskurse zu verändern – bis hin zur „Universalmacht“, durch welche jedes Individuum die Macht als selbst gewollt und als vernünftig akzeptiert, war es ein langer Gedankenweg. Zwischendrin hielt Foucault mehrmals an und entdeckte dabei einmal das Panoptikum als Gesellschaftsmodell. Hiernach wird jedes Individuum in den gesellschaftlichen Institutionen kontrolliert, indem es sich einer permanenten, nicht einsehbaren Kontrolle bewusst ist. Foucault beschränkt diese Kontrolle auf staatliche Autoritäten, auf Lehrerinnen, Polizistinnen, Ärztinnen. Das „Phänomen“ der Selbstzensur, nach dem auch bei Deutschen Intellektuellen in Ost und West (Beispiel Serbienkrieg oder 17. Juni 1953) eine Kontrolle der Gedanken möglich wird, zeigt jedoch, dass das permanente Bewusstsein von Kontrolle auch über die Wert(vorstellungen) funktioniert. Der bestehende Diskurs über einen Wert wird zum Machtstabilisator. Die Kritik der Aufklärung durch Horkheimer und Adorno7 ist nur der Anfang eines Diskurswechsels im europäischen Wertekonsens. Und der Ursprung eben jener, sich nun verändernden, europäischen Aufklärungswerte wird posthum mit der Reformation Martin Luthers in Verbindung gebracht. Um also diese Aufklärungswerte kritisieren zu können, muss die Person Luthers kritisch betrachtet werden.
7 Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Ungekürzte Ausgabe 28. – 31. Tausend, Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt / Main, 1993.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hus' Reformation
- II.1. Der Laienkelch und seine sozialen Folgen
- II.1.1. Prädestination
- II.1.2. Gehorsam
- II.1.3. Privilegien der Priester
- II.2. Arme Kirche und weltliche Macht
- II.3. Die Bedeutung des Hussitismus für das Ende des mittelalterlichen Denkens
- II.1. Der Laienkelch und seine sozialen Folgen
- III. Die Wertediskussion
- III.1. Michel Foucaults Panopticum
- III.2. Der Wertekanon Martin Luthers nach deutschen Geschichtsbüchern 2004
- III.3. Der Wertekanon des Hussitismus
- III.4. Zusammenfassung des Geschichtsbildes in bundesdeutschen Hauptschulbüchern 2004
- IV. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Instrumentalisierung Martin Luthers im deutschen Geschichtsbewusstsein und die dabei zutage tretenden Wertvorstellungen. Sie will herausarbeiten, warum Jan Hus, der tschechische Reformator, im deutschen Geschichtsbild kaum eine Rolle spielt, obwohl er 100 Jahre vor Luther lebte und dessen Reformation in vielerlei Hinsicht beeinflusst hat.
- Die Rolle von Martin Luther im deutschen Geschichtsbewusstsein und seine Stilisierung als Reformator schlechthin
- Die Bedeutung der Wertevorstellungen, die mit der Rezeption Luthers verbunden sind
- Die Bedeutung des tschechischen Reformators Jan Hus und seine Bedeutung für die Entwicklung der Reformation
- Der Einfluss von Macht und Diskurs auf die Konstruktion des Geschichtsbildes
- Die Rolle von Michel Foucaults Panoptikum als Modell für gesellschaftliche Kontrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II widmet sich der Reformation von Jan Hus. Dabei wird die Bedeutung des Laienkelchs und seine sozialen Folgen, insbesondere die Lehre der Prädestination und die Herausforderungen für den Gehorsam gegenüber der Kirche, beleuchtet. Kapitel III beleuchtet die Wertediskussion und untersucht die Rolle des Panoptikums in Foucaults Theorie. Schließlich wird der Wertekanon Martin Luthers anhand von deutschen Geschichtsbüchern beleuchtet und mit dem Wertekanon des Hussitismus verglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Reformation, insbesondere mit dem Vergleich von Martin Luther und Jan Hus. Sie analysiert die Bedeutung von Werten im Geschichtsbild und untersucht die Rolle von Macht und Diskurs in der Konstruktion des kollektiven Geschichtsbewusstseins. Im Zentrum der Arbeit stehen die Themen Prädestination, Gehorsam, Privilegien der Priester, Kirche und weltliche Macht, Panoptikum, Wertekanon, Erinnerungspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Jan Hus und warum ist er „vergessen“?
Jan Hus war ein tschechischer Reformator, der 100 Jahre vor Luther lebte. Er wird oft „vergessen“, weil die deutsche Geschichtsschreibung Luther als den alleinigen Begründer der Reformation stilisiert.
Welche Rolle spielt Michel Foucault in dieser Arbeit?
Mit Foucaults Macht- und Diskursbegriff wird analysiert, wie Geschichtsbilder konstruiert werden, um bestehende gesellschaftliche Werte zu stabilisieren.
Was war die Bedeutung des „Laienkelchs“ bei Hus?
Der Laienkelch symbolisierte die Gleichheit aller Gläubigen vor Gott und hatte weitreichende soziale Folgen, da er die Privilegien des Klerus infrage stellte.
Wie unterscheiden sich die Werte von Luther und Hus?
Die Arbeit vergleicht den hussitischen Wertekanon mit dem Luthers, wie er in deutschen Schulbüchern dargestellt wird, und zeigt unterschiedliche Akzente bei Gehorsam und kirchlicher Macht auf.
Was ist das „Panoptikum“ als Gesellschaftsmodell?
Es beschreibt eine permanente, unsichtbare Kontrolle, die zur Selbstzensur führt. In der Arbeit wird dies auf die Kontrolle von Gedanken über Wertvorstellungen übertragen.
- Arbeit zitieren
- Astrid Henning (Autor:in), 2004, Über Jan Hus: Die vergessene europäische Reformation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42849