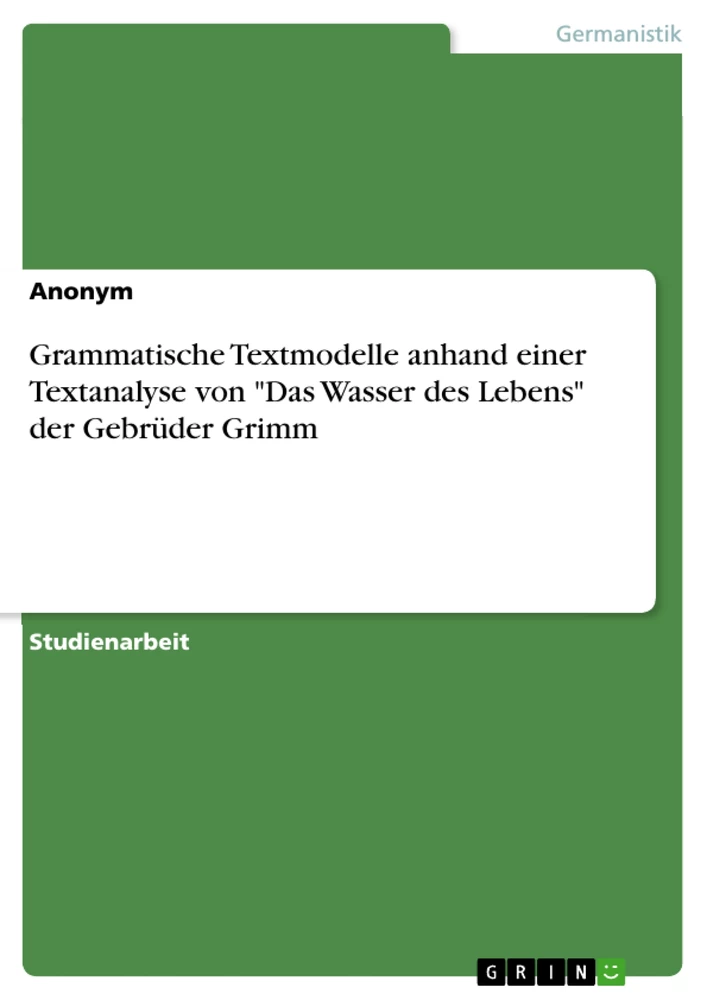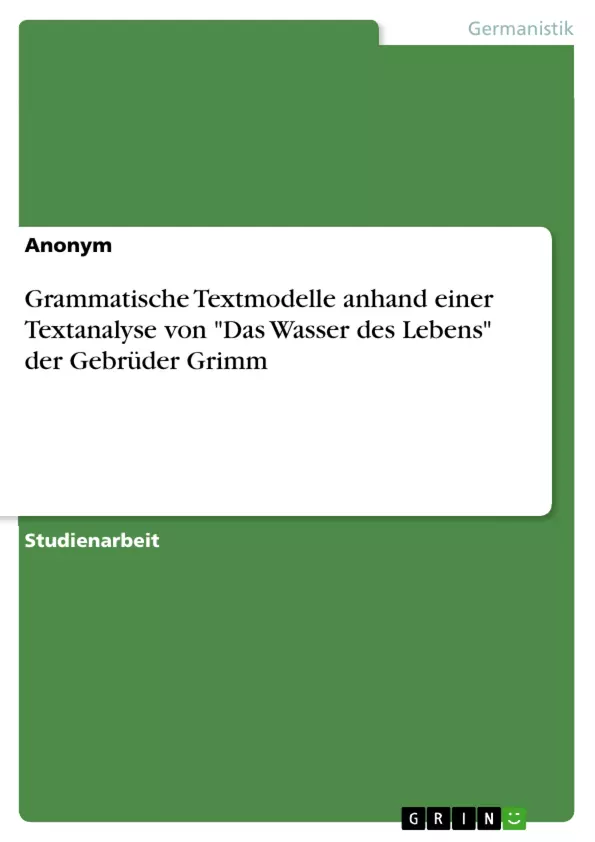Das Ziel dieser Textanalyse ist, die Brauchbarkeit der textgrammatischen Modelle in empirischer Analyse anhand eines Märchens der Gebrüder Grimm mit dem Titel "Das Wasser des Lebens" darzustellen. Die Forschungsfrage wäre: Welche Substitutionstypen weist dieses Märchen auf und wie hängen sie mit dem Gebrauch der Artikel und Pronomina zusammen? In meiner Arbeit werde ich das Modell von Roland Harweg (1968) und das Modell von Harald Weinrich (2003) miteinander vergleichen.
In dem einleitenden Teil werde ich einige wichtige Merkmale der textgrammatischen Modelle erörtern, dann befasse ich mich ausführlicher mit den Modellen von Harweg und Weinrich, die durch einige Beispiele aus dem Märchen erläutert werden. Zum Schluss werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die textgrammatischen Modelle
- Das Modell von Roland Harweg
- Das Modell von Harald Weinrich
- Die Pronomina
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Textanalyse befasst sich mit der Brauchbarkeit textgrammatischer Modelle bei der empirischen Analyse eines Märchens der Brüder Grimm, "Das Wasser des Lebens". Die Forschungsfrage ist, welche Substitutionstypen dieses Märchen aufweist und wie diese mit dem Gebrauch von Artikeln und Pronomina zusammenhängen. Die Arbeit vergleicht dazu das Modell von Roland Harweg (1968) mit dem Modell von Harald Weinrich (2003).
- Die Funktionsweise von textgrammatischen Modellen zur Textanalyse
- Untersuchung der Substitutionstypen im Märchen "Das Wasser des Lebens"
- Zusammenhang zwischen Substitutionstypen und dem Gebrauch von Artikeln und Pronomina
- Vergleich der Modelle von Roland Harweg und Harald Weinrich
- Analyse und Interpretation der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Einleitung in die Forschungsfrage und die Methode der Textanalyse, sowie eine Vorstellung der beiden textgrammatischen Modelle von Harweg und Weinrich.
- Die textgrammatischen Modelle: Beschreibung der textgrammatischen Modelle als Analysemethode, mit einem Fokus auf die Definition des Textes als transphrastische Einheit und den Einfluss von grammatischen Abhängigkeiten.
- Das Modell von Roland Harweg: Erläuterung von Harwegs Modell der Textkonstitution durch pronominale Verkettung, mit einer Unterscheidung zwischen Substituentia und Substituenda, sowie Beispiele aus dem Märchen "Das Wasser des Lebens".
- Das Modell von Harald Weinrich: Beschreibung von Weinrichs Modell der Kommunikationssteuerung durch grammatische Mittel, insbesondere Artikelformen und Tempusmorpheme, mit einem Fokus auf die Pronominalisierung und deren Arten.
Schlüsselwörter
Textgrammatik, Textanalyse, Märchen, "Das Wasser des Lebens", Brüder Grimm, Substitutionstypen, Artikel, Pronomina, pronominale Verkettung, Kommunikationssteuerung, thematische Pronomina, rhematische Pronomina, Harweg, Weinrich
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer textgrammatischen Analyse?
Das Ziel ist es, die sprachlichen Verknüpfungen (Kohäsion) innerhalb eines Textes zu untersuchen, um zu verstehen, wie Sätze zu einer größeren Einheit (transphrastische Einheit) verschmelzen.
Wie unterscheidet sich das Modell von Roland Harweg von dem Weinrichs?
Harweg konzentriert sich auf die pronominale Verkettung (Substituenda und Substituentia), während Weinrich die Kommunikationssteuerung durch Artikelformen und Tempusmorpheme in den Vordergrund stellt.
Was sind Substitutionstypen in einem Märchen?
Substitutionstypen beschreiben, wie Wörter durch Pronomina oder andere Artikelformen ersetzt werden, um den Lesefluss und den Bezug zu bereits erwähnten Personen oder Dingen aufrechtzuerhalten.
Welche Rolle spielen Artikel in der Textgrammatik nach Weinrich?
Nach Weinrich steuern Artikel die Aufmerksamkeit des Lesers: Bestimmte Artikel weisen auf Bekanntes hin (thematisch), während unbestimmte Artikel oft Neues einführen (rhematisch).
Warum wurde das Märchen "Das Wasser des Lebens" als Beispiel gewählt?
Märchen der Gebrüder Grimm weisen oft eine klare, repetitive Struktur auf, die sich hervorragend eignet, um die Brauchbarkeit grammatischer Modelle in der empirischen Analyse aufzuzeigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Grammatische Textmodelle anhand einer Textanalyse von "Das Wasser des Lebens" der Gebrüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428505