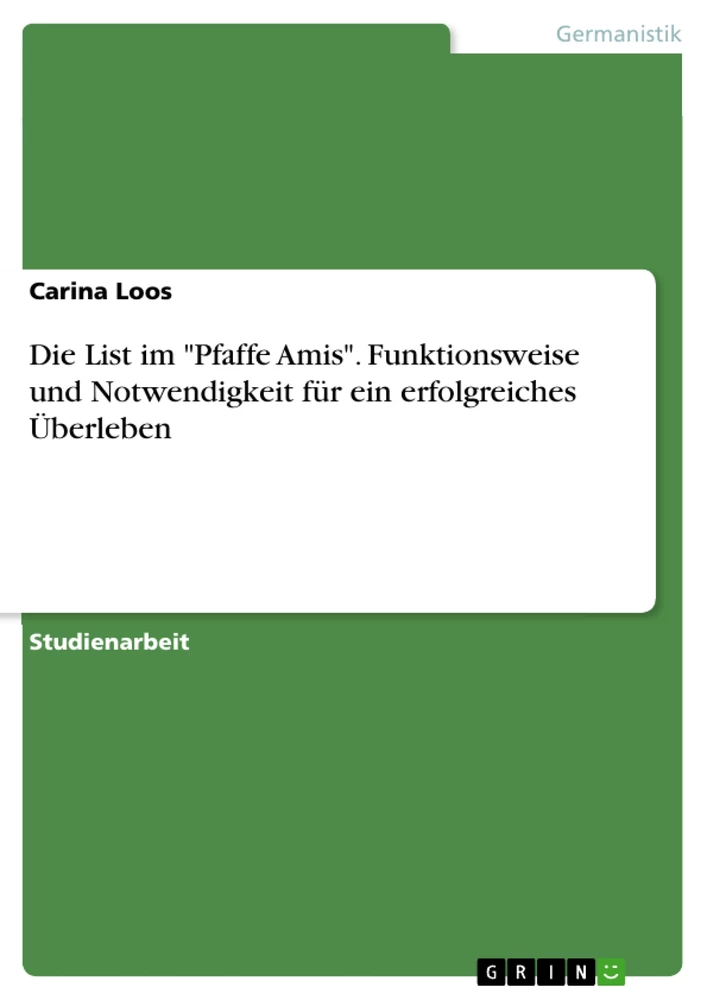Im Folgendem möchte ich vier Schwänke „Amis und der Bischof“, „Die unsichtbaren Bilder“, „Der auferstandene Hahn“ und „Der Edelsteinhändler“ des Strickers analysieren und interpretieren, um die Funktionsweise der angewandten List aufzuzeigen und klären, ob die angewandte „List“ eine Notwenigkeit für den Pfaffen Amis ist, um erfolgreich zu überleben. Weiterhin möchte ich klären ob dies als eine positive Eigenschaft anzusehen ist, da er stets in milde handelt und sich an seinem erbeuteten Geld nicht bereichern möchte. Sondern seine Motivation darin liegt, sein ganzes Vermögen gänzlich auszugeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Semantische Definition der List im Mittelhochdeutschen bis hin zur Gegenwartssprache
- Existenzbedrohung des Pfaffen Amis
- Beginn der „List“ aus Notwehr
- Beginn der „List“ als Abwendung des wirtschaftlichen Verlustes und seiner milde
- Die unsichtbaren Bilder
- Angst als Hilfsmittel der List
- Wundergläubigkeit als Hilfsmittel der List
- Der auferstandene Hahn
- Gewalt als Hilfsmittel der List
- Der Edelsteinhändler v. 1820 - 2244
- Fazit
- Epilog – die Lobpreisung des Erzählers
- Funktionsweise der List
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse und Interpretation der List des Pfaffen Amis im mittelhochdeutschen Schwankroman „Der Stricker: Pfaffe Amis“. Ziel ist es, die Funktionsweise der angewandten List aufzuzeigen und zu untersuchen, ob sie für das erfolgreiche Überleben des Pfaffen Amis notwendig ist. Des Weiteren soll geklärt werden, ob die „List“ als positive Eigenschaft anzusehen ist, da Amis stets in milde handelt und sich nicht an seinem erbeuteten Geld bereichert, sondern sein ganzes Vermögen ausgegeben möchte.
- Semantische Entwicklung der List im Mittelhochdeutschen und in der Gegenwart
- Existenzbedrohung und Notwehr des Pfaffen Amis
- Anwendungen der List: Angst, Wundergläubigkeit und Gewalt
- Motivation und Handlungsweise des Pfaffen Amis
- Positive oder negative Konnotation der List?
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt den Kontext des mittelhochdeutschen Schwankromans „Der Stricker: Pfaffe Amis“ dar und führt den Protagonisten, den Pfaffen Amis, als einen Mann ein, der die Lüge und den Betrug in die Welt brachte. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse von vier ausgewählten Schwänken, um die Funktionsweise der angewandten List zu beleuchten.
Semantische Definition der List im Mittelhochdeutschen bis hin zur Gegenwartssprache
Dieses Kapitel untersucht die semantische Entwicklung des Wortes „List“ im Laufe der Sprachgeschichte. Es zeigt, wie sich die Bedeutung vom ursprünglichen Begriff der „Weisheit“ hin zur „Täuschung“ entwickelte. Die Arbeit betrachtet die unterschiedlichen Definitionen in mittelalterlichen Lexika und vergleicht sie mit dem modernen Sprachgebrauch.
Existenzbedrohung des Pfaffen Amis
Dieses Kapitel beleuchtet die Situation des Pfaffen Amis, der sich aufgrund seiner Freigebigkeit und der Missgunst des Bischofs in einer prekären Lage befindet. Die Arbeit analysiert die erste Anwendung der List als Notwehrhandlung, die Amis ergreifen muss, um seinen Besitz und seine Kirche zu schützen.
Die unsichtbaren Bilder
Das Kapitel behandelt die Anwendung von Angst als Mittel der List. Der Pfaffe Amis nutzt die Angst der Menschen, um sie zu täuschen und Geld von ihnen zu erlangen.
Angst als Hilfsmittel der List
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Nutzung von Angst als Mittel der List. Der Pfaffe Amis erzeugt Angst bei den Menschen, um diese zu manipulieren.
Wundergläubigkeit als Hilfsmittel der List
Hier wird die Nutzung der Wundergläubigkeit als Mittel der List untersucht. Der Pfaffe Amis bedient sich des Aberglaubens der Menschen, um ihnen seine List aufzuzwingen.
Der auferstandene Hahn
Dieser Abschnitt analysiert den Schwank vom auferstandenen Hahn, in dem der Pfaffe Amis die Wundergläubigkeit der Menschen für seine List nutzt.
Gewalt als Hilfsmittel der List
Dieses Kapitel untersucht den Einsatz von Gewalt als Mittel der List. Der Pfaffe Amis wendet Gewalt an, um seine Ziele zu erreichen.
Der Edelsteinhändler v. 1820 - 2244
Dieser Abschnitt beleuchtet den Schwank vom Edelsteinhändler, in dem der Pfaffe Amis Gewalt als Mittel der List einsetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: „List“, „mittelhochdeutscher Schwankroman“, „Pfaffe Amis“, „Existenzbedrohung“, „Notwehr“, „Milde“, „Angst“, „Wundergläubigkeit“, „Gewalt“, „Täuschung“, „semantische Entwicklung“, „Bedeutungsumfang“, „Motivation“ und „Handlungsweise“. Der Fokus liegt auf der Analyse der List als Mittel zum Überleben und der Frage, ob sie als positive oder negative Eigenschaft anzusehen ist.
Häufig gestellte Fragen
Wer war der Pfaffe Amis?
Der Pfaffe Amis ist der Protagonist des ersten deutschen Schwankromans von dem Stricker. Er ist ein Geistlicher, der durch List und Betrug seinen Lebensunterhalt sichert.
Warum wendet der Pfaffe Amis List an?
Oft aus einer wirtschaftlichen Notlage oder Notwehr heraus, da sein großzügiger Lebensstil und die Gier seines Bischofs seine Existenz bedrohen.
Ist die List im "Pfaffe Amis" positiv oder negativ besetzt?
Dies ist ambivalent. Einerseits betrügt er Menschen, andererseits handelt er oft mildtätig und nutzt das Geld nicht zur persönlichen Bereicherung, sondern gibt es wieder aus.
Wie hat sich die Bedeutung des Wortes "List" gewandelt?
Im Mittelhochdeutschen bedeutete „list“ ursprünglich Weisheit, Kunstfertigkeit oder Wissen. Erst später wandelte sich die Bedeutung hin zu Täuschung und Hinterlist.
Welche Rolle spielt die Wundergläubigkeit in den Schwänken?
Amis nutzt den Aberglauben und die Wundergläubigkeit der Menschen (z. B. im Schwank vom auferstandenen Hahn) gezielt aus, um seine Betrügereien erfolgreich durchzuführen.
- Citation du texte
- Carina Loos (Auteur), 2017, Die List im "Pfaffe Amis". Funktionsweise und Notwendigkeit für ein erfolgreiches Überleben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428602