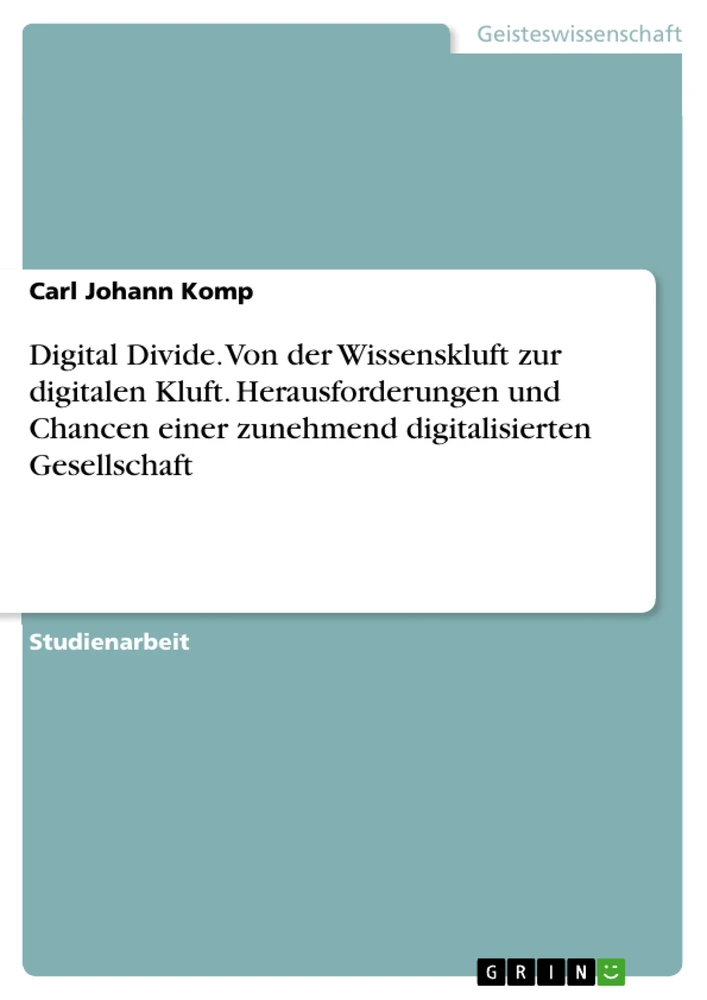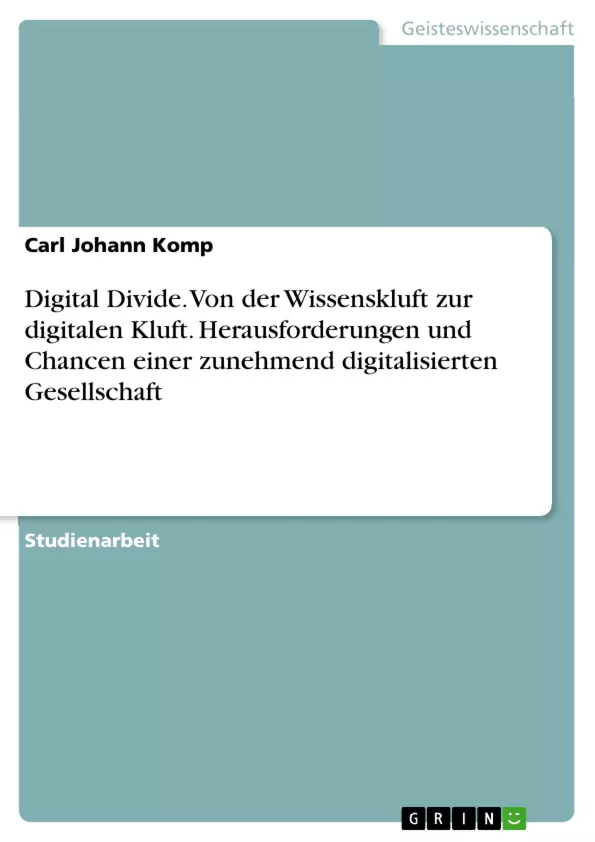Diese Arbeit untersucht das Themenfeld der Wissensklufthypothese und des Digital Divide, der digitalen Kluft, im Kontext von Globalisierung und Digitalisierung der Gesellschaft. Ziel ist, den Begriff der Wissenskluft und des Digital Divide zu definieren und zu klären, warum diese Begriffe heute in unserer zunehmend digitalisierten Welt aktueller sind denn je.
In diesem Kontext wird zunächst auf das Thema der Wissensklufthypothese eingegangen. Abschnitt zwei widmet sich der Definition und dem theoretischen Hintergrund dieser These. Das Thema der Wissenskluft ist bewusst an den Anfang dieser Arbeit gestellt, weil dieses zum Verständnis der thematisch folgenden digitalen Kluft beiträgt und als Vorstufe bzw. als Ergänzung zur digitalen Kluft gesehen werden kann.
Abschnitt drei geht auf das Themenfeld des sehr weitläufigen Begriffs der Digital Divide im Zuge von Digitalisierung und Globalisierung ein. In einem zweiten und dritten Teil dieses Abschnitts soll auf das Thema Digital Divide selbst eingegangen werden, bei dem das Spezifikum des Mediums Internet im Mittelpunkt steht. Zu diesem Zweck liegt der Fokus hier in der Betrachtung des Problems der Digital Divide, dem Problem der Ungleichverteilung von Wissen und Informationen aus der Nutzung digitaler Medien.
Im Anschluss dieses Themenblocks werde ich auf die Methodik der quantitativen Datenerhebung eingehen. Kapitel vier behandelt eine Beschreibung der Aufgabenstellung, der verwendeten Methodik und des Fragebogens. Die Fragestellungen dieser schriftlichen und empirischen Umfrage liegen verstärkt im Bereich der Informationsgewinnung aus der Mediennutzung und den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für die Gesellschaft. In Kapitel fünf werden die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Umfrage strukturiert und ausgewertet. Das sechste und letzte Kapitel behandelt die Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissensklufthypothese
- Definition der Wissensklufthypothese
- Theoretischer Hintergrund
- Digital Divide im Zuge der Digitalisierung und Globalisierung
- Digitalisierung und Globalisierung
- Digital Divide
- Second Level Digital Divide
- Methodik der quantitativen Datenerhebung
- Aufgabenstellung
- Methodik
- Erhebung
- Ergebnisse
- Mediennutzung und Informationsgewinnung
- Ausgewählte Herausforderungen der Digitalisierung für die Gesellschaft
- Ausgewählte Chancen der Digitalisierung für die Gesellschaft
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Konzept der Wissensklufthypothese und des Digital Divide im Kontext der Globalisierung und Digitalisierung. Ziel ist es, diese Begriffe zu definieren und zu erklären, warum sie in einer zunehmend digitalisierten Welt von großer Bedeutung sind. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung der Wissenskluft als Grundlage für das Verständnis des Digital Divide und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft.
- Definition und theoretischer Hintergrund der Wissensklufthypothese
- Auswirkungen der Digitalisierung und Globalisierung auf das Digital Divide
- Die Rolle des Internets und die Ungleichverteilung von Wissen und Informationen durch digitale Medien
- Methodik der quantitativen Datenerhebung und Analyse der Ergebnisse
- Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Themenfeld der Wissensklufthypothese und des Digital Divide ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
Kapitel zwei widmet sich der Wissensklufthypothese. Es werden die Definition und der theoretische Hintergrund der Hypothese dargelegt, die besagt, dass Menschen mit höherem sozioökonomischen Status Informationen aus den Medien schneller aufnehmen und somit die Wissenskluft zu niedrigeren Schichten vergrößert.
Kapitel drei behandelt das Digital Divide im Kontext von Digitalisierung und Globalisierung. Hier wird das Konzept des Digital Divide als Ungleichverteilung von Wissen und Informationen durch digitale Medien beleuchtet.
Kapitel vier beschreibt die Methodik der quantitativen Datenerhebung, die in der Arbeit verwendet wird. Es werden die Aufgabenstellung, die Methodik und die Erhebung des Fragebogens dargestellt.
Kapitel fünf präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage und analysiert die Erkenntnisse im Hinblick auf Mediennutzung, Informationsgewinnung, Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für die Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Wissensklufthypothese, Digital Divide, Digitalisierung, Globalisierung, Mediennutzung, Informationsgewinnung, soziale Ungleichheit, quantitativ, Datenerhebung, Herausforderungen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Wissensklufthypothese?
Sie besagt, dass Menschen mit höherem sozioökonomischen Status Informationen aus den Medien schneller aufnehmen, wodurch sich die Wissenskluft zu niedrigeren Schichten vergrößert.
Was versteht man unter dem Begriff „Digital Divide“?
Der Digital Divide (digitale Kluft) beschreibt die Ungleichverteilung des Zugangs zu und der Nutzung von digitalen Medien und dem daraus resultierenden Wissen in der Gesellschaft.
Was ist der „Second Level Digital Divide“?
Dieser Begriff bezieht sich nicht nur auf den physischen Zugang zum Internet, sondern auf die unterschiedlichen Kompetenzen und die Art der Nutzung digitaler Medien.
Welche Rolle spielt die Globalisierung für die digitale Kluft?
Die Arbeit untersucht, wie Digitalisierung und Globalisierung die Herausforderungen der Ungleichverteilung von Informationen weltweit verstärken.
Welche Chancen bietet die Digitalisierung laut der Umfrage?
In Kapitel 5 werden die Ergebnisse einer empirischen Umfrage ausgewertet, die spezifische Chancen für die Informationsgewinnung und gesellschaftliche Teilhabe aufzeigen.
- Quote paper
- Carl Johann Komp (Author), 2016, Digital Divide. Von der Wissenskluft zur digitalen Kluft. Herausforderungen und Chancen einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428785