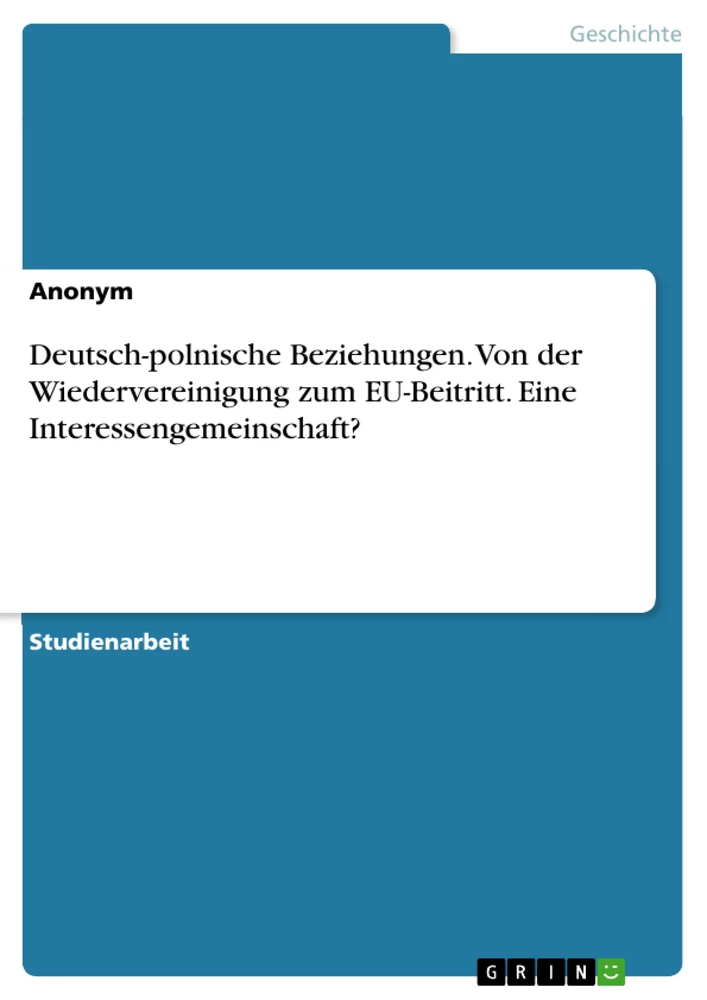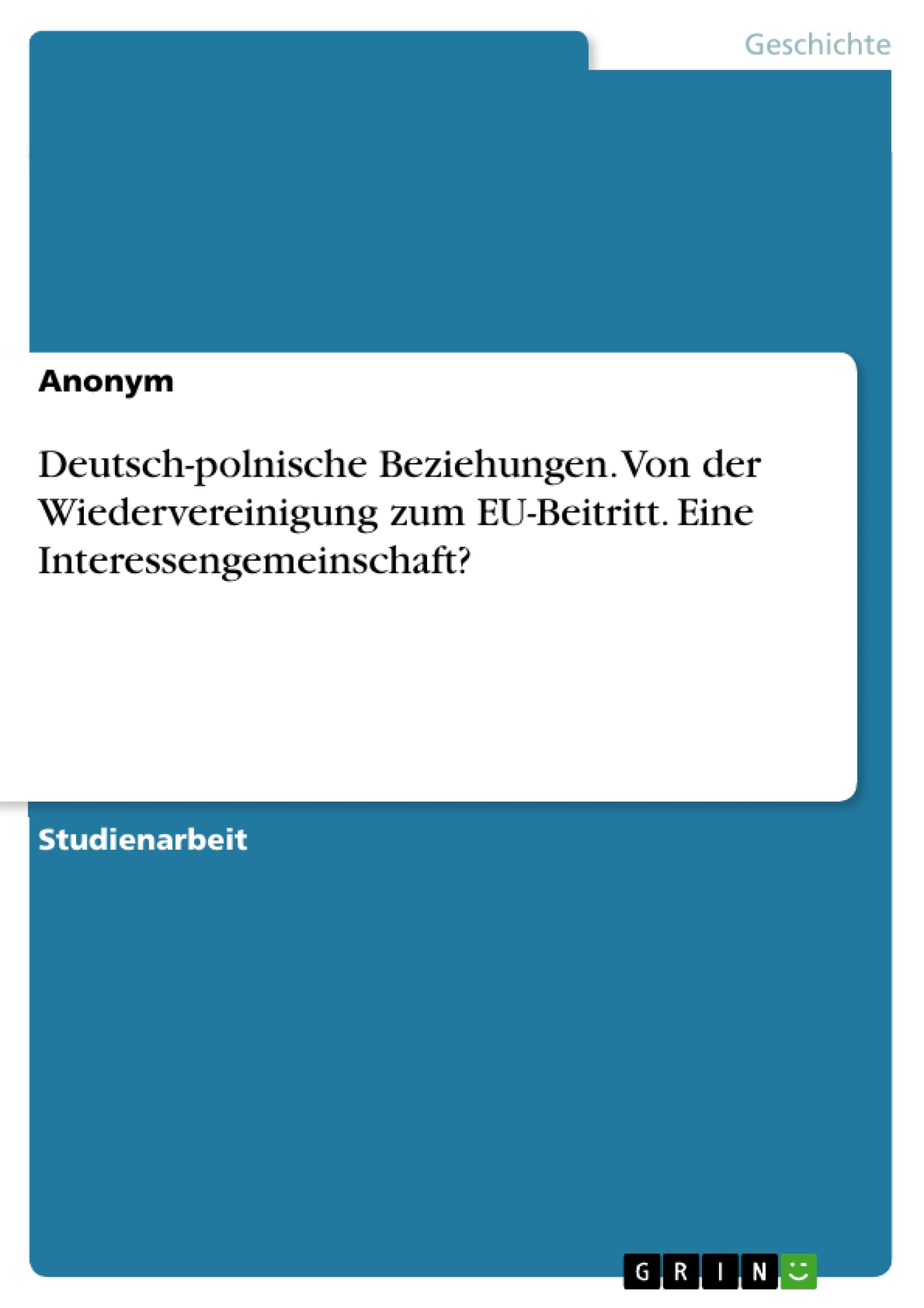Abriss über die deutsche Nachkriegsgeschichte in Bezug auf das Verhältnis zu Polen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die politischen Dimensionen der Beziehung zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland aufzuzeigen. Dies soll anhand der Leitfrage, ob es denn eine sogenannte „Interessengemeinschaft“ gibt oder gegeben hat geschehen. Dazu werden einzelne Ereignisse, länger andauernde Prozesse, bi- und multilaterale Verträge und Zusammenkünfte sowie gesellschaftliche Debatten in Polen und Deutschland, die einen großen Einfluss auf die bilateralen Beziehungen nahmen, untersucht und zueinander in Verbindung gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Von der Irritation um „die östlichen Teile des Deutschen Reiches“ zum Abkommen über „gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“
- Politik der kleinen Schritte - Assoziierungsabkommen und Kopenhagener Kriterien
- Schwere Belastung der Beziehungen - das Ende des Versöhnungskitsches und der Papierkrieg 1998
- Rot-grüner Wahlsieg und die Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter als erste Belastungsprobe
- Osterweiterung der EU - die „Wiedervereinigung Europas“?
- Europa in der Krise? Der Irakkrieg und der Streit um die EU-Verfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politischen Dimensionen der deutsch-polnischen Beziehungen seit der Wiedervereinigung, insbesondere die Frage nach dem Bestehen einer „Interessengemeinschaft“. Analysiert werden einzelne Ereignisse, Prozesse, Verträge und gesellschaftliche Debatten, die die bilateralen Beziehungen beeinflussten.
- Die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs
- Die Rolle von Verträgen und Abkommen in der Gestaltung der Beziehungen
- Die Bedeutung von wirtschaftlichen Faktoren und der Versöhnungspolitik
- Herausforderungen und Belastungsproben im deutsch-polnischen Verhältnis
- Der Einfluss der EU-Osterweiterung auf die Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beschreibt die deutsch-polnischen Beziehungen als von „herausgehobener Bedeutung“, jedoch auch komplex. Sie thematisiert den intensiven kulturellen Austausch und die anhaltende Problematik von Vorurteilen, illustriert am Beispiel der Debatte um den ZDF-Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Analyse der politischen Dimensionen der Beziehungen und der Frage nach einer „Interessengemeinschaft“.
Von der Irritation um „die östlichen Teile des Deutschen Reiches“ zum Abkommen über „gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“: Dieses Kapitel beschreibt die anfänglichen Irritationen nach der Wiedervereinigung, insbesondere um die Frage der Oder-Neiße-Grenze und die polnische Forderung nach einer „deutsch-polnischen Interessengemeinschaft“. Die Verhandlungen um die Wiedervereinigung und die darauffolgenden Grenz- und Nachbarschaftsverträge von 1990 und 1991 werden analysiert, die letztendlich zu einer Verbesserung der Beziehungen führten. Die Gründung des Weimarer Dreiecks wird als Beispiel für die Umsetzung der „guten Nachbarschaft“ genannt. Der wirtschaftliche Aufschwung Polens und die Versöhnungspolitik werden als weitere wichtige Faktoren für die positiven Beziehungen der frühen 1990er Jahre hervorgehoben.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Deutsch-Polnische Beziehungen seit der Wiedervereinigung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die politischen Dimensionen der deutsch-polnischen Beziehungen seit der Wiedervereinigung. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Bestehen einer „Interessengemeinschaft“ zwischen beiden Ländern. Die Analyse umfasst Ereignisse, Prozesse, Verträge und gesellschaftliche Debatten, die die bilateralen Beziehungen beeinflusst haben.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die Rolle von Verträgen und Abkommen, die Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren und der Versöhnungspolitik, Herausforderungen und Belastungsproben im Verhältnis, sowie den Einfluss der EU-Osterweiterung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in der Einleitung?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, beginnend mit einer Einführung. Die Einleitung beschreibt die deutsch-polnischen Beziehungen als herausgehoben bedeutsam, aber auch komplex. Sie thematisiert den intensiven kulturellen Austausch und die anhaltende Problematik von Vorurteilen, illustriert am Beispiel der Debatte um den ZDF-Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“. Der Fokus liegt auf der Analyse der politischen Dimensionen und der Frage nach einer „Interessengemeinschaft“.
Wie beschreibt die Arbeit die Anfangsphase der deutsch-polnischen Beziehungen nach der Wiedervereinigung?
Das zweite Kapitel beschreibt die anfänglichen Irritationen nach der Wiedervereinigung, insbesondere bezüglich der Oder-Neiße-Grenze und der polnischen Forderung nach einer „deutsch-polnischen Interessengemeinschaft“. Es analysiert die Verhandlungen um die Wiedervereinigung und die Grenz- und Nachbarschaftsverträge von 1990 und 1991, die zu einer Verbesserung der Beziehungen führten. Die Gründung des Weimarer Dreiecks und der wirtschaftliche Aufschwung Polens werden als positive Faktoren hervorgehoben.
Welche weiteren Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Weitere Kapitel befassen sich mit der Politik kleiner Schritte, Assoziierungsabkommen und Kopenhagener Kriterien; schweren Belastungen der Beziehungen, inklusive des Papierkriegs 1998; dem rot-grünen Wahlsieg und der Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter; der Osterweiterung der EU und deren Auswirkungen; sowie der Krise um den Irakkrieg und den Streit um die EU-Verfassung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2012, Deutsch-polnische Beziehungen. Von der Wiedervereinigung zum EU-Beitritt. Eine Interessengemeinschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428860