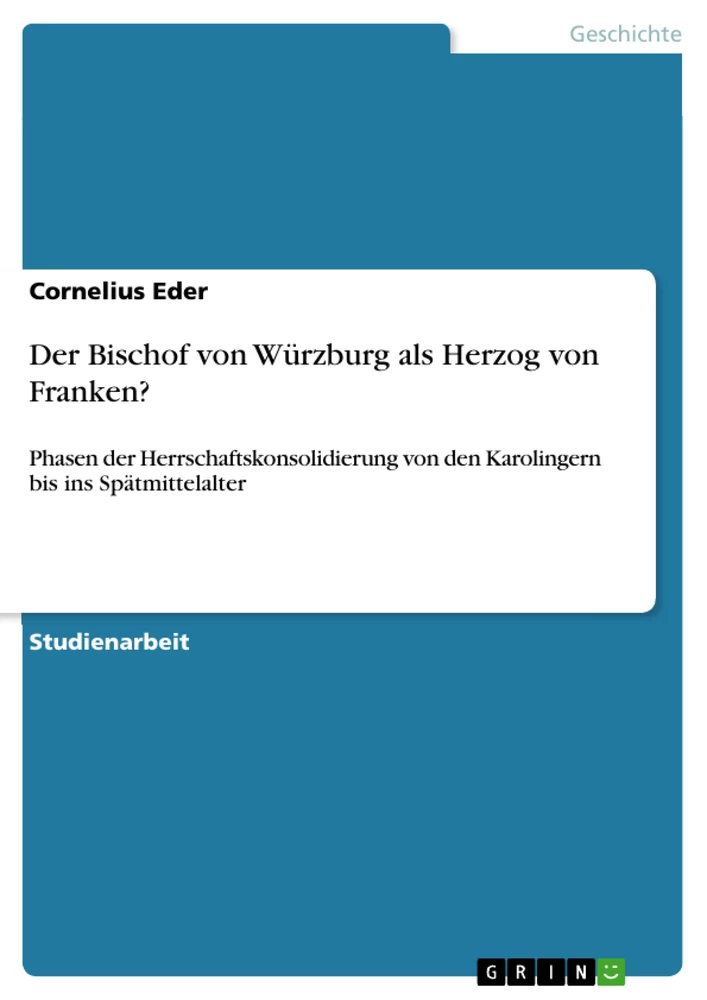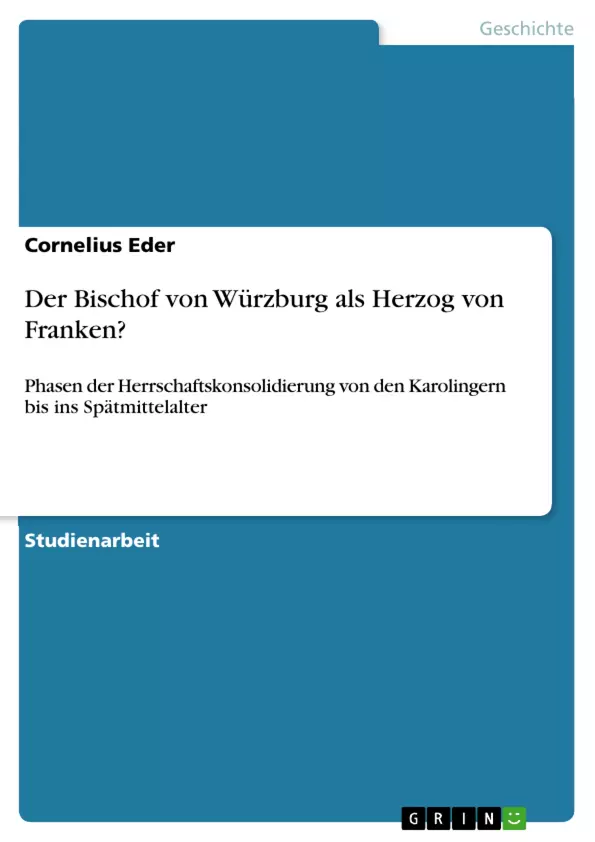Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Würzburger Bischöfe im Laufe des Mittelalters einen fränkischen Herzogtitel erlangen und behaupten konnten. Der Forschungsbegriff einer fränkischen Herzogswürde in Personalunion des Würzburger Bischofs war längere Zeit umstritten. Im Sinne bereits überholter Forschungsergebnisse hält sich aber, teils noch bis heute, die Vorstellung, dass sich schon im hohen Mittelalter ein territorial klar begrenztes Herzogtum Franken entwickelte. Dass diese, der älteren Forschung entlehnte Vorstellung falsch ist, soll im Laufe dieser Arbeit mittels neuerer Untersuchungen sowie anhand von zeitgenössischen Quellen belegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A) Herzogtum Franken – ein falsch datierter Topos der älteren Geschichtswissenschaft
- B) Der Weg zur fränkischen Herzogswürde
- I) Franken als Herrschaftsraum im frühen Mittelalter
- II. Die Babenberger Fehde - Umschwung und Aufstieg des Bistums im Wechsel von den Karolingern zu den Ottonen
- III. Ottonen und Salier - Aufstieg des Würzburger Bischofs zur Lokalmacht
- IV. Die Zeit der Staufer und des Investiturstreites und der damit verbundene Aufstieg des Adels
- 4.1 Der Investiturstreit bis zum Jahr 1120 und die Verleihung der dignitas iudiciaria
- 4.2 Der weitere Streit um den dux-Titel in Franken bis zur Güldenen Freiheit 1168
- V. Das Spätmittelalter und das Herzogtum Franken
- C) Wahrzeichen ehemaliger herzöglicher Macht im heutigen Würzburg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Macht des Würzburger Bischofs im fränkischen Raum vom frühen Mittelalter bis ins Spätmittelalter. Sie widerlegt den Mythos eines klar definierten Herzogtums Franken und beleuchtet den Aufstieg des Bistums Würzburg zu einer einflussreichen Territorialmacht. Die Analyse basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit neueren Forschungsergebnissen und zeitgenössischen Quellen.
- Der Mythos des fränkischen Herzogtums im hohen Mittelalter
- Der Aufstieg des Bistums Würzburg zur Territorialmacht
- Die Rolle des Würzburger Bischofs im Kontext der Reichspolitik
- Die Bedeutung des Investiturstreits für die Macht des Bischofs
- Die Entwicklung der weltlichen Rechte des Würzburger Bischofs
Zusammenfassung der Kapitel
A) Herzogtum Franken – ein falsch datierter Topos der älteren Geschichtswissenschaft: Die Arbeit beginnt mit der Auseinandersetzung mit dem lange verbreiteten, aber irrigen Topos eines klar umgrenzten Herzogtums Franken im Hochmittelalter. Sie stellt die Frage nach den notwendigen Kriterien für die Definition eines Herzogtums und eines Herzogs und zeigt anhand neuerer Forschung und Quellen, dass die Vorstellung eines solchen Herzogtums einer kritischen Überprüfung nicht standhält. Die Arbeit legt den Fokus auf die Entwicklung der Macht des Würzburger Bischofs und dessen Rolle innerhalb des fränkischen Raumes, die nicht mit der Existenz eines solchen Herzogtums gleichzusetzen ist. Die Definition des Herzogs als Inhaber provinzialer Herrschaftsgewalt unterhalb der Königsebene bildet den Ausgangspunkt für die spätere Analyse des Aufstiegs des Bischofs von Würzburg.
B) Der Weg zur fränkischen Herzogswürde: Dieses Kapitel gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die den Aufstieg des Würzburger Bistums von der Karolingerzeit bis ins Spätmittelalter chronologisch nachzeichnen. Es beginnt mit einer Betrachtung Frankens als Herrschaftsraum im frühen Mittelalter, wobei die Entstehung Frankens im Gegensatz zu anderen Stammesherzogtümern hervorgehoben wird. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Bistums Würzburg, das durch geschickte Politik und den Erwerb weltlicher Rechte immer mehr an Einfluss gewann. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Phasen der Entwicklung, beginnend mit den Karolingern über die Ottonen und Salier bis hin zu den Staufern und dem Investiturstreit, um zu zeigen, wie der Bischof von Würzburg schrittweise zu einer bedeutenden Machtposition aufstieg. Das Kapitel betont die Bedeutung von Faktoren wie der Babenberger Fehde und dem Investiturstreit für den Aufstieg des Bistums.
I) Franken als Herrschaftsraum im frühen Mittelalter: Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung Frankens als Ergebnis von Teilungsprozessen innerhalb des Karolingerreichs, im Gegensatz zur Entstehung von Stammesherzogtümern. Die Arbeit betont das Fehlen eines klar definierten Stammes der Franken und die heterogene Zusammensetzung der Bevölkerung. Die Gründung des Bistums Würzburg durch Bonifatius im Jahr 742 wird in diesem Kontext angesiedelt und als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Bistums dargestellt. Der Abschnitt stellt die unterschiedlichen Territorialentwicklungen Frankens im Vergleich zu anderen Herzogtümern dar, um die Besonderheiten des fränkischen Raums herauszuarbeiten und den Mythos einer frühen fränkischen Herzogswürde zu widerlegen.
II. Die Babenberger Fehde – Umschwung und Aufstieg des Bistums im Wechsel von den Karolingern zu den Ottonen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Zeit nach dem Ende der Karolingerherrschaft und den Aufstieg des Würzburger Bistums im Kontext der Babenberger Fehde. Die Quellenlage für die frühe Phase des Bistums wird als spärlich beschrieben. Der innere Ausbau des Bistums unter Bischof Arn und die Erweiterung des Gebiets durch Klosterschenkungen werden als wichtige Faktoren für den Aufstieg hervorgehoben. Die Beteiligung des Bistums an der Reichspolitik wird als ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Phase genannt. Der Abschnitt verdeutlicht die Bedeutung des Übergangs von den Karolingern zu den Ottonen für die Entwicklung des Bistums Würzburg und dessen zunehmende politische Bedeutung.
Schlüsselwörter
Herzogtum Franken, Bistum Würzburg, Investiturstreit, fränkische Herzogswürde, Territorialmacht, Reichspolitik, Ottonen, Salier, Staufer, Babenberger Fehde, mittelalterliche Quellen, Geschichtswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Weg zur fränkischen Herzogswürde: Aufstieg des Würzburger Bischofs im Kontext der Reichspolitik"
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Aufstieg des Würzburger Bischofs zu einer einflussreichen Territorialmacht im fränkischen Raum vom frühen Mittelalter bis ins Spätmittelalter. Sie widerlegt dabei den Mythos eines klar definierten Herzogtums Franken und konzentriert sich auf die Entwicklung der weltlichen Macht des Bistums Würzburg.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Zeitraum vom frühen Mittelalter bis ins Spätmittelalter, beginnend mit der Karolingerzeit und endend im Spätmittelalter. Sie betrachtet die Entwicklung über die Ottonen, Salier und Staufer hinweg.
Welche Schlüsselereignisse werden analysiert?
Wichtige Ereignisse, die analysiert werden, sind die Babenberger Fehde, der Investiturstreit und die damit verbundene Verleihung der dignitas iudiciaria, sowie der Einfluss des Erwerbs weltlicher Rechte durch das Bistum Würzburg auf dessen Machtposition.
Wie wird der "Mythos des Herzogtums Franken" behandelt?
Die Arbeit widerlegt die Vorstellung eines klar definierten Herzogtums Franken im Hochmittelalter. Sie hinterfragt die Kriterien für die Definition eines Herzogtums und eines Herzogs und zeigt anhand neuerer Forschung und Quellen, dass diese Vorstellung einer kritischen Überprüfung nicht standhält.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit neueren Forschungsergebnissen und zeitgenössischen Quellen. Die Quellenlage für die frühe Phase des Bistums wird als spärlich beschrieben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel A) Herzogtum Franken – ein falsch datierter Topos der älteren Geschichtswissenschaft und B) Der Weg zur fränkischen Herzogswürde. Kapitel B ist weiter unterteilt in Unterkapitel, die die Entwicklung chronologisch nachzeichnen (I-V).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der Macht des Würzburger Bischofs im fränkischen Raum zu untersuchen und den Mythos eines klar definierten Herzogtums Franken zu widerlegen. Sie beleuchtet den Aufstieg des Bistums Würzburg zu einer einflussreichen Territorialmacht und analysiert dessen Rolle innerhalb der Reichspolitik.
Welche Rolle spielt der Investiturstreit?
Der Investiturstreit spielt eine bedeutende Rolle, da er den Aufstieg des Würzburger Bischofs maßgeblich beeinflusst hat. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Investiturstreits für die Macht des Bischofs und die Verleihung der dignitas iudiciaria.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Weitere Themen sind die Entstehung Frankens als Herrschaftsraum im frühen Mittelalter, die Rolle des Würzburger Bischofs im Kontext der Reichspolitik, die Entwicklung der weltlichen Rechte des Würzburger Bischofs und die Bedeutung von Faktoren wie der Babenberger Fehde für den Aufstieg des Bistums.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Herzogtum Franken, Bistum Würzburg, Investiturstreit, fränkische Herzogswürde, Territorialmacht, Reichspolitik, Ottonen, Salier, Staufer, Babenberger Fehde, mittelalterliche Quellen und Geschichtswissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Cornelius Eder (Autor:in), 2016, Der Bischof von Würzburg als Herzog von Franken?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428938