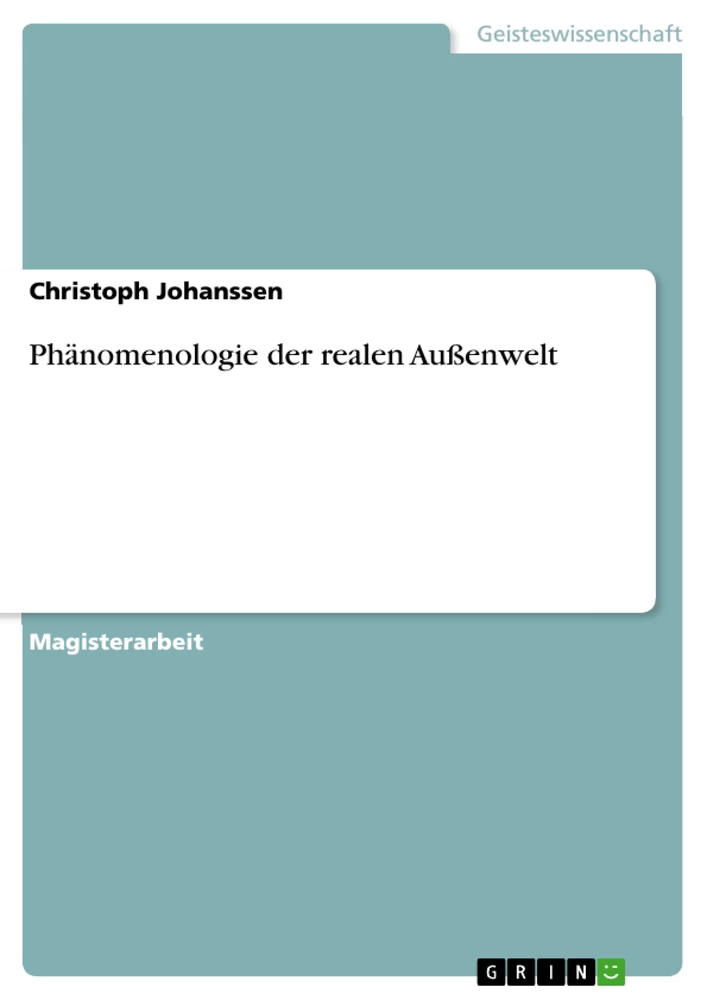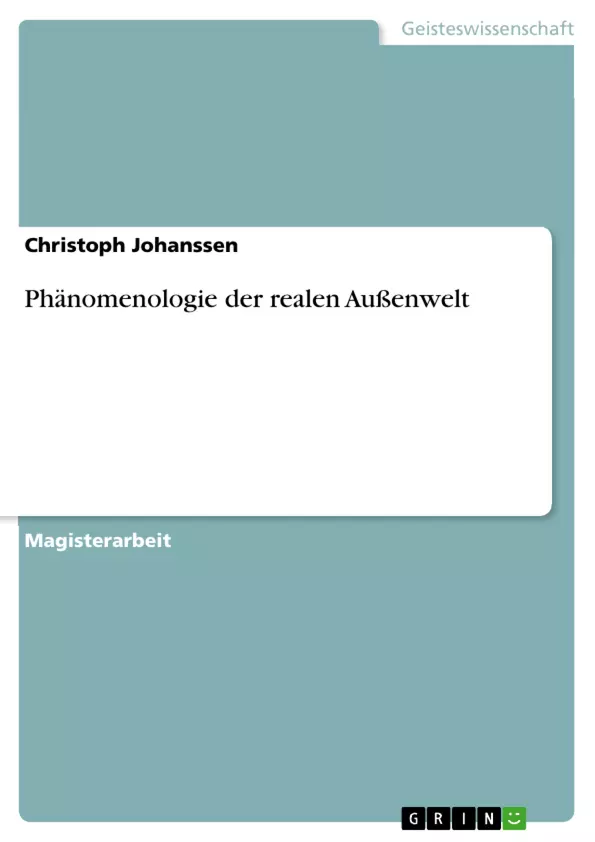Was unterscheidet einen echten Tisch von einem geträumten Tisch, was ein echtes Haus von einem halluzinierten, was einen echten Ball von einem vorgestellten? Diese Frage versucht diese Arbeit zu beantworten, und zwar ohne sich an etwas anderes zu halten als an das unmittelbar dem Bewusstsein zugängliche. Auf Bestimmungen wie die, das Reale sei unabhängig vom Subjekt, wird daher verzichtet.
Thema der vorliegenden Arbeit ist die Bestimmung des Realen, das heisst die Herausarbeitung dessen, was für das Realsein oder die Realität eines jeweiligen Gegenstandes konstitutiv ist. In Form einer Frage ließe sich das Problem folgendermaßen formulieren: Was macht einen realen Gegenstand zu einem solchen? Worin unterscheidet er sich von einem irrealen Gegenstand, also von einem bloß vorgestellten, phantasierten, eingebildeten, geträumten oder halluzinierten Gegenstand? Was meinen wir und auf welcher Grundlage urteilen wir, wenn wir behaupten, diesen oder jenen Gegenstand gebe es gar nicht wirklich?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Reale als das Bewusstseinsjenseitige und -unabhängige
- 1.1. Das Reale in der natürlichen Einstellung
- 1.2. Descartes
- 1.3. Kant
- 2. Versuche der erfahrungsmäßigen Aufweisung des Realen als des Bewusstseinsjenseitigen und unabhängigen
- 2.1. Das Reale als das durch Empfindungen Vermittelte
- 2.2. Das Reale als das Transzendente
- 2.2.1. Transzendenz und Realität bei Landmann
- 2.2.2. Transzendenz und Realität bei Husserl
- 2.2.3. Transzendenz und Bewusstseinsjenseitigkeit
- 2.3. Der Stand der Untersuchung
- 3. Die phänomenologische Methode und ihre Implikationen für das Problem des Realen
- 4. Das Reale als das sich im Verlauf der Wahrnehmung Bewährende
- 4.1. Die Wahrnehmungskonstanten
- 4.2. Die Erwartungen an den Wahrnehmungsverlauf hinsichtlich des einzelnen Gegenstandes
- 4.3. Die Erwartungen an den Wahrnehmungsverlauf hinsichtlich eines Gegenstandes im Zusammenhang mit anderen Gegenständen
- 5. Das Reale als das Widerständige
- 5.1. Schelers Fassung des Widerstands
- 5.2. Verdeckte Anschaulichkeit und sinnliche Gegebenheit bei Conrad-Martius
- 6. Das Reale als das verschiedenen Wahrnehmenden Zugängliche
- 6.1. Bewährung und Enttäuschung auf der Ebene intersubjektiver Erfahrung
- Schluss: Der Status der Bestimmungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, was das Realsein eines Gegenstandes konstituiert. Sie untersucht, was einen Gegenstand als real auszeichnet und wie er sich von einem irrealen, bloß vorgestellten oder phantasierten Gegenstand unterscheidet. Die Arbeit geht davon aus, dass es in der phänomenologischen Literatur zwar zahlreiche Auseinandersetzungen mit der Frage nach dem Realen gibt, die gewonnenen Bestimmungen jedoch oft unzureichend sind, um das Reale umfassend zu bestimmen.
- Die Bestimmung des Realen als das Bewusstseinsjenseitige und -unabhängige
- Die Rolle der Erfahrung und die Grenzen empirischer Aufweisung des Realen
- Die phänomenologische Methode und ihre Bedeutung für das Realitätsproblem
- Das Reale als das sich im Verlauf der Wahrnehmung Bewährende und das Widerständige
- Die Intersubjektivität der Wahrnehmung und die Zugänglichkeit des Realen für verschiedene Wahrnehmende
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach der Bestimmung des Realen. Sie diskutiert die verbreitete Vorstellung, dass Reale Gegenstände unabhängig von unserem Bewusstsein existieren und zeigt die Schwierigkeiten dieser Bestimmung auf.
Das erste Kapitel untersucht die Vorstellung vom Realen als dem Bewusstseinsjenseitigen und -unabhängigen. Es beleuchtet die Bedeutung dieser Bestimmung in der Geschichte der Philosophie und zeigt ihre problematischen Aspekte auf.
Das zweite Kapitel analysiert verschiedene Versuche, das Reale durch empirische Aufweisung zu bestimmen. Es untersucht die Rolle von Empfindungen und die Konzepte von Transzendenz und Bewusstseinsjenseitigkeit.
Das dritte Kapitel präsentiert die phänomenologische Methode und ihre Konsequenzen für das Realitätsproblem. Es zeigt, dass die Phänomenologie sich allein an das der Erfahrung Zugängliche hält und auf Aussagen über prinzipiell jenseits aller Erfahrung liegende Dinge verzichtet.
Das vierte Kapitel untersucht das Reale als das sich im Verlauf der Wahrnehmung Bewährende. Es analysiert die Rolle von Wahrnehmungskonstanten und die Erwartungen an den Wahrnehmungsverlauf.
Das fünfte Kapitel untersucht das Reale als das Widerständige. Es analysiert die Konzepte von Widerständigkeit bei Scheler und Conrad-Martius.
Das sechste Kapitel untersucht das Reale als das verschiedenen Wahrnehmenden Zugängliche. Es untersucht die Bedeutung von Bewährung und Enttäuschung auf der Ebene intersubjektiver Erfahrung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen der Philosophie wie Realismus, Idealismus, Phänomenologie, Wahrnehmung, Erfahrung, Bewusstsein, Transzendenz, Intersubjektivität, Widerständigkeit, und Bewährung.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet reale von eingebildeten Gegenständen?
Die Arbeit untersucht dies anhand von Kriterien wie der Bewährung im Wahrnehmungsverlauf, der Widerständigkeit und der intersubjektiven Zugänglichkeit.
Was bedeutet "Bewährung im Wahrnehmungsverlauf"?
Ein Gegenstand gilt als real, wenn sich die Erwartungen an seine Erscheinung bei fortlaufender Betrachtung (z.B. Umrunden eines Tisches) bestätigen.
Welche Rolle spielt die Widerständigkeit für die Realität?
Reale Gegenstände leisten einen "Widerstand" (nach Scheler), d.h. sie sind nicht beliebig durch das Bewusstsein veränderbar, im Gegensatz zu Phantasiegebilden.
Was ist Intersubjektivität in der Wahrnehmung?
Ein Kriterium für Realität ist, dass ein Gegenstand prinzipiell auch für andere Wahrnehmende zugänglich und erfahrbar ist.
Wie grenzt sich die Phänomenologie von Kant oder Descartes ab?
Die Phänomenologie hält sich allein an das unmittelbar dem Bewusstsein Zugängliche und verzichtet auf die Annahme einer vom Subjekt völlig unabhängigen "Ding-an-sich"-Welt.
Was sind Wahrnehmungskonstanten?
Es sind Merkmale eines Objekts (wie Form oder Farbe), die trotz wechselnder Perspektiven oder Beleuchtung als gleichbleibend wahrgenommen werden.
- Quote paper
- Christoph Johanssen (Author), 2004, Phänomenologie der realen Außenwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428969