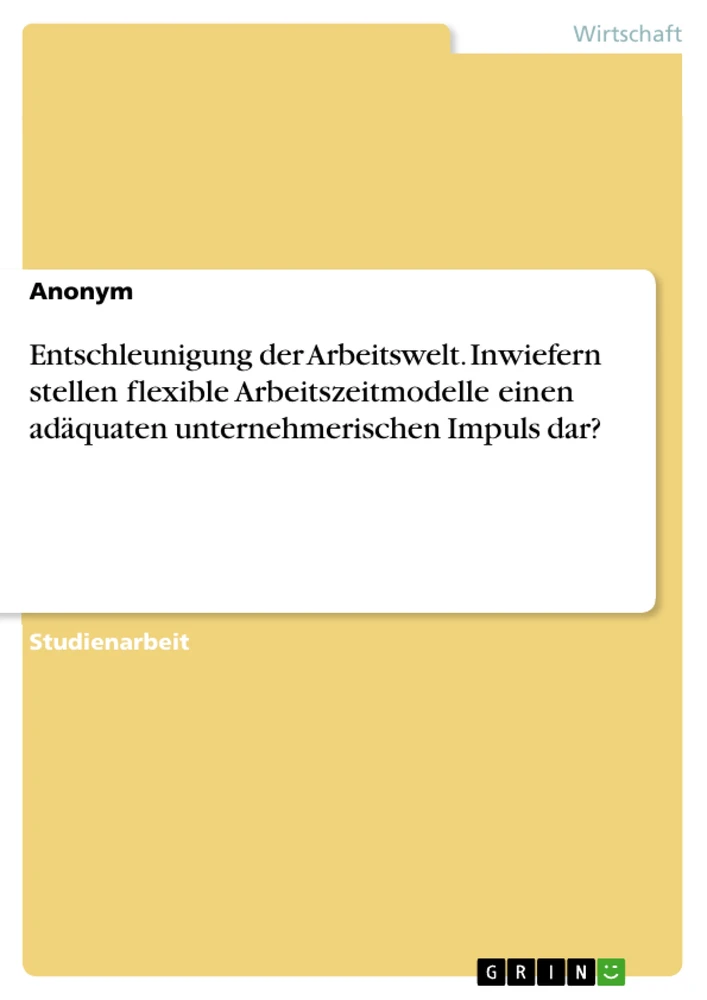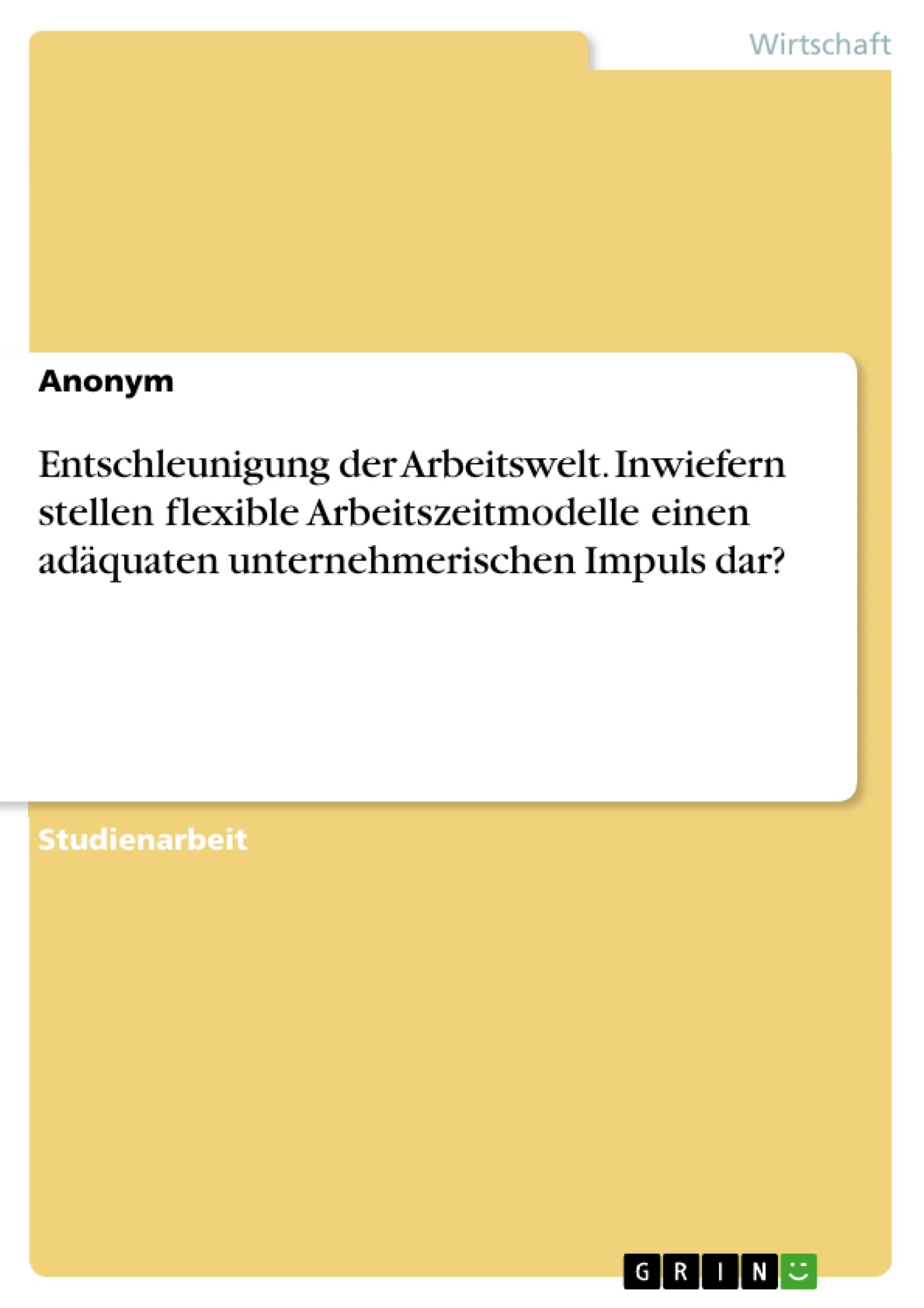Im wirtschaftlichen Kontext wird der Zeit seit jeher eine enorme Bedeutung zugemessen. Nahezu jeder Bereich des Wirtschaftslebens ist durch das Zeitdenken bestimmt, was allein daran erkennbar wird, dass der Arbeitslohn eines jeden Arbeitnehmers in irgendeiner Art und Weise an die aufgewendete Zeit gekoppelt ist. Die Arbeitswelt ist in hohem Maße zeitgesteuert und wird durch das kollektive Streben nach einem bestmöglichen Umgang mit eben dieser stetig beschleunigt.
Die Globalisierung und Technologisierung sind u.a. Gründe für eine steigende Dynamisierung des Wettbewerbs. Um in diesem mithalten zu können, konfrontieren viele Unternehmen ihre Mitarbeiter z.B. durch das Anordnen von Überstunden oder den vermehrten Einsatz von Kommunikationsmedien außerhalb der Arbeitszeit ebenfalls mit dem Phänomen der Beschleunigung. Das Risiko einer immer stärker werdenden Beschleunigung des Lebens nimmt vor diesem Hintergrund deutlich zu, da das ohnehin schon zunehmend beschleunigte Privatleben der Arbeitnehmer, infolge der Tempoverschärfung innerhalb der Arbeitswelt, keine ausreichenden Räume mehr zur Entschleunigung bietet.
Wie aber können Unternehmen einen Impuls geben, der dieser Entwicklung entgegenwirkt? Inwiefern können Mitarbeiter, welche die wohl wichtigste unternehmerische Ressource darstellen, langfristig vor der zunehmenden Beschleunigung bewahrt werden?
Diese Fragen sollen innerhalb der Arbeit beantwortet werden, wobei der spezifische Fokus auf flexible Arbeitszeitmodelle als möglicher Lösungsansatz gelegt wird. Flexible Arbeitszeitmodelle gelten in Abgrenzung zu klassischen Arbeitszeitmodellen, die durch feste Arbeitszeiten geprägt sind, allgemein als arbeitnehmerfreundlicher. Inwieweit diese Eigenschaft auch einen positiven Beitrag zur Entschleunigung des Lebens leistet, muss jedoch erst noch geprüft werden. Die Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, untersucht daher, inwieweit flexible Arbeitszeitmodelle einen adäquaten unternehmerischen Impuls darstellen, der den zunehmenden Beschleunigungstendenzen entgegenwirken kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschleunigung im Kontext der Arbeitswelt
- Der kulturelle Prozess der Beschleunigung
- Die beschleunigte Arbeitswelt
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Thematische Begriffsabgrenzung
- Analyse ausgewählter flexibler Arbeitszeitmodelle
- Job-Sharing
- Gleitzeit
- Telearbeit
- Vertrauensarbeitszeit
- Auswirkungen flexibler Arbeitszeitmodelle auf den Prozess der Beschleunigung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Entschleunigung in der Arbeitswelt und untersucht, inwieweit flexible Arbeitszeitmodelle einen adäquaten unternehmerischen Impuls zur Eindämmung der Beschleunigungstendenzen darstellen.
- Der kulturelle Prozess der Beschleunigung
- Die beschleunigte Arbeitswelt
- Flexible Arbeitszeitmodelle als möglicher Lösungsansatz
- Auswirkungen flexibler Arbeitszeitmodelle auf die Entschleunigung
- Potenziale und Grenzen flexibler Arbeitszeitmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Zeitfaktors im wirtschaftlichen Kontext und stellt die Forschungsfrage nach der Eignung flexibler Arbeitszeitmodelle als Impuls zur Entschleunigung. Kapitel 2 untersucht den kulturellen Prozess der Beschleunigung anhand des Beschleunigungszirkels von Hartmut Rosa und analysiert die Ursachen für die beschleunigte Arbeitswelt. Kapitel 3 definiert flexible Arbeitszeitmodelle und erläutert ausgewählte Modelle wie Job-Sharing, Gleitzeit, Telearbeit und Vertrauensarbeitszeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Beschleunigung, Entschleunigung, flexible Arbeitszeitmodelle, Job-Sharing, Gleitzeit, Telearbeit, Vertrauensarbeitszeit, Unternehmen, Arbeitswelt, kultureller Wandel, und den damit verbundenen Themen wie Zeitmanagement, Work-Life-Balance und Mitarbeitermotivation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Beschleunigung der Arbeitswelt?
Dies beschreibt den Prozess, bei dem durch Globalisierung und Technologie der Zeitdruck steigt, etwa durch ständige Erreichbarkeit oder die Verdichtung von Arbeitsabläufen.
Können flexible Arbeitszeitmodelle zur Entschleunigung beitragen?
Die Arbeit untersucht, ob Modelle wie Gleitzeit oder Telearbeit den Mitarbeitern helfen, Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren und so dem Stress entgegenzuwirken.
Was ist Vertrauensarbeitszeit?
Ein Modell, bei dem der Arbeitgeber auf die Zeiterfassung verzichtet und darauf vertraut, dass der Arbeitnehmer seine Aufgaben in Eigenregie erledigt.
Welche Rolle spielt Hartmut Rosa in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt Rosas Theorie des „Beschleunigungszirkels“, um die soziokulturellen Ursachen für den steigenden Zeitdruck in der modernen Gesellschaft zu erklären.
Was sind die Vorteile von Job-Sharing?
Beim Job-Sharing teilen sich zwei oder mehr Personen eine Vollzeitstelle, was zu mehr Flexibilität und einer Reduzierung der individuellen Arbeitslast führen kann.
Gibt es Grenzen bei der Entschleunigung durch flexible Arbeitszeiten?
Ja, die Arbeit diskutiert auch Risiken, wie etwa die Entgrenzung der Arbeit, bei der Mitarbeiter im Homeoffice dazu neigen, noch mehr und länger zu arbeiten.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Entschleunigung der Arbeitswelt. Inwiefern stellen flexible Arbeitszeitmodelle einen adäquaten unternehmerischen Impuls dar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429025