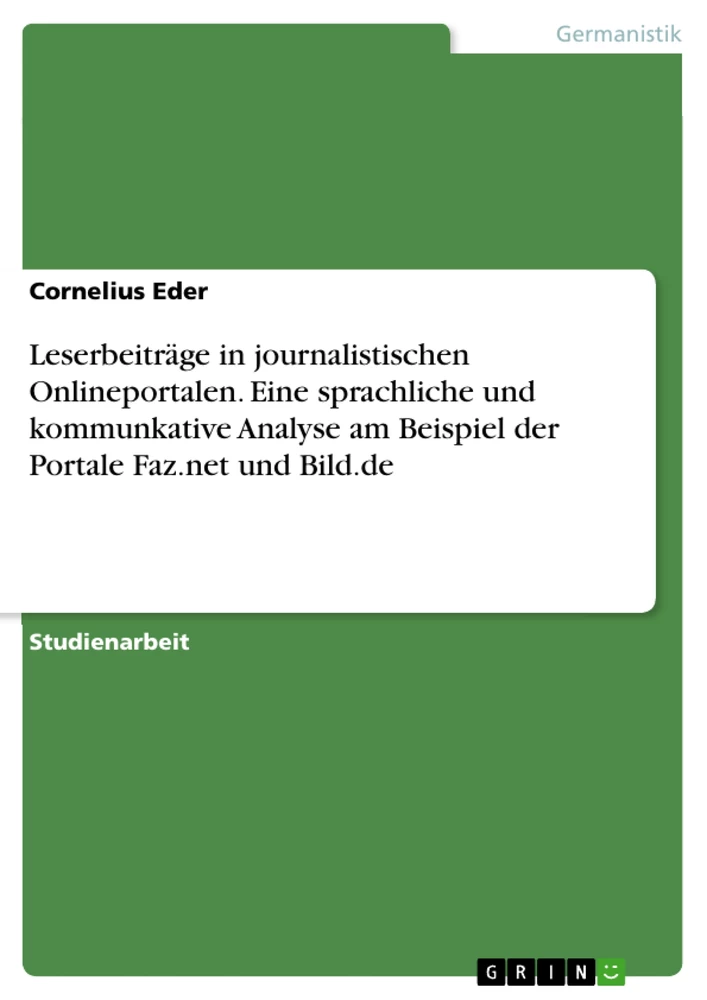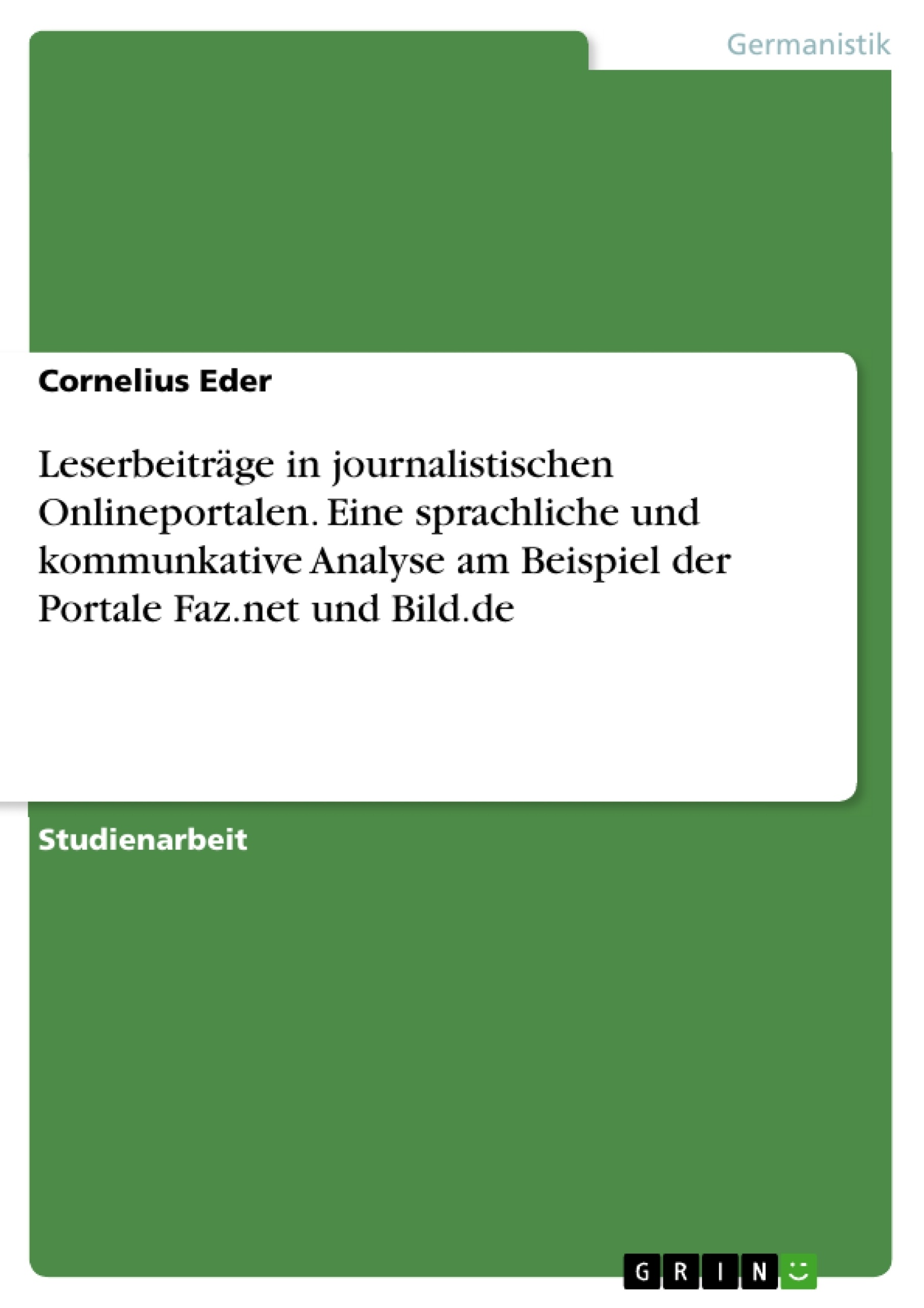Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen Korpus an Leserkommentaren – als ein bisher wenig erschlossenes Phänomen – sprachlich und kommunikativ zu untersuchen. Den Untersuchungsgegenstand boten Leserbeiträge des Bild.de und FAZ.net Portals, zweier Onlineauftritte der größten deutschen Tageszeitungen. Im Spannungsfeld zwischen Boulevard- und Qualitätsjournalismus soll gezeigt werden, inwiefern sich die Leserbeiträge dem Sprachniveau des jeweiligen Journalismusstils anpassen. Des weiteren werden die sprachlichen und kommunikativen Besonderheiten dieser Textgattung in einem diametralen Vergleich zwischen Bild.de und FAZ.net miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Journalismus 2.0 – Partizipative Berichterstattung
- B) Sprachliche Analyse von Leserkommentaren der Portale Bild.de und FAZ.net
- 1. Auswahl des Untersuchungsgegenstandes
- 2. Analyse der Kommunikationssituation
- 3. Sprachliche Analyse der Nutzerbeiträge
- 3.1 Argumentativer Aufbau
- 3.2 Stil und Syntax
- 3.3 Wortschatz und inhaltliche Korrektheit
- C) Conclusion
- D) Sekundärliteraturverzeichnis
- E) Abbildungsverzeichnis und Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht sprachliche und kommunikative Aspekte von Leserkommentaren auf den Online-Portalen Bild.de und FAZ.net. Im Fokus steht ein Vergleich der Kommentarbeiträge im Kontext des Boulevard- und Qualitätsjournalismus. Die Untersuchung analysiert, inwieweit sich die Sprache der Kommentare an das jeweilige Sprachniveau der Portale anpasst.
- Sprachlicher Vergleich von Leserkommentaren auf Bild.de und FAZ.net
- Analyse des argumentativen Aufbaus der Kommentare
- Untersuchung der Kommunikationssituation in Online-Kommentarbereichen
- Vergleich von "Top-down" und "Bottom-up" Konzepten im Online-Journalismus
- Der Einfluss des jeweiligen Journalismus-Stils auf die Leserkommentare
Zusammenfassung der Kapitel
A) Journalismus 2.0 – Partizipative Berichterstattung: Dieses Kapitel führt in das Thema Journalismus 2.0 und die damit verbundene Partizipation der Leser ein. Es beschreibt die Kommentarfunktion als ein wichtiges Element der Interaktivität in Online-Journalismusportalen und hebt die veränderte Rolle des Lesers von passivem Rezipienten zu aktivem Mitwirkenden hervor. Der zunehmende Einfluss der Lesermeinungen und die Abnahme der Distanz zwischen Leser und journalistischem Erzeugnis werden als wesentliche Aspekte dieser Entwicklung dargestellt. Der Fokus liegt auf der Kommentarfunktion als Möglichkeit zur unmittelbaren Meinungsäußerung und dem daraus resultierenden Wandel im Kommunikationsmodell.
B) Sprachliche Analyse von Leserkommentaren der Portale Bild.de und FAZ.net: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der sprachlichen Analyse von Leserkommentaren auf den Portalen Bild.de und FAZ.net. Die Auswahl der zu untersuchenden Kommentare erfolgte nach festgelegten Kriterien, wobei ein tagesaktueller Leitartikel zum Regierungsprogramm von Alexis Tsipras als Grundlage diente. Es wird die Kommunikationssituation in Online-Kommentarbereichen analysiert, wobei der Vergleich des "Broadcasting-Modells" mit der interaktiven Kommunikation im Internet im Vordergrund steht. Der Vergleich der Kommentarbeiträge beider Portale fokussiert auf den argumentativen Aufbau, Stil, Syntax und Wortschatz der Kommentare, um Unterschiede im Sprachniveau und der Kommunikationsweise aufzuzeigen. Die Analyse untersucht auch den Einfluss des jeweiligen Journalismus-Stils auf die Sprache der Kommentare.
Schlüsselwörter
Journalismus 2.0, Partizipative Berichterstattung, Leserkommentare, Online-Journalismus, Bild.de, FAZ.net, Sprachliche Analyse, Kommunikationsanalyse, Boulevardjournalismus, Qualitätsjournalismus, Top-down, Bottom-up, Argumentation, Stil, Syntax, Wortschatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Sprachliche Analyse von Leserkommentaren auf Bild.de und FAZ.net
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht sprachliche und kommunikative Aspekte von Leserkommentaren auf den Online-Portalen Bild.de und FAZ.net. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der Kommentare im Kontext von Boulevard- und Qualitätsjournalismus und analysiert, wie sich die Sprache der Kommentare an das jeweilige Sprachniveau der Portale anpasst.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Journalismus 2.0, partizipative Berichterstattung, die sprachliche Analyse von Leserkommentaren, den Vergleich von Boulevard- und Qualitätsjournalismus (Bild.de vs. FAZ.net), den argumentativen Aufbau von Kommentaren, die Kommunikationssituation in Online-Kommentarbereichen, "Top-down" und "Bottom-up" Konzepte im Online-Journalismus und den Einfluss des Journalismus-Stils auf Leserkommentare.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine sprachliche Analyse von Leserkommentaren zu einem tagesaktuellen Leitartikel (Regierungsprogramm von Alexis Tsipras). Die Analyse betrachtet den argumentativen Aufbau, den Stil, die Syntax und den Wortschatz der Kommentare, um Unterschiede im Sprachniveau und der Kommunikationsweise aufzuzeigen.
Welche Portale wurden untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Online-Portale Bild.de (Boulevardjournalismus) und FAZ.net (Qualitätsjournalismus).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung (Journalismus 2.0 und Partizipative Berichterstattung), die Hauptanalyse der Leserkommentare auf Bild.de und FAZ.net (inkl. methodischer Vorgehensweise), Schlussfolgerung, Literaturverzeichnis und Anhang.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Journalismus 2.0, Partizipative Berichterstattung, Leserkommentare, Online-Journalismus, Bild.de, FAZ.net, Sprachliche Analyse, Kommunikationsanalyse, Boulevardjournalismus, Qualitätsjournalismus, Top-down, Bottom-up, Argumentation, Stil, Syntax, Wortschatz.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, sprachliche und kommunikative Unterschiede in Leserkommentaren auf Boulevard- und Qualitätsjournalismus-Portalen aufzuzeigen und den Einfluss des jeweiligen Journalismus-Stils auf die Sprache der Kommentare zu analysieren.
Welche Aspekte der Kommunikationssituation werden analysiert?
Die Analyse betrachtet den Vergleich des "Broadcasting-Modells" mit der interaktiven Kommunikation im Internet im Kontext von Online-Kommentarbereichen.
- Quote paper
- Cornelius Eder (Author), 2014, Leserbeiträge in journalistischen Onlineportalen. Eine sprachliche und kommunkative Analyse am Beispiel der Portale Faz.net und Bild.de, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429166