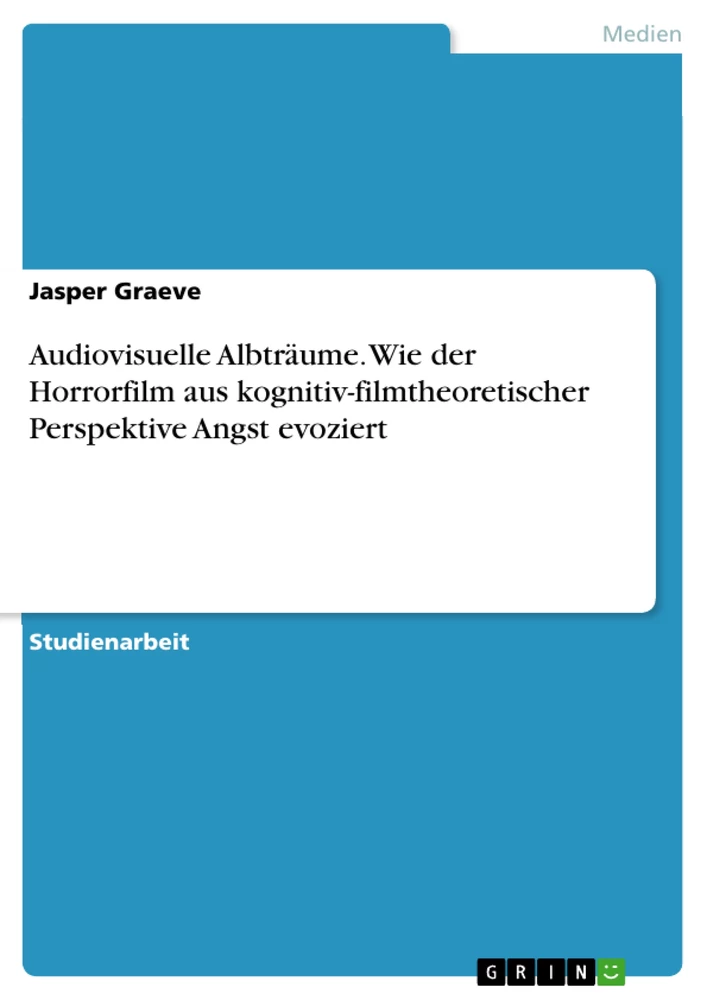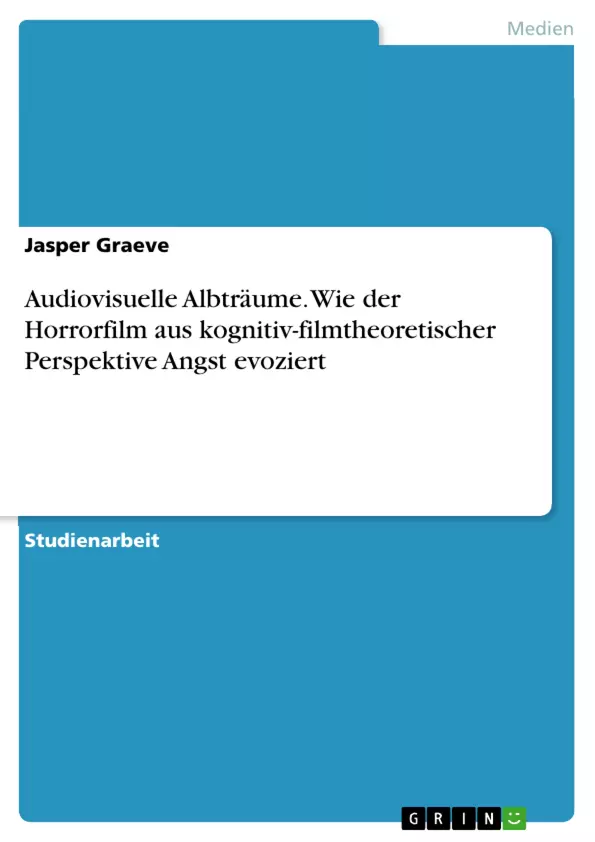In der Geschichte der Film- und Medienwissenschaft haben sich verschiedene Strömungen der Analyse und theoretischen Reflexion medial vermittelter Emotionen entwickelt, die sich teilweise gegenseitig eher ausschließen, anstatt sich zu ergänzen. Die kognitive Filmtheorie ist eine vergleichsweise junge Tradition in der Filmwissenschaft, die Erkenntnisse aus der Kognitionspsychologie (auch kognitive Psychologie genannt) zur Qualifizierung von theoretischen Ansätzen und empirischen Befunden heranzieht. Die Kognitionspsychologie setzt sich vor allem mit der menschlichen Wahrnehmung, der Reizverarbeitung und jeglichen Denkprozessen, also hauptsächlich psychischen Vorgängen, auseinander.
Innerhalb der kognitiven Filmtheorie wurden zwei Ansätze zur Analyse filmisch vermittelter Emotionen entwickelt, mithilfe derer die Affizierung des Zuschauers5 systematisiert und konkretisiert werden kann. Dabei handelt es sich zum einen um Ed Tans Psychologial Affect Structure of the Feature Film, einem Modell zur Erfassung der Herkunft und der Dynamiken von Emotionen während der Betrachtung eines narrativen Films, und Greg Smiths Mood-Cue Approach to Filmic Emotion, einem theoretischen Ansatz, welcher das Verhältnis von Stimmung und Emotion hervorhebt.
Im Folgenden sollen diese beiden Ansätze vorgestellt und erörtert werden, um auf ihnen aufbauend das Evozieren der Emotion »Angst« beim Betrachter eines Horrorfilms zu veranschaulichen. In diesem Zusammenhang soll auch das theoretische Problem, wie Zuschauer auf fiktive Handlungen mit realen Gefühlen regieren können, thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Filmisch vermittelte Emotionen in der kognitiven Filmtheorie
- 2.1. Ed S. Tans Psychologial Affect Structure of Feature Film
- 2.2. Greg M. Smiths Mood-Cue Approach to Filmic Emotion
- 3. Audiovisuell evozierte Angst
- 3.1. Horror als Genre
- 3.2. Fiktive Handlungen und reale Angst
- 3.3. Das Affekt-Management des Horrorfilms
- 4. Abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Horrorfilme Angst beim Zuschauer evozieren, und zwar aus kognitiv-filmtheoretischer Perspektive. Sie analysiert verschiedene Ansätze der kognitiven Filmtheorie zur Erklärung filmisch vermittelter Emotionen und wendet diese auf das Horrorgenre an.
- Kognitive Filmtheorie und die Analyse filmischer Emotionen
- Ed S. Tans Modell der "Psychological Affect Structure of Feature Film"
- Der Zusammenhang zwischen fiktiven Handlungen und realen Angstreaktionen
- Das Affekt-Management im Horrorfilm
- Angst als zentrale Emotion im Horrorgenre
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung definiert Angst und beschreibt Horrorfilme anhand der von ihnen evozierten Emotionen (Angst, Schrecken, Ekel). Sie führt in die kognitive Filmtheorie ein, die kognitionspsychologische Erkenntnisse zur Analyse filmisch vermittelter Emotionen nutzt. Die Arbeit kündigt die Vorstellung zweier Ansätze zur Analyse filmisch vermittelter Emotionen an: Ed Tans Modell und Greg Smiths Mood-Cue Approach. Schließlich wird das Problem thematisiert, wie Zuschauer auf fiktive Handlungen mit realen Gefühlen reagieren.
2. Filmisch vermittelte Emotionen in der kognitiven Filmtheorie: Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert zwei Ansätze zur Analyse filmisch vermittelter Emotionen innerhalb der kognitiven Filmtheorie. Es beginnt mit einer detaillierten Erläuterung von Ed S. Tans "Psychological Affect Structure of Feature Film," einem dreistufigen Modell (Narrational Textbase, Emotional Meaning Structure, Emotional Response). Tan’s Modell systematisiert die Entstehung und Dynamik von Emotionen während des Filmschauens, indem es die Interaktion zwischen wahrgenommener Handlung (Narrational Textbase), der vom Zuschauer erzeugten Bedeutung (Emotional Meaning Structure) und der resultierenden emotionalen Reaktion (Emotional Response) beschreibt. Das Modell unterscheidet zwischen phasischen (kurzzeitig) und tonischen (langanhaltenden) Emotionen und erläutert deren Wechselwirkung. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Modells und seiner Anwendungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Kognitive Filmtheorie, Horrorfilm, Angst, Emotion, Ed S. Tan, Psychological Affect Structure of Feature Film, Affekt-Management, Fiktion, Realität, phasische Emotionen, tonische Emotionen, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Arbeit einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht aus kognitiv-filmtheoretischer Perspektive, wie Horrorfilme Angst beim Zuschauer hervorrufen. Sie analysiert verschiedene Ansätze der kognitiven Filmtheorie zur Erklärung filmisch vermittelter Emotionen und wendet diese auf das Horrorgenre an.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Ansätze der kognitiven Filmtheorie: Ed S. Tans "Psychological Affect Structure of Feature Film" und Greg M. Smiths Mood-Cue Approach. Beide werden detailliert erläutert und auf das Phänomen der Angst im Horrorfilm angewendet.
Was ist Ed S. Tans "Psychological Affect Structure of Feature Film"?
Das ist ein dreistufiges Modell, das die Entstehung und Dynamik von Emotionen beim Filmschauen beschreibt. Es beinhaltet die Interaktion zwischen der wahrgenommenen Handlung (Narrational Textbase), der vom Zuschauer erzeugten Bedeutung (Emotional Meaning Structure) und der resultierenden emotionalen Reaktion (Emotional Response). Das Modell unterscheidet zwischen phasischen (kurzzeitig) und tonischen (langanhaltenden) Emotionen und deren Wechselwirkung.
Wie wird der Zusammenhang zwischen fiktiven Handlungen und realen Angstreaktionen behandelt?
Die Arbeit thematisiert die Frage, wie Zuschauer auf fiktive Handlungen in Horrorfilmen mit realen Gefühlen reagieren. Dies ist ein zentraler Aspekt der Analyse, da es darum geht, den Mechanismus zu verstehen, wie ein fiktiver Film reale emotionale Reaktionen auslösen kann.
Welche Rolle spielt das Affekt-Management im Horrorfilm?
Die Arbeit untersucht, wie Horrorfilme das Affekt-Management beim Zuschauer steuern. Es wird analysiert, wie die filmischen Mittel eingesetzt werden, um Angst zu erzeugen und zu kontrollieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einführung, einem Kapitel über filmisch vermittelte Emotionen in der kognitiven Filmtheorie (mit Unterkapiteln zu Tans Modell und Smiths Ansatz), einem Kapitel über audiovisuell evozierte Angst (mit Unterkapiteln zu Horror als Genre, fiktiven Handlungen und realen Angst, sowie dem Affekt-Management im Horrorfilm) und einer abschließenden Bemerkung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kognitive Filmtheorie, Horrorfilm, Angst, Emotion, Ed S. Tan, Psychological Affect Structure of Feature Film, Affekt-Management, Fiktion, Realität, phasische Emotionen, tonische Emotionen, Rezeption.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit will erklären, wie Horrorfilme Angst beim Zuschauer evozieren. Sie zielt darauf ab, verschiedene Ansätze der kognitiven Filmtheorie auf das Horrorgenre anzuwenden und so ein tieferes Verständnis für die Entstehung von filmisch induzierten Emotionen zu schaffen.
- Quote paper
- Jasper Graeve (Author), 2017, Audiovisuelle Albträume. Wie der Horrorfilm aus kognitiv-filmtheoretischer Perspektive Angst evoziert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429192