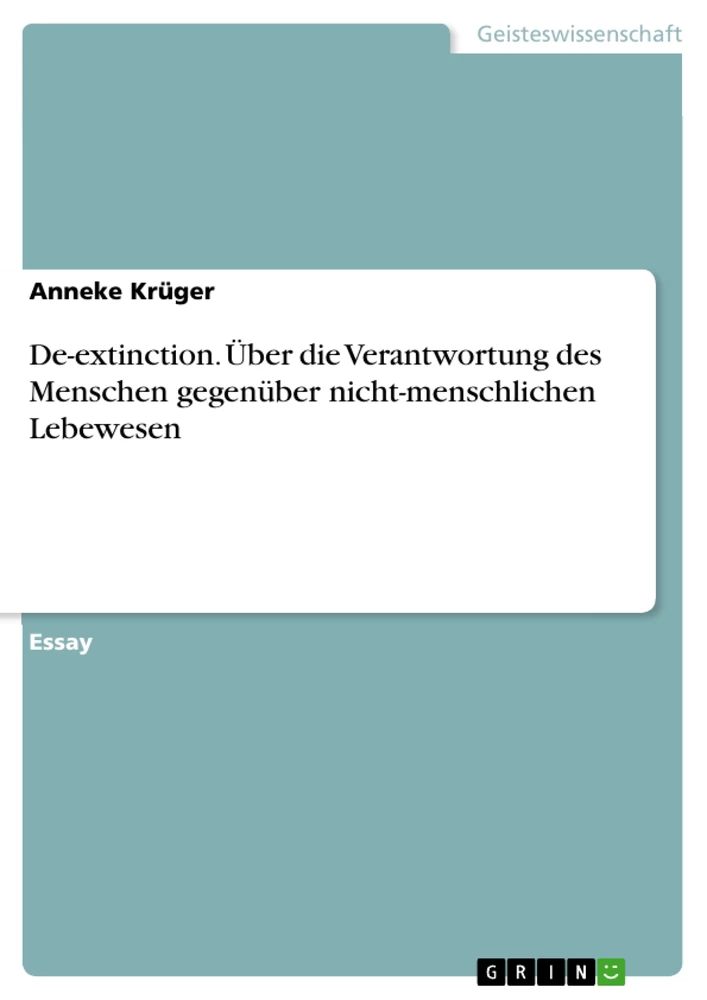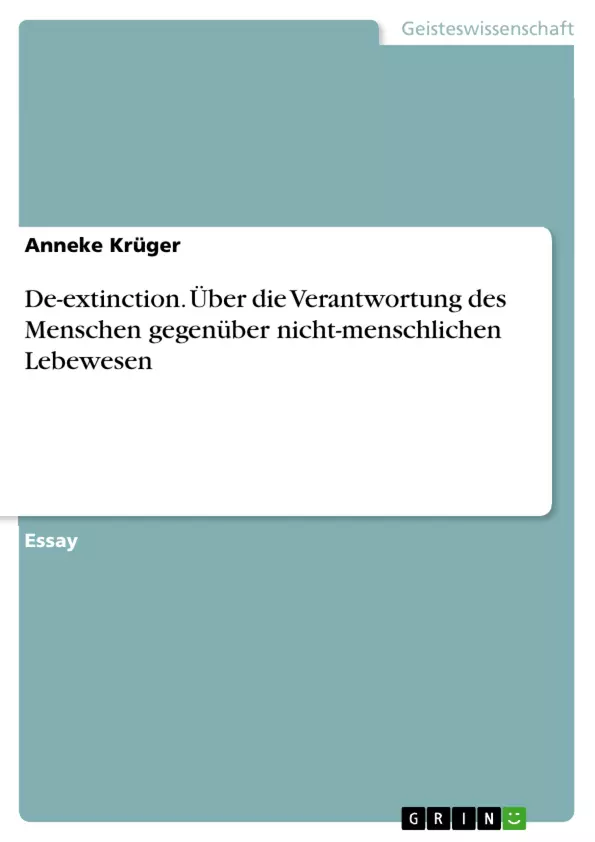Obwohl der Tasmanische Tiger seit gut 80 Jahren ausgestorben ist, genießt er – gerade auf Tasmanien – noch immer eine große Popularität. Der gestreifte Beutelwolf, der von den Siedlern der australischen Insel ausgerottet wurde, weil er der unliebsame Räuber ihre Schafe riss, ist heute zu einer wahren Legende geworden. Immer wieder behaupten Menschen in den vergangenen 80 Jahren, den kleinen Räuber gesichtet zu haben und liefern ominöse Fotos als Beweise. Es gab Versuche, das Tier zu klonen. Doch sie wurden im Jahr 2005 eingestellt, da das konservierte Genmaterial zu beschädigt war. Doch was, wenn das Klonen des Tasmanischen Tigers erfolgreich gewesen wäre und der Mensch tatsächlich ein ausgestorbenes Tier zurückgeholt hätte?
Die folgende Ausarbeitung soll sich damit beschäftigen, welche Folgen es hätte, wenn der Mensch ausgestorbene Tiere nicht nur erfolgreich klonen, sondern tatsächlich eine neue Population wiederbeleben könnte. Anhand des Aufzeigens möglicher Konsequenzen, soll ermittelt werden, ob, und wenn ja welche, Verantwortung der Mensch gegenüber nichtmenschlichen Tieren hat, die seinetwegen ausgerottet wurden und von dem Antlitz der Erde verschwunden sind. Dabei gliedert sich die Ausarbeitung in zwei Hauptteile; zum einen in eine Analyse und zum anderen in die Auswertung dieser. Die Analyse des Themas de-extinction erfolgt methodisch nach den Analysekriterien von Ronald L. Sandler. Die spätere Auswertung im Hinblick auf die Verantwortung orientiert sich nach der Verantwortungsethik von Hans Jonas.
Die Debatten über eine de-extinction reichen bis zur Diskussion über das Zurückholen des Mammuts und anderer Pleistozän-Tiere. Ebenso unterscheiden sich die Argumente je nach dem Schwerpunkt, ob es sich bei den zurückzuholenden nichtmenschlichen Tieren um welche handelt, die evolutionär ausgestorben oder vom Menschen ausgerottet worden sind. Da die Berücksichtigung aller Felder den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen würden, soll es sich explizit um direkt von Menschen ausgerottete Arten handeln. Zur Veranschaulichung sollen die Bedenken an dem populären Beispiel des Tasmanischen Tigers aufgezeigt werden. Sinn dieses Essays ist es, das Bewusstsein für die Verantwortung zu stärken, die der Mensch gegenüber seiner nichtmenschlichen Mitbewohner dieses Planeten hat. Außerdem soll als Einstieg für eine Aufklärung der „breiten Massen“ dienen und zu guter Letzt versteht sich dieser Text auch als ein Appell an die Wissenschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse
- Identifizierung der benefits
- Darlegung der extrinsischen Bedenken
- Machtanalyse
- Darlegung der intrinsischen Bedenken
- Auswertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit den Folgen der Wiederbelebung ausgestorbener Tierarten, insbesondere im Hinblick auf die Verantwortung des Menschen gegenüber diesen. Der Fokus liegt dabei auf dem Tasmanischen Tiger als Beispiel für eine vom Menschen ausgerottete Art, und die Ausarbeitung analysiert die möglichen Konsequenzen einer erfolgreichen "De-Extinction".
- Mögliche Vorteile und Nachteile der De-Extinction
- Ethische Bedenken hinsichtlich der Eingriffe in die Natur
- Die Rolle des Menschen als Verursacher und Verantwortlicher für das Aussterben von Arten
- Die Frage nach der Verantwortung des Menschen gegenüber nichtmenschlichen Tieren
- Die Notwendigkeit, die Biodiversität zu schützen und zu erhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der De-Extinction am Beispiel des Tasmanischen Tigers vor und erläutert die Motivation und die Gliederung der Ausarbeitung. Es wird die Frage nach der Verantwortung des Menschen gegenüber ausgerotteten Tieren aufgeworfen.
Analyse
Die Analyse des Themas De-Extinction erfolgt anhand der Analysekriterien von Ronald L. Sandler und beleuchtet die potentiellen Vorteile der De-Extinction, die extrinsischen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf das Ökosystem, die Machtanalyse und die intrinsischen Bedenken im Hinblick auf die ethische Vertretbarkeit.
Identifizierung der benefits
Dieser Abschnitt diskutiert die potentiellen Vorteile der De-Extinction, wie die Steigerung der Biodiversität und die Gewinnung neuer Forschungserkenntnisse. Es wird jedoch argumentiert, dass diese Vorteile relativiert werden müssen, da es sich bei der Wiederbelebung ausgestorbener Arten um eine Form der Gewissenberuhigung handelt.
Darlegung der extrinsischen Bedenken
Dieser Abschnitt untersucht die extrinsischen Bedenken, die mit der De-Extinction verbunden sind. Es wird argumentiert, dass die Wiedereinführung eines ausgestorbenen Tieres in ein Ökosystem, das sich über einen langen Zeitraum ohne diese Art entwickelt hat, unvorhersehbare Folgen haben kann. Darüber hinaus wird die Frage nach der genetischen Modifikation im Rahmen der De-Extinction aufgeworfen, da das erhaltene Genmaterial oft nicht ausreichend ist, um eine artgerechte Wiederbelebung zu ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "De-extinction"?
De-extinction bezeichnet die Wiederbelebung ausgestorbener Tierarten durch Methoden wie Klonen oder Gentechnik.
Warum wird der Tasmanische Tiger als Beispiel genutzt?
Er wurde direkt durch den Menschen ausgerottet und ist heute eine Legende. Er dient als Modellfall, um die ethische Verantwortung des Menschen für sein Handeln zu diskutieren.
Welche ethischen Bedenken gibt es gegen das Zurückholen von Arten?
Kritiker warnen vor unvorhersehbaren Folgen für heutige Ökosysteme und hinterfragen, ob es ethisch vertretbar ist, Tiere in eine Welt zurückzuholen, die nicht mehr ihrem ursprünglichen Lebensraum entspricht.
Was besagt die Verantwortungsethik von Hans Jonas hierzu?
Jonas fordert einen verantwortungsvollen Umgang mit der technologischen Macht des Menschen, wobei das langfristige Überleben der Natur und künftiger Generationen Vorrang vor kurzfristigen Erfolgen haben muss.
Ist Klonen bei ausgestorbenen Tieren heute schon möglich?
Bisherige Versuche scheiterten oft an beschädigtem Genmaterial. Die Arbeit diskutiert die technischen Hürden und die problematische Notwendigkeit genetischer Modifikation.
- Arbeit zitieren
- Anneke Krüger (Autor:in), 2017, De-extinction. Über die Verantwortung des Menschen gegenüber nicht-menschlichen Lebewesen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429226