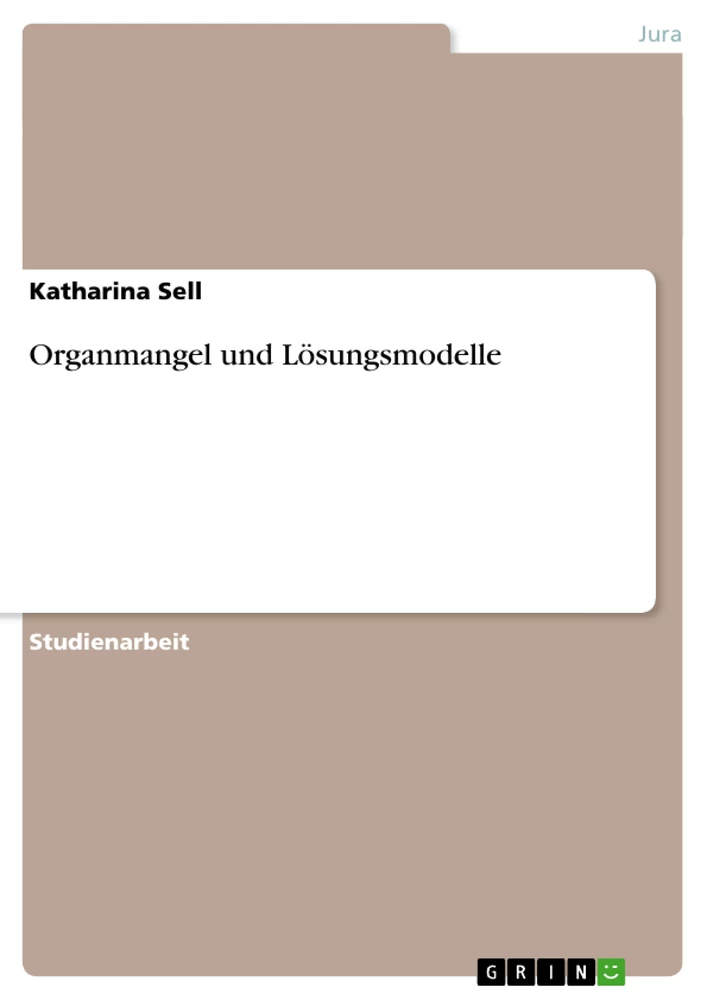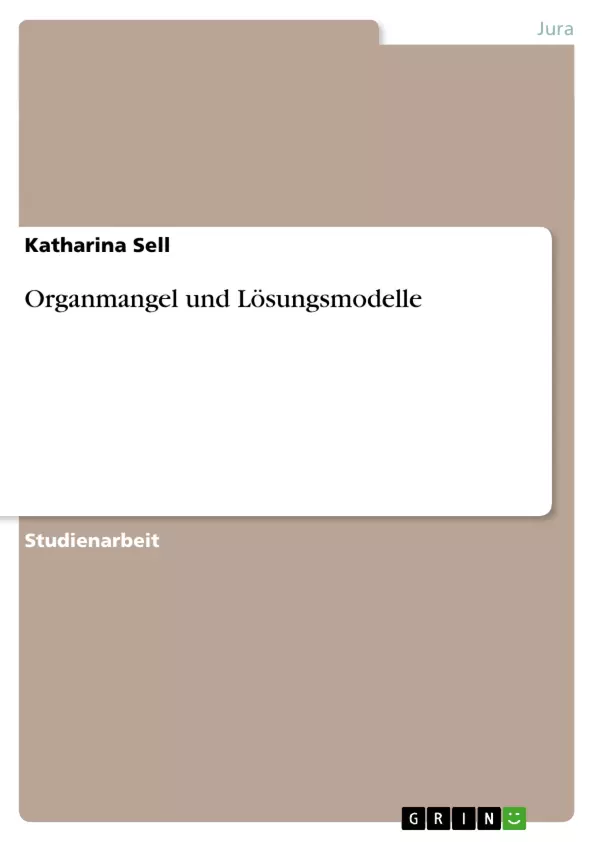Seit am 23. Dezember 1954 J. Murray und J. Merick in Boston die erste klinisch erfolgreiche Nierentransplantation durchführten , entwickelte sich die Organtransplantation zu einem heute allgemein anerkannten medizinischen Behandlungsverfahren.
Doch mit den immer besser werdenden Möglichkeiten, eine Transplantation erfolgreich durchzuführen, stieg auch die Nachfrage an Spenderorganen.
Das Organtransplantationswesen ist ganz stark von der Akzeptanz und der Spendebereitschaft der Bevölkerung abhängig, d.h., nur wenn Menschen bereit sind, nach ihrem Tod ihre Organe zu spenden, können diese auch transplantiert werden.
Die Organspendequote lag 2003 im Bundesdurchschnitt jedoch bei 13,8 pro Million Einwohner .
Laut einer Untersuchung der Universität Köln besitzen nur etwa 7% der Bundesbürger einen Organspendeausweis, obwohl im Falle des Todes mehr als drei Viertel zur Organentnahme bereit wären. Gründe für die hohe Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage liegen unter anderem darin, dass 62 Prozent der Bevölkerung den Hirntod als „richtigen“ Tod nicht akzeptieren . Die Angst ist einfach noch sehr groß, dass nicht alles Menschenmögliche für den Patienten getan wird, wenn dieser Organspender ist.
Dieses Problem könnte mit umfangreicheren Aufklärungsmaßnahmen möglicherweise einfach geregelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einführung
- Das Deutsche Transplantationsrecht - TPG
- Lösungsmodelle ?
- Lebendspende
- Cross-over-Spende
- Cross-over in Deutschland
- Zukunft für Cross-over
- Anonyme altruistische Lebendspende
- Transplantation von suboptimale Organen
- Am Beispiel Leber
- suboptimale Organe – als Lösung ?
- Postmortale Organspende
- Widerspruchslösung
- Organhandel
- Bezahlung, Vergütung oder Aufwandsentschädigung
- Übernahme der Bestattungskosten
- Gesetzgeberische Motive
- Körperspende und Organspende im Vergleich
- Alternativen
- Fazit
- Die rechtliche Grundlage des Organtransplantationswesens in Deutschland
- Die Herausforderungen der Organspende in der Praxis
- Mögliche Lösungsansätze für den Organmangel
- Ethische und moralische Aspekte der Organspende
- Die Rolle der Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorwort: Die Arbeit beleuchtet das Problem des Organmangels und mögliche Lösungen, wobei der Fokus auf bereits existierenden Modellen und ihrer Umsetzbarkeit liegt.
- Einführung: Die Entwicklung der Organtransplantation als medizinisches Verfahren wird dargestellt, wobei der zunehmende Bedarf an Spenderorganen hervorgehoben wird. Die Bedeutung der öffentlichen Akzeptanz und Spendebereitschaft wird betont.
- Das Deutsche Transplantationsrecht - TPG: Das Transplantationsgesetz wird vorgestellt, welches die rechtliche Grundlage für die Organtransplantation in Deutschland bildet. Die erweiterte Zustimmungslösung und die Rolle des Hirntods im Transplantationsrecht werden erläutert.
- Lösungsmodelle: Verschiedene Ansätze zur Bewältigung des Organmangels werden diskutiert, darunter Lebendspende (Cross-over, anonyme altruistische Spende, Transplantation von suboptimalen Organen) und postmortale Organspende (Widerspruchslösung, Bezahlung/Vergütung/Entschädigung, Körperspende vs. Organspende).
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem des Organmangels und möglichen Lösungsansätzen. Ziel ist es, vorhandene Modelle auf ihre Durchsetzbarkeit zu untersuchen und Diskussionen über den ethischen, moralischen und rechtlichen Umgang mit dem Organmangel anzustoßen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Organmangel, Transplantationsrecht, Organspende, Lebendspende, postmortale Organspende, Hirntod, Widerspruchslösung, ethische Aspekte, moralische Aspekte, rechtliche Aspekte, Aufklärung, Spendebereitschaft, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist die aktuelle Organspendequote in Deutschland?
Im Jahr 2003 lag sie bei etwa 13,8 pro Million Einwohner, wobei nur ca. 7% der Bürger einen Organspendeausweis besitzen.
Was ist die rechtliche Basis für Organspenden in Deutschland?
Die Grundlage bildet das Transplantationsgesetz (TPG), das die erweiterte Zustimmungslösung vorsieht.
Was versteht man unter der „Widerspruchslösung“?
Bei der Widerspruchslösung gilt jeder als potenzieller Spender, sofern er zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat.
Was ist eine Cross-over-Spende?
Es handelt sich um eine Form der Lebendspende, bei der Paare, die untereinander nicht kompatibel sind, über Kreuz an den jeweils anderen Partner spenden.
Warum wird der Hirntod oft kritisch gesehen?
Laut Studien akzeptieren etwa 62% der Bevölkerung den Hirntod nicht als „richtigen“ Tod, was die Spendebereitschaft negativ beeinflusst.
- Citar trabajo
- Katharina Sell (Autor), 2005, Organmangel und Lösungsmodelle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42927