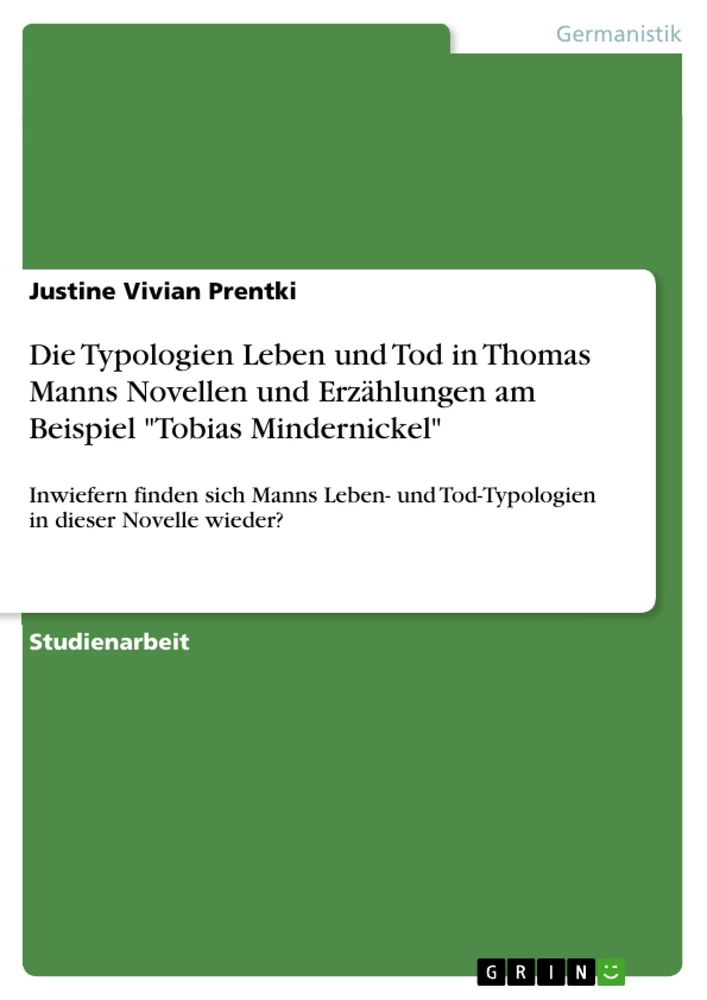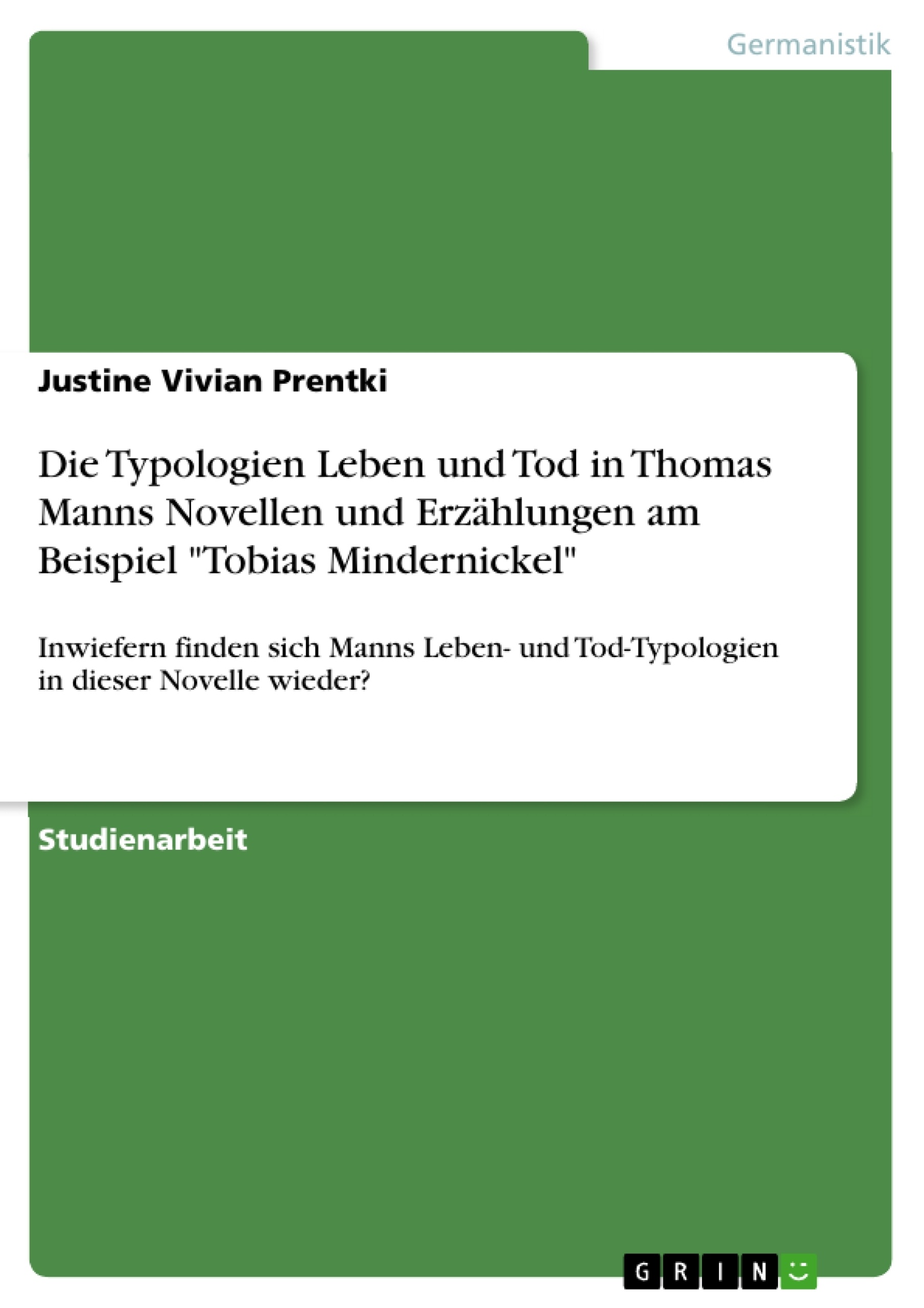Manns Werk „Tobias Mindernickel“ ist eins von vielen seiner Werke, die tragisch enden. Sein Motiv des Todes verursacht durch des Lebens Leid scheint in seinen Werken typisch zu sein. Allerdings stellt sich hier die Frage, inwieweit sein typisches Motiv des Todes und auch des Lebens in seiner Novelle „Tobias Mindernickel“ verwendet wird, da es hier nicht der Protagonist ist, der stirbt, sondern sein Hund durch die Art des Protagonisten. Daher befasst sich diese Arbeit mit der Frage „Inwiefern finden sich Manns Leben- und Tod-Typologien in seiner Novelle „Tobias Mindernickel“ wieder?“. Um Erkenntnisse aus dieser Arbeit zu erzielen, wird sich diese zuerst mit den beiden genannten Typologien näher befassen. So wird es also darum gehen, das Leben sowie den Tod in seinen Werken näher zu beleuchten, um so eine Basis für den weiteren Verlauf dieser Arbeit zu schaffen. Danach befasst sich diese Arbeit direkter mit der oben genannten Novelle. Hier werden zuerst die Figuren Tobias Mindernickel und sein Jagdhund Esau dargestellt sowie dessen Beziehung zueinander. Anschließend wird sich der Bildhaftigkeit in seinem Werk gewidmet, worauf ein Vergleich zwischen Tobias Mindernickel und Johannes Friedemann folgt, da sich sowohl die physischen als auch psychischen Verfassung beiden Protagonisten vergleichen lässt und auch hier der Tod eine bedeutende Rolle spielt, was darauffolgend in dem Kapitel „Das Todesmotiv verursacht durch des Lebens Leid“ analysiert wird. Schlussendlich folgen das Fazit und die Erkenntnisse, die aus dieser Arbeit geschlossen werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Erkenntnisinteresse
- 1. Die Typologien Leben und Tod in Manns Novellen und Erzählungen
- 1.1 Das Leben in seinen Werken
- 1.2 Der Tod in seinen Werken
- 2. „Tobias Mindernickel“
- 2.1 Figurenensemble
- 2.1.1 Tobias Mindernickel
- 2.1.2 Der Jagdhund „Esau“
- 2.2 Die Bildhaftigkeit in seinem Werk
- 2.3 „Tobias Mindernickel“ und „Johannes Friedemann“ - ein Vergleich
- 2.3.1 Physische Verfassung beider Protagonisten
- 2.3.2 Psychische Verfassung beider Protagonisten
- 2.4 Das Todesmotiv verursacht durch des Lebens Leid
- Fazit und Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Präsenz von Lebens- und Tod-Typologien in Thomas Manns Novelle „Tobias Mindernickel“. Insbesondere geht es darum, inwiefern das in Manns Werken typische Motiv des Todes, verursacht durch das Leid des Lebens, in dieser Novelle Anwendung findet. Durch die Analyse von Manns Werk „Tobias Mindernickel“ werden Erkenntnisse gewonnen über die Verwendung dieser Typologien im Kontext dieser Novelle. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der Figuren und deren Beziehung zueinander, die Bildhaftigkeit des Werkes und die vergleichende Betrachtung der physischen und psychischen Verfassung der Protagonisten. Im Vordergrund steht die Analyse, wie das Todesmotiv in der Novelle durch die Lebensumstände der Figuren geprägt wird.
- Die Typologien Leben und Tod in Manns Novellen und Erzählungen
- Die Darstellung der Figuren Tobias Mindernickel und seines Jagdhundes Esau
- Die Bildhaftigkeit in der Novelle „Tobias Mindernickel“
- Der Vergleich der physischen und psychischen Verfassung von Tobias Mindernickel und Johannes Friedemann
- Die Analyse des Todesmotivs in der Novelle im Kontext des Lebensleids
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Erkenntnisinteresse der Arbeit vor und skizziert die Typologien Leben und Tod in Manns Werken. Kapitel 1 beleuchtet diese Typologien im Detail, indem es das Leben und den Tod in seinen Werken untersucht. Kapitel 2 konzentriert sich auf die Novelle „Tobias Mindernickel“ und stellt die Figuren des Protagonisten und seines Hundes vor. Es wird die Bildhaftigkeit des Werkes analysiert und ein Vergleich zwischen Tobias Mindernickel und Johannes Friedemann durchgeführt. Abschließend wird das Todesmotiv im Kontext des Lebensleids analysiert. Das Fazit zieht die Erkenntnisse zusammen, die aus der Arbeit gewonnen wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Typologien Leben und Tod in Thomas Manns Novellen und Erzählungen, insbesondere in der Novelle „Tobias Mindernickel“. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Leben, Tod, Typologie, Novelle, Protagonist, Figur, Bildhaftigkeit, Vergleich, Todesmotiv, Lebensleid.
- Quote paper
- Justine Vivian Prentki (Author), 2017, Die Typologien Leben und Tod in Thomas Manns Novellen und Erzählungen am Beispiel "Tobias Mindernickel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429292