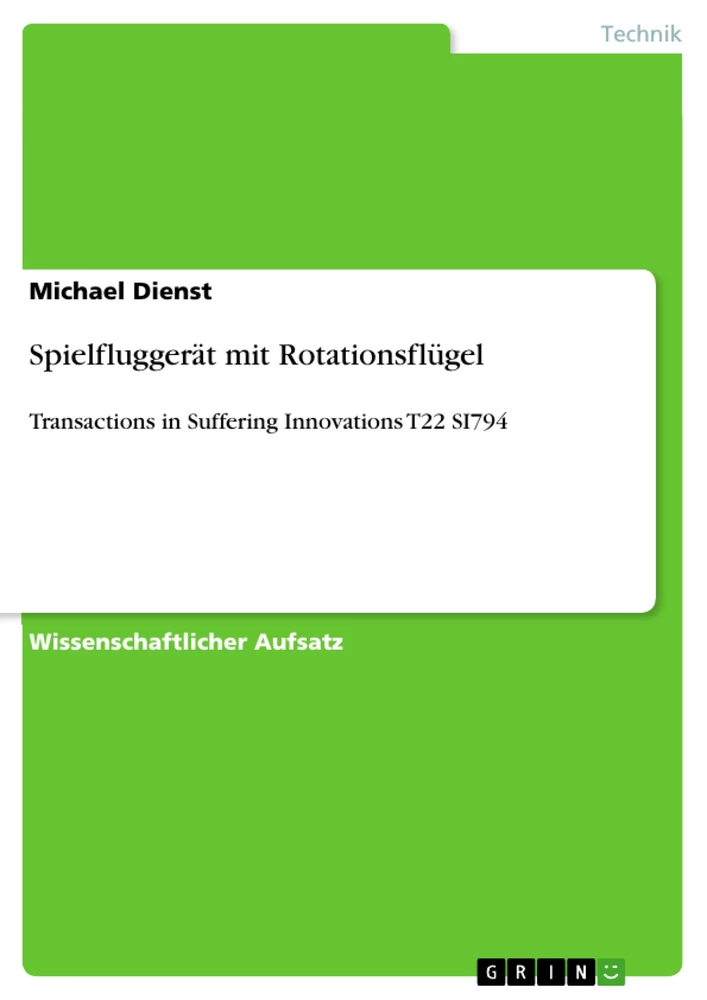Die Erfindung betrifft ein Spielfluggerät mit Rotationsflügel. Der Rotationsflügel ist zweiarmig und seine Arbeitstragflächen sind in einer so genannten „Box-Wing-Konfiguration“ ausgeführt. Im Betrieb und durch geeignete Anströmung gerät der Rotationsflügel zwangsläufig in Eigenrotation (Autogyroprinzip) und produziert eine Auftriebskraft, die senkrecht auf der Rotationsebene steht. Das Spielfluggerät mit Rotationsflügel (Boxwing-Repeller) entspricht in seiner Betriebsweise einem Flugdrachen (im engl. „Kite“) vom Stand der Technik und wird mit Steuerleinen vom Boden aus gelenkt.
„Transactions in suffering Innovations"
Ideen verbrennen im Park
Der Wedding ist heute wunderschön und ich fühl' mich seltsam stark.
Was hält mich da noch im Labor?
Wir gehen zum Led Zeppelin, der gefällt mir mehr als je zuvor, bei ungefähr tausend Kelvin.
Komm, lass uns Patente verbrennen im Park.
Mi. Berlin 2016
Den Ausführungen sei ein Traktat vorangestellt. Die Textbeiträge zum Stand der Technik und den „Transactions in Suffering Innovations" besitzen ein dynamisches Format und sind, beginnend im November 2016, in folgender Weise geordnet und Überschrieben:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Traktat
über die Beiträge zum Stand der Technik und zu den „Transactions in Suffering Innovations"
Die „Transactions in Suffering Innovations" bilden eine Sammlung von Schriften über Artefakte im Themenfeld Biologie & Technik, die in loser Reihenfolge erscheint. Es besteht durchaus die Absicht, den Stand der Technik zu verändern.
Gegenstand der Beiträge zu den Schriften der „Transactions in Suffering Innovations" sind Artefakte, Problemlösungen, Gestaltungsfragen und die kritische Auseinandersetzung mit Themen der Bionik, also Technik nach Vorbildern aus der belebten und unbelebten Natur und ihre Umsetzung. In ausgesuchten Fällen sind Technische Beschreibungen nach Standards des Deutschen Patent und Markenrechts1 verfasst.
Mit den „Transactions in Suffering Innovations" soll der Fortschritt auf dem Gebiet der angewandten Bionik dadurch gefördert werden, dass die dargestellten notleidenden Artefakte, Problem- und Gestaltungslösungen frei von Rechten Dritter sind und mit ausdrücklicher Genehmigung dem Leser zur Nutzung verfügbar werden.
In den „Transactions in Suffering Innovations" werden ausschließlich Artefakte offeriert, die nicht unter das Arbeitnehmererfindungsgesetzes ArbErfG2 fallen oder in der Vergangenheit fielen.
Die in den „Transactions in Suffering Innovations" dargestellten Artefakte sind insofern notleidend, da sie einerseits aus materieller Not nicht weiterverfolgt werden, ein Umstand der sich vielleicht wieder ändern mag. Andererseits sind die dargestellten Artefakte notleidend, weil sie möglichweise auftretender oder voranschreitenden geistigen Umnachtung zum Opfer zu fallen drohen; ein Umstand der sich wohl nicht mehr ändern wird.
Als Übergeordneter Absicht gilt es solche Forschung anzustoßen, die Lösungswege der Übertragung biologischer Phänomene untersucht und Fragestellungen betrifft, die im Zusammenhang stehen mit Natur und Technik.
Die Beiträge zum Stand der Technik und den „Transactions in Suffering Innovations" sind in deutscher Sprache verfasst. Dem Text wird gegebenenfalls eine teilweise oder vollständige Übersetzung in englischer Sprache beigestellt. In einer Ausgabe der Schriftensammlung wird jeweils nur ein Werk platziert. Den Ausführungen wird gegebenenfalls ein Prolog vor und ein Epilog nachgestellt.
Mi. Dienst
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Technische Beschreibung
Spielfluggerät mit Rotationsflügel
Die Erfindung betrifft ein Spielfluggerät mit Rotationsflügel. Der Rotationsflügel ist zweiarmig und seine Arbeitstragflächen sind in einer so genannten „Box-Wing- Konfiguration" ausgeführt. Im Betrieb und durch geeignete Anströmung gerät der Rotationsflügel zwangsläufig in Eigenrotation (Autogyroprinzip) und produziert eine Auftriebskraft, die senkrecht auf der Rotationsebene steht. Das Spielfluggerät mit Rotationsflügel (Boxwing-Repeller) entspricht in seiner Betriebsweise einem Flugdrachen (im engl. „Kite") vom Stand der Technik und wird mit Steuerleinen vom Boden aus gelenkt.
Das Spielfluggerät mit Rotationsflügel ist fluiddynamisch prinzipiell als Arbeitsflugdrachen betreibbar und die vom Spielfluggerät erzeugte (Auftrierbs-) Querkraft kann ebenso prinzipiell zum Zwecke der Fortbewegung des genutzt werden. Generell ist das Spielfluggerät mit Rotationsflügel geeignet, im Zusammenwirken mit einer elektronischen Steuerung vom Stand der Technik, autonom in der bodennahen Luftschicht zu agieren und die dort beispielsweise über der Wasseroberfläche herrschenden Scherwinde, zur Querkraft-erzeugung zu nutzen. Die Steuerung von Spielfluggerät mit Rotationsflügel ist nicht Gegenstand der Erfindung.
Stand der Technik. Box-Wing
Von einem Tragflügel in Box-Wing-Konfiguration (englisch: box wing oder box-wing bzw. joint wing) spricht man, wenn die Randbögen zweier Tragflügel in zwei benachbarten Tragflächenebenen, (vertikal) miteinander verbunden sind. Als Flugsystem ergibt sich ein stabiles Flugverhalten und ein vorteilhaftes Auftriebsgebaren bei hoher Kompaktheit. Die Konstruktion ist sehr robust. Rotationssysteme in Box-Wing-Konfiguration (Boxprop, joined-blad propeller) für Arbeitsmaschinen (Propeller) sind meist „schlaufenförmiger" Gestalt und Stand der Technik.
Stand der Technik. Autogyro-Prinzip.
Das Spielfluggerät mit Rotationsflügel nutzt das physikalisch-fluiddynamische Funktionsprin-zip der Tragschrauber vom Stand der Technik. Tragschrauber sind interessant für Anwendungen mit geringen Geschwindigkeiten. Tragschrauber, auch Autogyro, Gyrokopter oder Gyrocopter genannt, sind Drehflügler, die in ihrer Funktionsweise einem Hubschrauber ähneln. Der Rotor wird passiv durch den Fahrtwind in Drehung versetzt (Autorotation). Der Auftrieb in Fahrt ergibt sich dabei durch den Widerstand des sich drehenden Rotorblatts. Bei Gyrokoptern von Stand der Technik erfolgt der Vortrieb wie beim Starrflügelflugzeug, meist durch ein Propellertriebwerk.
Als Erfinder des Tragschraubers gilt der Spanier Juan de la Cierva, der seinen Autogiro als geschützten Markennamen im Jahr 1923 bekannt machte. Autorotation entsteht, wenn das Rotorblatt im inneren Bereich der Rotorebene einen hohen Anstellwinkel hat derart, dass eine das Blatt beschleunigende Kraft resultiert. Im äußeren Durchmesser hingegen bremst die Resultierende das Blatt. Beschleunigende und Resultierende sind im stationären Flug im Gleichgewicht. Variiert (erhöht) man den Anstellwinkel der Rotorebene, verschiebt sich die Grenze zwischen beschleunigendem und abbremsendem Bereich nach außen und damit zugunsten der Beschleunigung und der Rotor erhöht seine Drehzahl. Der (orthonormal auf der Rotorebene wirksame) vertikale Überschuss wird als Hub nutzbar (Tragschrauber), bzw. im Fall des Flugaggregats mit Rotationsflügeln wird die dieserart senkrecht auf der Rotationsebene stehende Querkraft als Vortrieb nutzbar.
Stand der Technik. Arbeitsflugdrachen.
Das Spielfluggerät mit Rotationsflügel ist in der Weise eines Arbeitsflugdrachens nutzbar. Das Funktionsprinzip, Seefahrzeuge von Flugdrachen ziehen zu lassen, war bereits zur Zeit des legendären chinesischen Seefahrers Cheng Ho (Zhéng Hé *1371 in Kunming / Provinz Yunnan; + 1433) als Vortriebsmethode bekannt. Moderne Arbeitsflugdrachen vom Stand der Technik greifen das Funktionsprinzip des asiatischen Zugdrachens auf und kombinieren es mit einem dynamischen Flugstil moderner Lenkdrachen aus dem Spiel-, Freitzeit- und Sportbereich. Die Tragfläche von Arbeitsflugdrachen vom Stand der Technik ist in der Regel nach der Art eines Gleitschirms konstruiert und aus hochfesten und witterungsbeständigen Textilien gefertigt. Arbeitsflugdrachen erzielen ihre Zugkraft (gestalterisch) durch die Tragflächenform und (betriebstechnisch) durch eine Flugbahn in großen Achten. Durch den dynamischen Flug entstehen hohe Anströmgeschwindigkeiten und hohe wirksame Querkräfte (Vortriebskräfte) am Tragflügel. Durch den Flugstil in Achten erzeugt der Drachen einen bis zu dreimal größeren Vortrieb als ein herkömmliches Schiffssegel in vergleichbarer Größe. Die Zugkräfte werden über ein Zugseil zum Schiff übertragen. Arbeitsflugdrachen vom Stand der Technik werden mit einem vollautomatischen Steuerungssystem betrieben, das mit dem Autopiloten eines Flugzeugs vergleichbar ist. Für Arbeitsflugdrachen vom Stand der Technik beträgt verfahrensbedingt die optimale Betriebshöhe zwischen 100 und 300 Metern.
Stand der Wissenschaft. Windscherung und Vogelflug.
Die Geschwindigkeit der Luftströmung über einer ebenen Land- oder einer Wasseroberfläche besitzt einen Gradienten. Dieses Windscherung (vertikale Windzunahme an der Meeresoberfläche) genannte Strömungsphänomen ist in einer Schicht bis etwa 30 Meter über der (Wasser-) Oberfläche wirksam. Wandernde Seevögel nutzen die Windscherung um aus der Strömung Energie zu entkoppeln und dieserart stundenlang ohne Flügelschlag zu fliegen.
[...]
1 https://www.dpma.de/patent/anmeldune/index.html
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Transactions in Suffering Innovations"?
Die "Transactions in Suffering Innovations" bilden eine Sammlung von Schriften über Artefakte im Themenfeld Biologie & Technik, die in loser Reihenfolge erscheint. Sie zielen darauf ab, den Stand der Technik zu verändern.
Worauf konzentrieren sich die Beiträge zu den "Transactions in Suffering Innovations"?
Die Beiträge behandeln Artefakte, Problemlösungen, Gestaltungsfragen und die kritische Auseinandersetzung mit Themen der Bionik, also Technik nach Vorbildern aus der belebten und unbelebten Natur und ihre Umsetzung. In einigen Fällen werden technische Beschreibungen nach Standards des Deutschen Patent- und Markenrechts verfasst.
Was ist das Ziel der "Transactions in Suffering Innovations"?
Ziel ist es, den Fortschritt auf dem Gebiet der angewandten Bionik zu fördern, indem notleidende Artefakte, Problem- und Gestaltungslösungen frei von Rechten Dritter dem Leser zur Nutzung verfügbar gemacht werden.
Was bedeutet "notleidend" im Kontext der "Transactions in Suffering Innovations"?
"Notleidend" bezieht sich darauf, dass die dargestellten Artefakte entweder aus materieller Not nicht weiterverfolgt werden oder drohen, geistiger Umnachtung zum Opfer zu fallen.
Welche Art von Forschung soll durch die "Transactions in Suffering Innovations" angestoßen werden?
Es soll Forschung angestoßen werden, die Lösungswege der Übertragung biologischer Phänomene untersucht und Fragestellungen betrifft, die im Zusammenhang mit Natur und Technik stehen.
In welcher Sprache sind die Beiträge verfasst?
Die Beiträge sind in deutscher Sprache verfasst. Gegebenenfalls wird dem Text eine teilweise oder vollständige Übersetzung in englischer Sprache beigestellt.
Was ist der Gegenstand der technischen Beschreibung "Spielfluggerät mit Rotationsflügel"?
Die technische Beschreibung behandelt ein Spielfluggerät mit Rotationsflügel, dessen Rotationsflügel zweiarmig ist und dessen Arbeitstragflächen in einer Box-Wing-Konfiguration ausgeführt sind. Das Spielfluggerät nutzt das Autogyroprinzip und wird mit Steuerleinen vom Boden aus gelenkt.
Was ist eine Box-Wing-Konfiguration?
Von einem Tragflügel in Box-Wing-Konfiguration spricht man, wenn die Randbögen zweier Tragflügel in zwei benachbarten Tragflächenebenen (vertikal) miteinander verbunden sind. Dies führt zu stabilem Flugverhalten und vorteilhaftem Auftrieb bei hoher Kompaktheit.
Was ist das Autogyro-Prinzip?
Das Autogyro-Prinzip (Tragschrauberprinzip) besagt, dass der Rotor passiv durch den Fahrtwind in Drehung versetzt wird (Autorotation). Der Auftrieb entsteht durch den Widerstand des sich drehenden Rotorblatts.
Wie kann das Spielfluggerät mit Rotationsflügel genutzt werden?
Das Spielfluggerät mit Rotationsflügel kann als Arbeitsflugdrachen genutzt werden, um beispielsweise Querkräfte zur Fortbewegung zu erzeugen. Es könnte auch autonom in der bodennahen Luftschicht agieren und Scherwinde zur Querkrafterzeugung nutzen.
Was ist Windscherung?
Windscherung ist die vertikale Windzunahme an der Meeresoberfläche, ein Strömungsphänomen in einer Schicht bis etwa 30 Meter über der (Wasser-) Oberfläche, das von Seevögeln zur Energiegewinnung genutzt wird.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Michael Dienst (Author), 2018, Spielfluggerät mit Rotationsflügel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429330