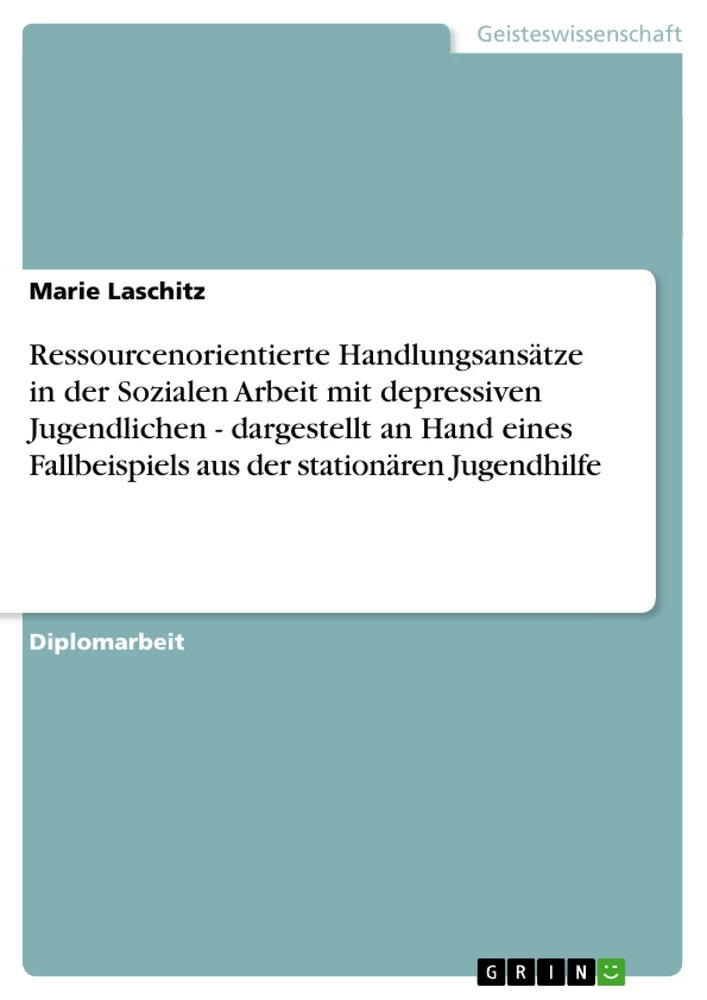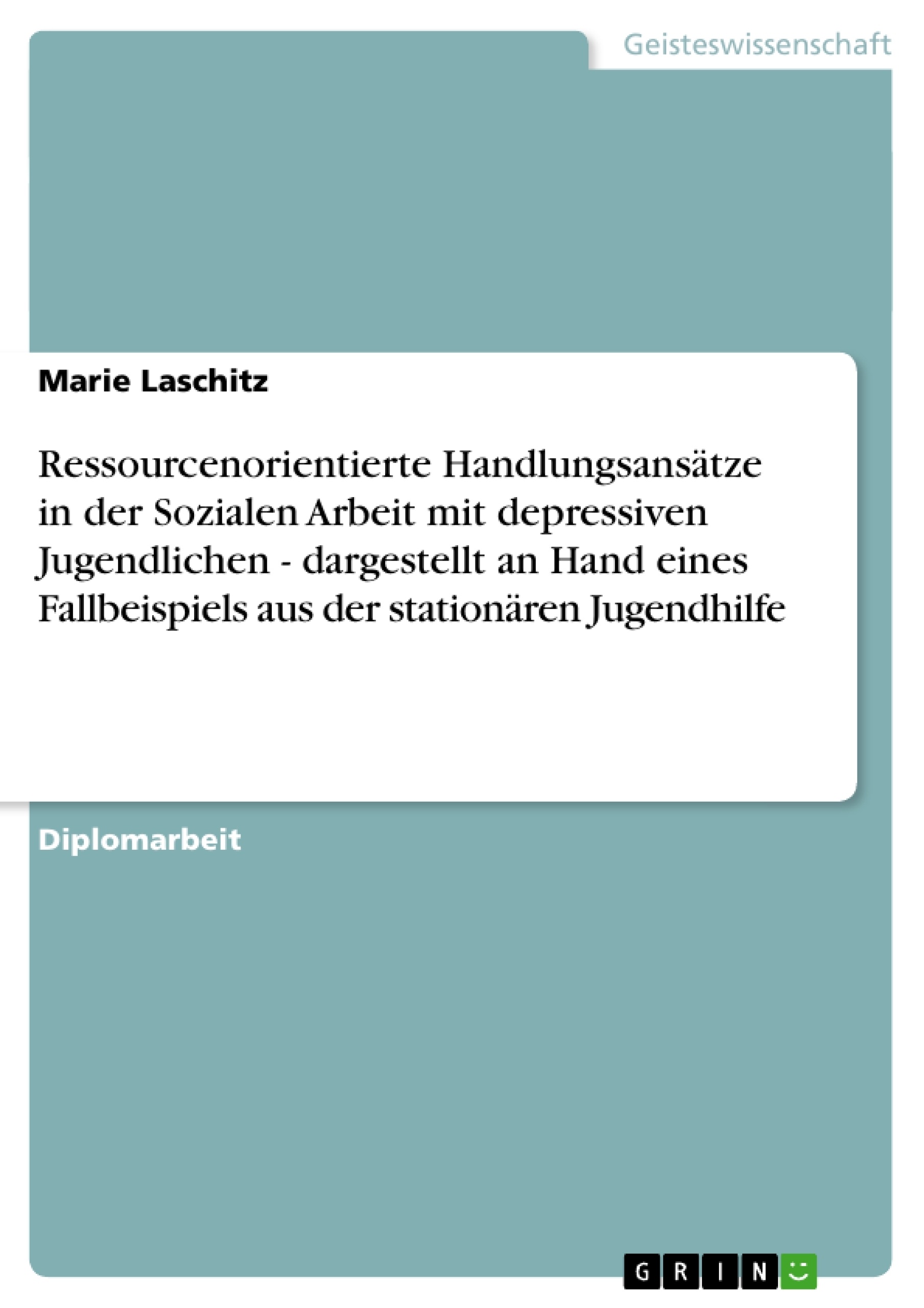Diese Arbeit beschäftigt sich unter einem ressourcenorientierten Blickwinkel mit dem
Phänomen der Depression bei Jugendlichen. Da es sich bei der Depression um eine psychiatrische
Störung handelt, habe ich mich dem Thema zunächst unter psychiatrischen
Gesichtspunkten genähert. Weil es sich aber um eine Arbeit der Fachrichtung Sozialpädagogik
handelt und ich hier mein eigentliches Metier sehe und weil die Arbeit mit depressiven
Menschen ebenso eine Aufgabe für die Soziale Arbeit ist, habe ich insbesondere
bei den Interventionsmöglichkeiten versucht, ein ausgewogenes Verhältnis von
Psychiatrie, Gesundheitslehre und den Handlungsansätzen Sozialer Arbeit herzustellen.
In der Einleitung skizziere ich ein erstes „Stimmungsbild" der Depression und versuche
mich heranzutasten an die tiefgreifenden Veränderungen, die ein Mensch in der Depression
erfährt. Auch lege ich kurz meinen persönlichen Zugang zum Thema dar.
In einem geschichtlichen Rückblick zeige ich auf, dass Depression durchaus als historisches
Phänomen und nicht nur als moderne Zivilisationskrankheit zu verstehen ist.
Im ersten Hauptteil beschäftige ich mich mit der Diagnose depressiver Störungen bei
Jugendlichen, mit der Definition, der Klassifikation, der Symptomatik, dem Verlauf, der
Epidemiologie und der Komorbidität dieser Krankheit.
Im zweiten Hauptteil gehe ich auf die biologischen, psychodynamischen und sozialpsychiatrischen
Erklärungsmodelle der Depression im allgemeinen und im besonderen auf
entwicklungspsychopathologische und sozialpsychiatrische Erklärungsmodelle in Hinblick
auf die Depression im Jugendalter ein.
Im dritten Hauptteil zeige ich verschiedene Interventionsmöglichkeiten auf, angefangen
von der Selbsthilfe der Wüstenmönche über psychotherapeutische, pharmakotherapeutische,
körperorientierte und kunsttherapeutische Ansätze bis hin zur Gesundheitslehre
von Antonovsky und zu dem Handlungsansatz Sozialer Arbeit nach Staub – Bernasconi
sowie dem Empowerment – Ansatz.
Im Verlauf meiner Arbeit nehme ich immer wieder Bezug auf ein mir bekanntes Fallbeispiel
aus der stationären Jugendhilfe, um die erarbeiteten Erkenntnisse zu veranschaulichen
und auf ihre Relevanz für die Praxis zu prüfen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zur Sprache und Begrifflichkeit
- 1.2 Persönlicher Zugang zum Thema
- 1.3 Zur Fragestellung
- 2. Die Depression in der Geschichte
- 3. Die Diagnose depressiver Störungen bei Jugendlichen
- 3.1 Die Diagnose im Wandel der Zeit
- 3.2 Definition und Klassifikation
- 3.3 Symptomatik
- 3.4 Verlauf
- 3.5 Epidemiologie
- 3.6 Komorbidität
- 4. Erklärungsmodelle der Depression
- 4.1 Biologie
- 4.2 Psychodynamik
- 4.2.1 Frühere psychodynamische Theorien der Depression (Auswahl)
- 4.2.2 Zeitgenössische psychodynamische Theorien der Depression
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ressourcenorientierte Handlungsansätze in der Sozialen Arbeit mit depressiven Jugendlichen. Sie verbindet psychiatrische, gesundheitswissenschaftliche und sozialpädagogische Perspektiven, um ein ausgewogenes Verständnis und Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln. Ein Fallbeispiel aus der stationären Jugendhilfe veranschaulicht die praktischen Implikationen der erarbeiteten Erkenntnisse.
- Ressourcenorientierte Interventionen bei depressiven Jugendlichen
- Diagnose und Klassifikation depressiver Störungen im Jugendalter
- Biologische, psychodynamische und sozialpsychiatrische Erklärungsmodelle der Depression
- Vielfältige Interventionsmöglichkeiten (psychotherapeutisch, pharmakologisch, etc.)
- Integration von Erkenntnissen aus der Psychiatrie, Gesundheitslehre und Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert ein erstes Stimmungsbild der Depression und beleuchtet die tiefgreifenden Veränderungen, die ein Mensch in diesem Zustand erfährt. Der persönliche Zugang der Autorin zum Thema wird ebenso kurz dargestellt, wie die Fragestellung der Arbeit, welche die Verbindung von psychiatrischen, gesundheitswissenschaftlichen und sozialpädagogischen Perspektiven auf die Behandlung depressiver Jugendlicher sucht. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende Auseinandersetzung mit der Thematik und bietet eine erste Orientierung für den Leser.
2. Die Depression in der Geschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Depression als historisches Phänomen und widerlegt die Vorstellung, sie sei ausschließlich eine moderne Zivilisationskrankheit. Es wird aufgezeigt, dass die Erkrankung in verschiedenen Epochen und Kulturen existiert hat und unterschiedliche Bedeutungen und Behandlungsansätze gefunden hat. Dies schafft ein breiteres Verständnis der Depression, indem es den Kontext und die Entwicklung ihrer Wahrnehmung in den historischen Kontext stellt.
3. Die Diagnose depressiver Störungen bei Jugendlichen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Diagnose depressiver Störungen bei Jugendlichen. Es behandelt die Entwicklung der Diagnose im Laufe der Zeit, Definitionen und Klassifikationen nach gängigen Systemen, die Symptomatik, den Verlauf der Erkrankung, epidemiologische Daten und Komorbiditäten. Der umfassende Überblick über diagnostische Aspekte liefert eine solide Grundlage für das Verständnis der Erkrankung im Jugendalter und deren Komplexität.
4. Erklärungsmodelle der Depression: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Erklärungsmodelle für die Depression, unterteilt in biologische, psychodynamische und sozialpsychiatrische Ansätze. Im Detail werden sowohl frühere als auch zeitgenössische psychodynamische Theorien erläutert, um ein umfassendes Bild der komplexen Ursachen der Erkrankung zu vermitteln. Die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven betont die multifaktorielle Natur der Depression.
Schlüsselwörter
Depression, Jugendliche, Ressourcenorientierung, Soziale Arbeit, Interventionsmöglichkeiten, Erklärungsmodelle, Psychodynamik, Biologie, Sozialpsychiatrie, Jugendhilfe, Fallbeispiel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ressourcenorientierte Handlungsansätze in der Sozialen Arbeit mit depressiven Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht ressourcenorientierte Handlungsansätze in der Sozialen Arbeit mit depressiven Jugendlichen. Sie verbindet psychiatrische, gesundheitswissenschaftliche und sozialpädagogische Perspektiven, um ein ausgewogenes Verständnis und Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln. Ein Fallbeispiel aus der stationären Jugendhilfe veranschaulicht die praktischen Implikationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Diagnose und Klassifikation depressiver Störungen im Jugendalter, biologische, psychodynamische und sozialpsychiatrische Erklärungsmodelle der Depression, vielfältige Interventionsmöglichkeiten (psychotherapeutisch, pharmakologisch etc.) und die Integration von Erkenntnissen aus der Psychiatrie, Gesundheitslehre und Sozialen Arbeit. Die historische Perspektive der Depression wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung (mit persönlichem Zugang, Fragestellung und Begriffsbestimmung), 2. Die Depression in der Geschichte, 3. Die Diagnose depressiver Störungen bei Jugendlichen (inkl. Symptomatik, Verlauf, Epidemiologie und Komorbidität) und 4. Erklärungsmodelle der Depression (biologische, psychodynamische und sozialpsychiatrische Ansätze).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Entwicklung eines umfassenden Verständnisses und von Interventionsmöglichkeiten für depressive Jugendliche durch die Verbindung psychiatrischer, gesundheitswissenschaftlicher und sozialpädagogischer Perspektiven, wobei der Fokus auf ressourcenorientierten Ansätzen liegt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Depression, Jugendliche, Ressourcenorientierung, Soziale Arbeit, Interventionsmöglichkeiten, Erklärungsmodelle, Psychodynamik, Biologie, Sozialpsychiatrie, Jugendhilfe, Fallbeispiel.
Wie wird die Depression in der Arbeit betrachtet?
Die Depression wird nicht nur als moderne Erkrankung betrachtet, sondern ihre historische Entwicklung und unterschiedliche Auffassungen in verschiedenen Epochen und Kulturen werden berücksichtigt. Die Arbeit zeigt die multifaktorielle Natur der Depression auf und integriert verschiedene Erklärungsmodelle.
Welche Arten von Erklärungsmodellen werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert biologische, psychodynamische (inkl. früherer und zeitgenössischer Theorien) und sozialpsychiatrische Erklärungsmodelle der Depression, um die komplexen Ursachen der Erkrankung zu beleuchten.
Gibt es ein Fallbeispiel?
Ja, die Arbeit beinhaltet ein Fallbeispiel aus der stationären Jugendhilfe, um die praktischen Implikationen der erarbeiteten Erkenntnisse zu veranschaulichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialarbeiter, Jugendhilfeeinrichtungen, Psychotherapeuten, Psychiatrie, Gesundheitswissenschaftler und alle, die sich mit der Behandlung und dem Verständnis von Depression bei Jugendlichen befassen.
- Quote paper
- Marie Laschitz (Author), 2004, Ressourcenorientierte Handlungsansätze in der Sozialen Arbeit mit depressiven Jugendlichen - dargestellt an Hand eines Fallbeispiels aus der stationären Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42946