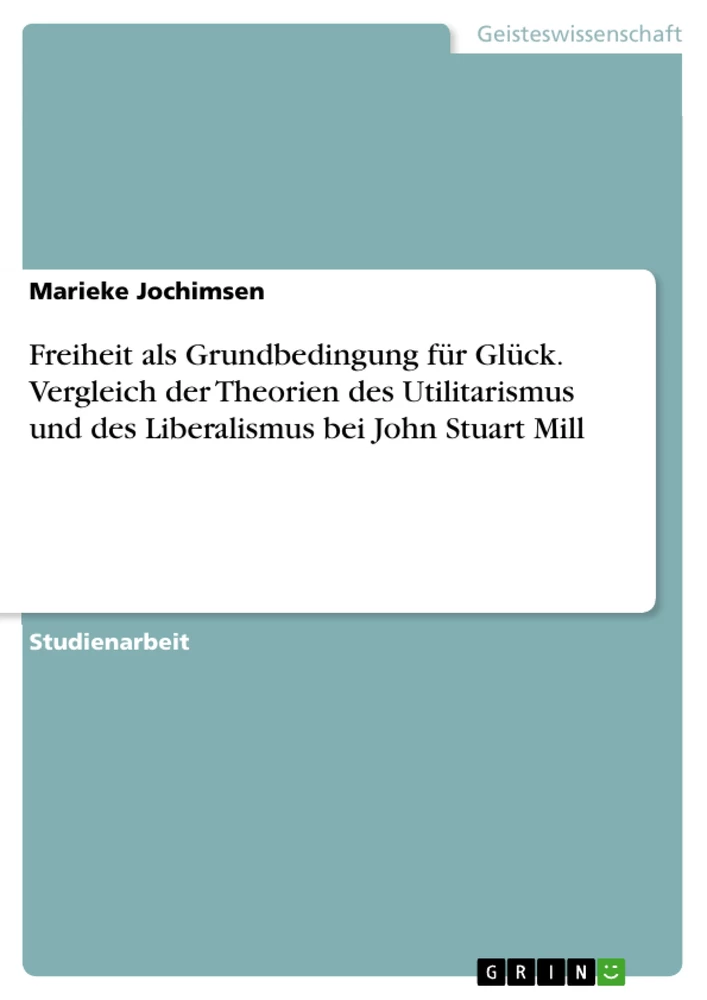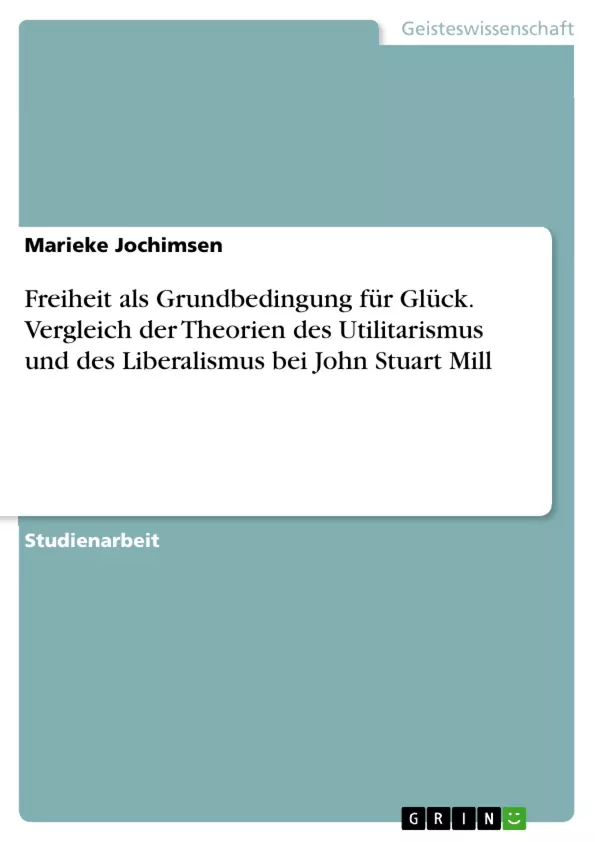In der Schrift "Über die Freiheit" entwickelt Mill einen Rechtsliberalismus, in dem er absolute Meinungs- und Handlungsfreiheit, sowie die uneingeschränkte Ausbildung der Individualität für grundlegende und notwendige Prinzipien erklärt. Wie ist aber eine solche politische Theorie, die sich am Wert des Einzelnen orientiert mit einer ethischen Theorie kompatibel, die im Gegensatz dazu den Nutzen der Gemeinschaft betont? Beide Theorien scheinen in einem Widerspruch miteinander zu stehen, da der Liberalismus um des Individuums willen die Macht, die die Gesellschaft über den Einzelnen ausübt, zu begrenzen sucht und ihm absolute Freiheit in allen ihn betreffenden Angelegenheiten zuschreibt, während gerade diese Freiheit nicht im Sinne der Gesellschaft und des größten Glücks für die größte Zahl, gemäß dem utilitaristischen Nutzenkalkül, zu sein scheint.
Jedoch sind beide Theorien, wie im Folgenden dargestellt wird, vielmehr Ergänzungen zueinander, als dass sie sich gegenseitig ausschließen, da Freiheit sich als Grundbedingung nicht nur für das Glück des Einzelnen, sondern der ganzen Gemeinschaft erweist. Um das zu zeigen, werden zunächst die Grundzüge Mills liberalistischer und utilitaristischer Theorie und der scheinbare Widerspruch beider Theorien kurz erläutert, um daran eine Zusammenführung und gegenseitige Vervollständigung beider Theorien anzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Freiheitsbegriff bei John Stuart Mill
- Das Prinzip der individuellen Freiheit
- Pflichten gegen sich selbst und Pflichten gegen andere
- Zur Notwendigkeit der Begrenzung der staatlichen Macht
- Mills Utilitarismus
- Problem der Zusammenführung von Utilitarismus und Liberalismus
- Liberalismus und Utilitarismus als gegenseitige Vervollständigung
- Utilitarismus zur Begründung des Liberalismus
- Liberalismus um des Utilitarismus willen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit Mills Liberalismus mit seiner utilitaristischen Theorie vereinbar ist. Sie analysiert Mills Konzept der individuellen Freiheit und untersucht, wie es sich mit der utilitaristischen Maxime des größtmöglichen Glücks für die größtmögliche Zahl in Einklang bringen lässt.
- Das Prinzip der individuellen Freiheit
- Die Begrenzung der staatlichen Macht
- Die Verbindung von Liberalismus und Utilitarismus
- Die Bedeutung von Freiheit für das Glück des Einzelnen und der Gesellschaft
- Die "Tyrannei der Mehrheit" als Gefahr für die individuelle Freiheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erklärt, warum die Verbindung von Mills Liberalismus und Utilitarismus problematisch erscheint.
- Der Freiheitsbegriff bei John Stuart Mill: Dieses Kapitel beschreibt Mills Konzept der individuellen Freiheit und stellt dessen zentrale Elemente dar, wie die absolute Meinungs- und Handlungsfreiheit sowie die freie Wahl der Lebensgestaltung.
- Mills Utilitarismus: Das Kapitel erläutert die Grundzüge des Utilitarismus, der sich am Prinzip des größtmöglichen Glücks für die größtmögliche Zahl orientiert.
- Problem der Zusammenführung von Utilitarismus und Liberalismus: Hier wird der scheinbare Widerspruch zwischen den beiden Theorien beleuchtet. Während der Liberalismus die Freiheit des Einzelnen betont, scheint der Utilitarismus den Nutzen der Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen.
- Liberalismus und Utilitarismus als gegenseitige Vervollständigung: Dieses Kapitel argumentiert, dass die beiden Theorien sich nicht ausschließen, sondern vielmehr einander ergänzen. Es wird gezeigt, wie der Utilitarismus zur Begründung des Liberalismus beitragen kann und wie der Liberalismus wiederum dem Utilitarismus dienen kann.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Freiheit, Liberalismus, Utilitarismus, Individualität, Gesellschaft, Glück, Nutzen, "Tyrannei der Mehrheit", Meinungsfreiheit, Handlungsfreiheit und staatliche Macht.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert John Stuart Mill individuelle Freiheit?
Mill fordert absolute Meinungs- und Handlungsfreiheit sowie die uneingeschränkte Ausbildung der Individualität, solange anderen kein Schaden zugefügt wird.
Besteht ein Widerspruch zwischen Liberalismus und Utilitarismus?
Der scheinbare Widerspruch liegt darin, dass der Liberalismus das Individuum schützt, während der Utilitarismus den Nutzen der Gemeinschaft betont. Mill sieht beide jedoch als Ergänzung.
Warum ist Freiheit laut Mill für die Gesellschaft nützlich?
Freiheit ermöglicht Fortschritt und die Entdeckung von Wahrheiten, was letztlich das "größte Glück für die größte Zahl" im utilitaristischen Sinne fördert.
Was versteht Mill unter der "Tyrannei der Mehrheit"?
Es ist die Gefahr, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre Meinungen und Sitten dem Einzelnen aufzwingt und so die individuelle Freiheit unterdrückt.
Wann darf der Staat laut Mill in die Freiheit des Einzelnen eingreifen?
Ein Eingriff ist nur dann gerechtfertigt, wenn er dazu dient, Schaden von anderen Mitgliedern der Gesellschaft abzuwenden (Schadensprinzip).
- Quote paper
- Marieke Jochimsen (Author), 2008, Freiheit als Grundbedingung für Glück. Vergleich der Theorien des Utilitarismus und des Liberalismus bei John Stuart Mill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429526