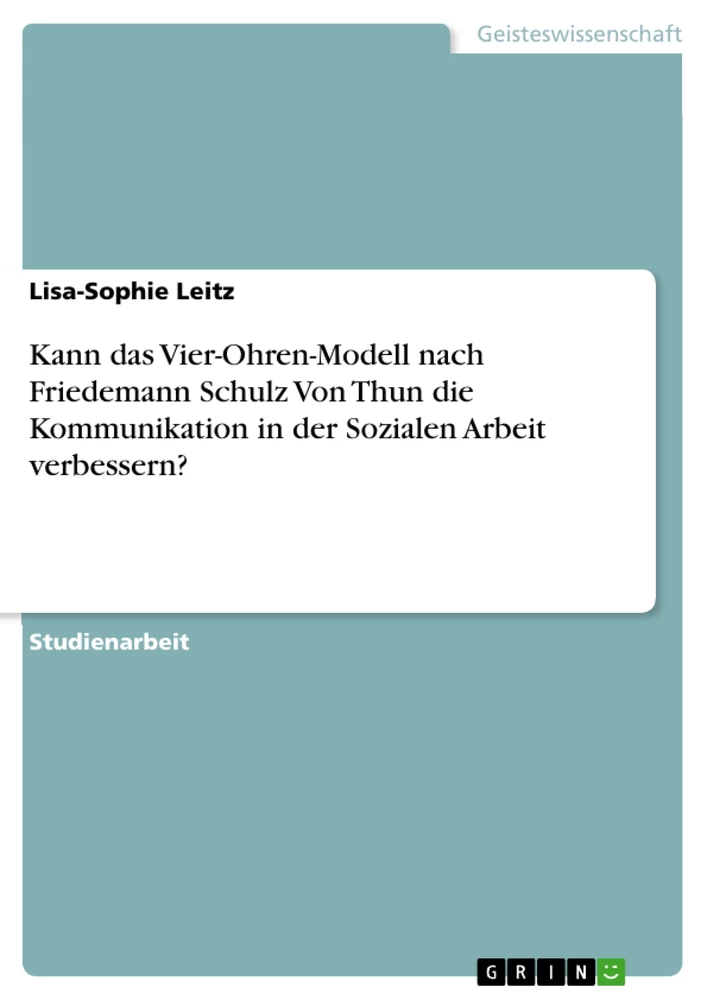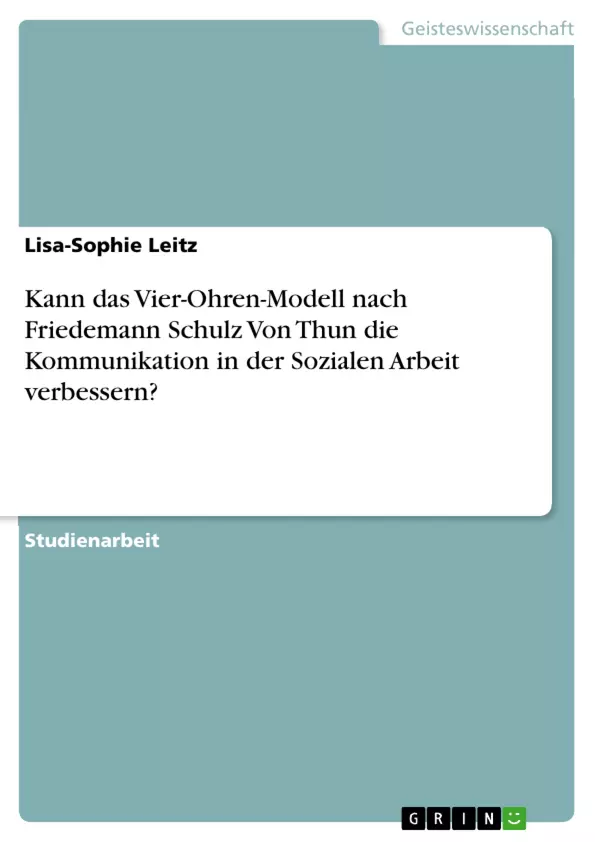Die folgende Arbeit ist eine Seminararbeit des Moduls „Verfahren und Techniken der Sozialen Arbeit“. Sie setzt sich mit der Fragestellung „Kann das Vier-Ohren-Modell nach Friedemann Schulz Von Thun die Kommunikation im methodischen Handeln der Sozialen Arbeit verbessern?“ auseinander. Diese gilt es zu verifizieren oder zu falsifizieren.
Um die Fragestellung bearbeiten zu können, wird zunächst erklärt, was Methoden der Sozialen Arbeit sind, welchen Rahmenbedingungen sie unterliegen und wie mit ihnen gearbeitet wird. Im Anschluss daran wird im Detail auf ein Beispiel für eine Methode der Sozialen Arbeit, nämlich die Soziale Gruppenarbeit, eingegangen. Nachdem geklärt wurde, was Soziale Gruppenarbeit bedeutet und welche Ziele sie verfolgt, wird der Begriff „Kommunikation“ definiert. Anschließend an diese Definition wird das Vier-Ohren-Modell nach Friedemann Schulz Von Thun vorgestellt und erläutert. Um ein noch besseres Verständnis für das Modell zu schaffen, werden in beiden darauf folgenden Abschnitten jeweils seine Vor- und Nachteile aufgeführt. Nachdem diese anhand von Beispielen belegt wurden, wird das Vier-Ohren-Modell im nächsten Kapitel auf die Soziale Gruppenarbeit angewandt. Es wird geprüft, ob und wie es die Kommunikation in einer Gruppe verbessern kann. Im abschließenden Fazit werden die gesammelten Informationen der Arbeit noch einmal zusammengefasst und ausgewertet. Die ausgewerteten Informationen werden dann als Grundlage der Argumentation dienen, in der die zu Anfang aufgeführte Fragestellung erörtert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Methoden der Sozialen Arbeit
- 3 Definition - Kommunikation
- 4 Das Vier-Ohren-Modell
- 4.1 Definition
- 4.2 Nachteile
- 4.3 Vorteile
- 5 Das Vier-Ohren-Modell in der Sozialen Gruppenarbeit
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Verbesserungspotenziale des Vier-Ohren-Modells nach Friedemann Schulz von Thun für die Kommunikation im methodischen Handeln der Sozialen Arbeit. Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendbarkeit und Effektivität des Modells in diesem Kontext zu überprüfen.
- Methoden der Sozialen Arbeit und deren Rahmenbedingungen
- Definition und Bedeutung von Kommunikation in der Sozialen Arbeit
- Das Vier-Ohren-Modell: Definition, Vorteile und Nachteile
- Anwendung des Vier-Ohren-Modells in der Sozialen Gruppenarbeit
- Bewertung des Verbesserungspotenzials des Modells für die Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Kann das Vier-Ohren-Modell die Kommunikation im methodischen Handeln der Sozialen Arbeit verbessern? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Vorgehensweise bei der Beantwortung der Forschungsfrage. Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit innerhalb des Moduls „Verfahren und Techniken der Sozialen Arbeit“ klar und betont den Anspruch, die Forschungsfrage zu verifizieren oder zu falsifizieren.
2 Methoden der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Methode“ im Kontext der Sozialen Arbeit. Es diskutiert die unterschiedlichen Auffassungen und Definitionen des Methodenbegriffs und betont die fehlende einheitliche Verwendung in der Fachliteratur. Es werden verschiedene Ansätze zur Abgrenzung von Methoden, Konzepten und Techniken vorgestellt und die Bedeutung der Berücksichtigung von Ausgangslagen, Zielen und Rahmenbedingungen hervorgehoben. Das Kapitel identifiziert vier Kernmerkmale sozialer Arbeit: Allzuständigkeit, Alltagsorientierung, den Klienten als Co-Produzent und das „doppelte Mandat“. Diese Merkmale werden ausführlich erläutert und ihre Konsequenzen für das methodische Handeln werden diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer situationsangepassten Methodenwahl und die Berücksichtigung von Nebenwirkung betont werden. Schließlich werden die drei Hauptmethoden der Sozialen Arbeit – Einzelfallhilfe, soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit – kurz vorgestellt.
Schlüsselwörter
Vier-Ohren-Modell, Friedemann Schulz von Thun, Kommunikation, Soziale Arbeit, Methoden der Sozialen Arbeit, Soziale Gruppenarbeit, methodisches Handeln, Kommunikationsverbesserung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Verbesserungspotenziale des Vier-Ohren-Modells in der Sozialen Arbeit
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht, wie das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun die Kommunikation in der Sozialen Arbeit verbessern kann. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Darstellung der Methoden der Sozialen Arbeit, eine Definition von Kommunikation, eine detaillierte Erklärung des Vier-Ohren-Modells (inklusive Vorteile und Nachteile), seine Anwendung in der Sozialen Gruppenarbeit und ein abschließendes Fazit. Die Arbeit zielt darauf ab, die Anwendbarkeit und Effektivität des Modells zu überprüfen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Methoden der Sozialen Arbeit und deren Rahmenbedingungen, Definition und Bedeutung von Kommunikation in der Sozialen Arbeit, das Vier-Ohren-Modell (Definition, Vorteile und Nachteile), Anwendung des Vier-Ohren-Modells in der Sozialen Gruppenarbeit und eine abschließende Bewertung seines Verbesserungspotenzials für die Kommunikation.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Methoden der Sozialen Arbeit, Definition von Kommunikation, Das Vier-Ohren-Modell (mit Unterkapiteln zu Definition, Vorteilen und Nachteilen), Das Vier-Ohren-Modell in der Sozialen Gruppenarbeit und Fazit. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage und skizziert den Aufbau. Jedes Kapitel fasst seine Kernaussagen zusammen.
Was sind die wichtigsten Methoden der Sozialen Arbeit laut der Seminararbeit?
Die Seminararbeit nennt Einzelfallhilfe, soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit als drei Hauptmethoden der Sozialen Arbeit. Sie betont dabei die Bedeutung einer situationsangepassten Methodenwahl und die Berücksichtigung von Nebenwirkung. Die Arbeit diskutiert auch den Methodenbegriff selbst und die Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition in der Fachliteratur.
Welche Rolle spielt das Vier-Ohren-Modell in dieser Seminararbeit?
Das Vier-Ohren-Modell steht im Mittelpunkt der Arbeit. Es wird definiert, seine Vorteile und Nachteile werden analysiert, und seine Anwendung in der Sozialen Gruppenarbeit wird untersucht. Die zentrale Forschungsfrage lautet, ob das Modell die Kommunikation im methodischen Handeln der Sozialen Arbeit verbessern kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Vier-Ohren-Modell, Friedemann Schulz von Thun, Kommunikation, Soziale Arbeit, Methoden der Sozialen Arbeit, Soziale Gruppenarbeit, methodisches Handeln, Kommunikationsverbesserung.
Welche Forschungsfrage wird in der Seminararbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann das Vier-Ohren-Modell die Kommunikation im methodischen Handeln der Sozialen Arbeit verbessern?
- Quote paper
- Lisa-Sophie Leitz (Author), 2017, Kann das Vier-Ohren-Modell nach Friedemann Schulz Von Thun die Kommunikation in der Sozialen Arbeit verbessern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429572