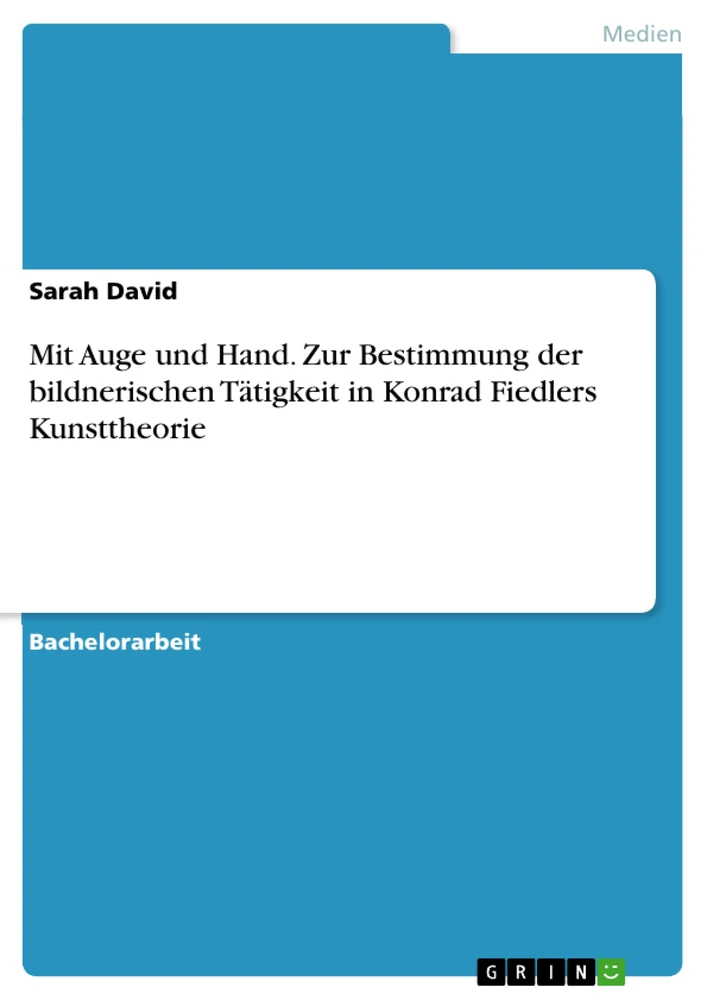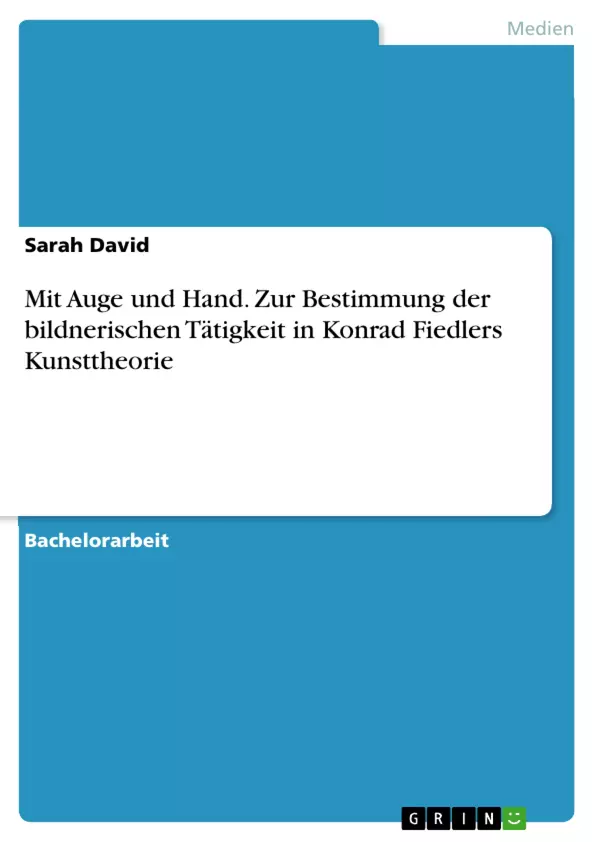In der vorliegenden Bachelorarbeit soll Fiedlers Bestimmung der bildnerischen Tätigkeit näher untersucht werden, die er im Rahmen seiner Kunsttheorie entwickelt. Hierzu möchte ich seine „Schriften zur Kunst“ in Gottfried Boehms neuaufgelegter Edition heranziehen – insbesondere Fiedlers Hauptwerk "Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit" (1887), da er hier den bildenden Gestaltungsvorgang explizit in den Mittelpunkt stellt.
Fiedlers Kunstverständnis basiert wesentlich auf seiner Analyse des menschlichen Sehens und seiner Definition der künstlerischen Tätigkeit als einer anschaulichen Erkenntnisarbeit, die das visuelle Bewusstsein des Menschen sensibilisieren und über alltägliche Sehkonventionen hinausführen kann. In Abgrenzung zu etablierten ästhetischen Kunstbetrachtungen erarbeitet Fiedler einen produktionsorientierten Ansatz, der vorrangig auf bildliche Darstellungen abzielt. Ein wichtiger Bezugspunkt ist Wilhelm von Humboldts Sprachphilosophie, deren zentrale Thesen von Fiedler aufgegriffen und für seine Kunsttheorie fruchtbar gemacht werden. Neben seinem Rekurs auf Humboldt nimmt Fiedlers Theorie der Sichtbarkeit eine zentrale Bedeutung bei seiner Analyse der gestalterischen Arbeit ein. Daher sollen beide Momente – Fiedlers Bezug zu Humboldts Sprachphilosophie und sein Theorem der Sichtbarkeit – im Folgenden näher betrachtet werden.
Konrad Fiedler (1841–1895) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Kunsttheoretiker des 19. Jahrhunderts. Seinem Werk wird rückwirkend ein weit über seine Zeit hinausreichender Einfluss auf die Entwicklung der bildenden Kunst zugeschrieben. Aufgrund seiner produktionsästhetischen Perspektive erfährt Fiedler vor allem in Künstlerkreisen eine große Resonanz, während seine theoretischen Motivansätze im Rahmen ästhetischer oder philosophischer Debatten zunächst kaum diskutiert werden. Ihre heutige Bedeutung als wichtige Referenz in der Reflexion moderner Kunst erlangen Fiedlers kunsttheoretische Schriften erst Jahrzehnte nach seinem Tod: In den 70er Jahren setzt eine breiter werdende und zunehmend interdisziplinär ausgerichtete Rezeption seiner Schriften ein. Auch für die gegenwärtige Kunst- und Bildforschung, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeiten und Verwendungsweisen digitaler Bildbearbeitung und virtueller Simulationen, erhalten Fiedlers Ansätze eine erweiterte, gleichsam visionäre Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Fiedlers Kunsttheorie im philosophiehistorischen Kontext
- 2.1 Fiedler als formaler Ästhetiker
- 2.2 Fiedlers Auseinandersetzung mit Kant
- 2.2.1 Fiedlers Abkehr von Kants ästhetischem Urteil
- 2.2.2 Fiedlers Interpretation von Kants Erkenntnistheorie
- 3 Fiedlers Beziehung zu Humboldts Sprachphilosophie
- 3.1 Der Prozess sprachlicher Welterzeugung
- 3.2 Die Sprache der Anschauung
- 4 Fiedlers Phänomenologie des Sehens
- 4.1 Die Grenzen des alltäglichen Sehens
- 4.2 Sehen um des Sehens willen
- 5 Die bildnerische Arbeit als anschauliche Erkenntnisarbeit
- 5.1 Fiedlers Kategorie der Ausdrucksbewegung
- 5.2 Das Zusammenspiel von Auge und Hand
- 5.3 Das Bild als Ausdrucksform reiner Sichtbarkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Konrad Fiedlers Bestimmung der bildnerischen Tätigkeit innerhalb seiner Kunsttheorie. Der Fokus liegt auf Fiedlers Hauptwerk "Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit" und analysiert seine produktionsästhetische Perspektive. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Fiedlers Kunstverständnis, seiner Analyse des Sehens und seiner Definition der künstlerischen Tätigkeit als anschauliche Erkenntnisarbeit.
- Einordnung von Fiedlers Kunsttheorie in den philosophiehistorischen Kontext (Formalismus, Kant).
- Analyse von Fiedlers Beziehung zu Humboldts Sprachphilosophie.
- Untersuchung von Fiedlers Phänomenologie des Sehens.
- Detaillierte Betrachtung der bildnerischen Tätigkeit als anschauliche Erkenntnisarbeit.
- Die Rolle von Ausdrucksbewegung und dem Zusammenspiel von Auge und Hand in Fiedlers Theorie.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt Konrad Fiedler als bedeutenden deutschen Kunsttheoretiker des 19. Jahrhunderts vor und hebt den rückwirkenden Einfluss seines Werkes hervor. Sie beschreibt den produktionsästhetischen Ansatz Fiedlers und seine späte, interdisziplinäre Rezeption, insbesondere im Kontext digitaler Bildbearbeitung. Die Arbeit kündigt die Untersuchung von Fiedlers Bestimmung der bildnerischen Tätigkeit an, wobei sein Hauptwerk "Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit" im Mittelpunkt steht. Fiedlers Kunstverständnis als anschauliche Erkenntnisarbeit und seine Bezugnahme auf Humboldts Sprachphilosophie werden als zentrale Aspekte hervorgehoben.
2 Fiedlers Kunsttheorie im philosophiehistorischen Kontext: Dieses Kapitel ordnet Fiedlers Werk in den Kontext der "nicht-spekulativen Ästhetik" des 19. Jahrhunderts ein, die sich vom Deutschen Idealismus abgrenzt und eine empirisch basierte, induktive Methode verfolgt. Fiedlers formalistischer Standpunkt wird im Verhältnis zu Herbart und Zimmermann diskutiert. Das Kapitel analysiert Fiedlers eigenständige Position innerhalb des ästhetischen Formalismus und seine Auseinandersetzung mit Kants Transzendentalphilosophie, wobei die Frage nach der gleichberechtigten Stellung von künstlerisch-anschaulicher und analytisch-begrifflicher Welterschließung im Mittelpunkt steht.
3 Fiedlers Beziehung zu Humboldts Sprachphilosophie: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Humboldts Sprachphilosophie auf Fiedlers Kunsttheorie. Es beleuchtet den Prozess sprachlicher Welterzeugung und die Rolle der Sprache der Anschauung in Fiedlers Werk. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Fiedler den Zusammenhang zwischen Kunst und Sprache beschreibt und wie er die spezifische Erkenntnisleistung der künstlerischen Tätigkeit in bildlichen Darstellungen versteht.
4 Fiedlers Phänomenologie des Sehens: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Fiedlers Analyse des Sehens, die für seine Untersuchung der künstlerischen Gestaltungsarbeit fundamental ist. Es untersucht die Grenzen des alltäglichen Sehens und das Konzept des "Sehens um des Sehens willen". Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis von Fiedlers Auffassung der künstlerischen Tätigkeit als anschauliche Erkenntnisarbeit.
5 Die bildnerische Arbeit als anschauliche Erkenntnisarbeit: Dieses Kapitel behandelt Fiedlers zentrale These der bildnerischen Tätigkeit als anschauliche Erkenntnisarbeit. Es analysiert seine Kategorie der Ausdrucksbewegung, das Zusammenspiel von Auge und Hand, und die Realisierung des künstlerischen Erkenntnisinteresses in der bildspezifischen Form der Sichtbarkeit. Das Kapitel beleuchtet, wie Fiedler den bildnerischen Prozess definiert und welchen Zusammenhang er zwischen Kunst und Erkenntnis herstellt.
Schlüsselwörter
Konrad Fiedler, Kunsttheorie, Produktionsästhetik, Anschauliche Erkenntnisarbeit, Formalismus, Kant, Humboldt, Sprachphilosophie, Sehen, Ausdrucksbewegung, Sichtbarkeit, Bildgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konrad Fiedlers Kunsttheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit analysiert Konrad Fiedlers Kunsttheorie, insbesondere seine Auffassung der bildnerischen Tätigkeit als anschauliche Erkenntnisarbeit. Der Fokus liegt auf seinem Hauptwerk "Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit" und untersucht dessen produktionsästhetische Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Fiedlers Einordnung in den philosophiehistorischen Kontext (Formalismus, Kant), seine Beziehung zu Humboldts Sprachphilosophie, seine Phänomenologie des Sehens und detailliert die bildnerische Tätigkeit als anschauliche Erkenntnisarbeit. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Ausdrucksbewegung und dem Zusammenspiel von Auge und Hand in Fiedlers Theorie gewidmet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Einordnung Fiedlers in den philosophiehistorischen Kontext, ein Kapitel zu seiner Beziehung zu Humboldts Sprachphilosophie, ein Kapitel zu seiner Phänomenologie des Sehens und ein Kapitel, das die bildnerische Arbeit als anschauliche Erkenntnisarbeit im Detail behandelt. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte.
Welche Rolle spielt Kant in Fiedlers Kunsttheorie?
Die Arbeit analysiert Fiedlers Auseinandersetzung mit Kants Transzendentalphilosophie und untersucht, wie sich Fiedler von Kants ästhetischem Urteil abgrenzt und seine eigene Position innerhalb des ästhetischen Formalismus entwickelt. Ein zentraler Punkt ist die Frage nach der gleichberechtigten Stellung von künstlerisch-anschaulicher und analytisch-begrifflicher Welterschließung.
Welchen Einfluss hat Humboldts Sprachphilosophie auf Fiedlers Werk?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Humboldts Sprachphilosophie auf Fiedlers Kunsttheorie, insbesondere den Prozess sprachlicher Welterzeugung und die Rolle der "Sprache der Anschauung". Es wird analysiert, wie Fiedler den Zusammenhang zwischen Kunst und Sprache beschreibt und die spezifische Erkenntnisleistung der künstlerischen Tätigkeit in bildlichen Darstellungen versteht.
Was versteht Fiedler unter "anschaulicher Erkenntnisarbeit"?
Fiedlers zentrale These ist die Auffassung der bildnerischen Tätigkeit als "anschauliche Erkenntnisarbeit". Die Arbeit analysiert diese These, indem sie seine Kategorie der Ausdrucksbewegung, das Zusammenspiel von Auge und Hand und die Realisierung des künstlerischen Erkenntnisinteresses in der bildspezifischen Form der Sichtbarkeit untersucht.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für Fiedlers Kunsttheorie?
Schlüsselbegriffe sind: Konrad Fiedler, Kunsttheorie, Produktionsästhetik, Anschauliche Erkenntnisarbeit, Formalismus, Kant, Humboldt, Sprachphilosophie, Sehen, Ausdrucksbewegung, Sichtbarkeit und Bildgestaltung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende und Wissenschaftler*innen, die sich mit Kunsttheorie, Ästhetik, Philosophie und der Geschichte der Kunst auseinandersetzen. Sie bietet einen umfassenden Einblick in das Werk Konrad Fiedlers und dessen Bedeutung für das Verständnis von Kunst und Erkenntnis.
- Quote paper
- Sarah David (Author), 2018, Mit Auge und Hand. Zur Bestimmung der bildnerischen Tätigkeit in Konrad Fiedlers Kunsttheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429743