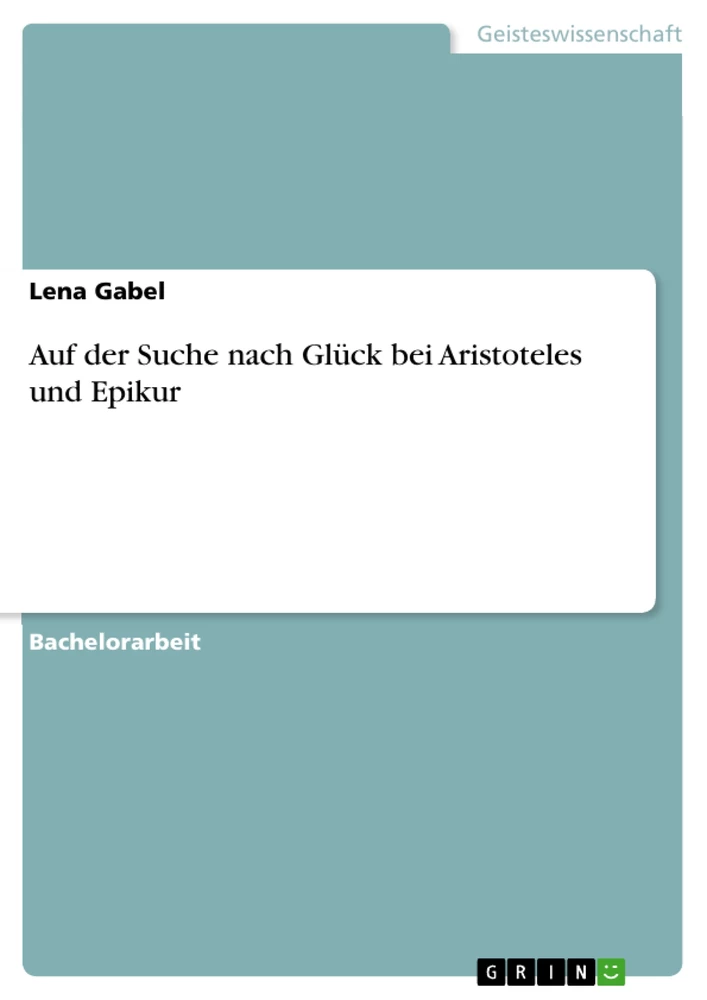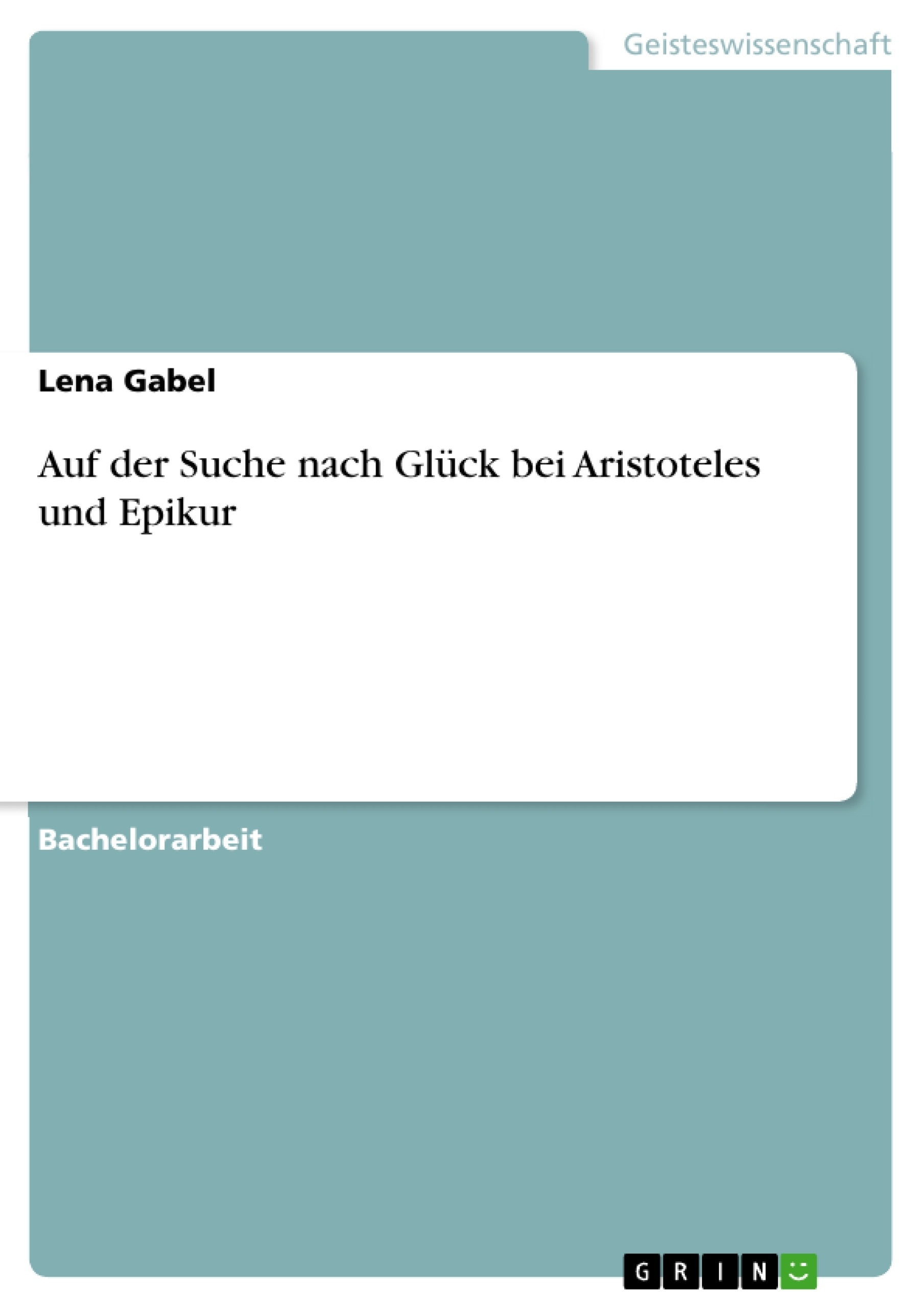Überlegungen zu einem gelungenen Leben ziehen sich durch alle Epochen, und heute scheint die Frage nach Glück und einem erfüllten Leben aktueller denn je. Buchhandlungen bieten unzählige verschiedene Ratgeber an, von Sittenratgebern und Empfehlungen für ein angemessenes Verhalten in allen Lebenslagen, bis hin zu Ratgebern, mit deren Hilfe ein gutes, glückliches Leben versprochen wird. Worin ein glückliches Leben besteht, darüber herrscht kein Konsens, sodass die Bandbreite an Ratgebern und Büchern über das Glück immer unüberschaubarer wird. Manche sehen ihr Glück in materiellem Reichtum und beruflichem und privatem Erfolg. Auch hier bleibt die Definition von Erfolg diskussionswürdig.
Diese Arbeit gliedert sich in drei Teile, wobei in jedem ein Philosoph thematisiert wird. Die ersten zwei Teile widmen sich der antiken Philosophie. Im ersten Teil wird die Philosophie des Glücks nach Aristoteles dargelegt. Anhand der Nikomachischen Ethik soll die Vorstellung von Glück und einem gelungenen Leben nach Aristoteles dargelegt werden. Die Arbeit konzentriert sich auf das Glück des Einzelnen. In der Nikomachischen Ethik sind die Tugenden elementar und nehmen in dieser Untersuchung viel Raum ein. In dieser Arbeit wird mit der Nikomachischen Ethik, 2017 herausgegeben und übersetzt von Gernot Krapinger, gearbeitet.
Im zweiten Teil zur antiken Glücksphilosophie sollen die Grundgedanken zu einem guten Leben von Epikur und seine Vorstellung von Glück dargelegt werden. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Empfindungen, vor allem die Lust. Aber auch die Bedeutung von Freundschaft spielt eine Rolle. Außerdem sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Glücksvorstellung von Aristoteles herausgearbeitet werden. Dazu wird mit den Fragmenten, aber auch mit überlieferten Briefen Epikurs gearbeitet. Die Briefe und Lehrsätze sind in einer zweisprachigen Ausgabe gesammelt und übersetzt worden von Hans-Wolfgang Krautz.
Im letzten Drittel beschäftigt sich diese Arbeit mit Wilhelm Schmid und stellt sich die Frage, ob antike Glücksphilosophie auch heute noch aktuell ist. Außerdem soll das Glücksstreben und das Bedürfnis der Menschen nach einem gelungenen, erfüllten Leben in der heutigen Zeit dargelegt werden. Die Philosophie Wilhelm Schmids strebt nach einer praktischen Anwendung und seine Vorstellung von einem glücklichen Leben soll in dieser Arbeit dargelegt werden. Schmid entwirft eine Philosophie der Lebenskunst, die in ihren verschiedenen Facetten dargelegt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Glück bei Aristoteles
- 1. Glück als höchstes menschliches Gut
- 2. Tugenden
- 2.1. Die aristotelische Mesotes- Lehre
- 2.2. Lust und Unlust
- 3. Der Wert der Freundschaft
- III. Glück bei Epikur
- 1. Anleitung zu einem gelungenen Leben
- 2. Die Bedeutung der Empfindungen
- 2.1. Menschliche Begierden
- 2.2. Die Lust als höchstes Gut
- 2.3. Die Bedeutung von Schmerz und Tod
- 3. Der Wert der Freundschaft
- IV. Glück im aktuellen Kontext - am Beispiel von Wilhelm Schmid
- 1. Ist antike Glücksphilosophie heute noch aktuell?
- 2. Philosophie in der Praxis
- 3. Ein Entwurf der Lebenskunst
- 3.1. Was bedeutet Glück?
- 3.2. Der richtige Umgang mit Leid
- 3.3. Die Bedeutung von Freundschaft
- 4. Melancholie – Der notwendige Gegenpol zum Glück
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage nach Glück und einem gelungenen Leben aus philosophischer Perspektive, indem sie die Ideen von Aristoteles und Epikur untersucht und diese mit der Philosophie Wilhelm Schmids in einen modernen Kontext stellt. Die Arbeit will herausfinden, ob antike Glücksphilosophie heute noch relevant ist und wie man aus der Vergangenheit lernen kann, um ein erfülltes Leben zu gestalten.
- Das Konzept des Glücks in der antiken Philosophie
- Die Bedeutung von Tugenden und Freundschaft für ein gelungenes Leben nach Aristoteles
- Epikurs Vorstellung von Glück und die Rolle von Lust und Schmerz
- Die Frage nach der Aktualität antiker Glücksphilosophie in der heutigen Zeit
- Wilhelm Schmids Ansatz einer "Lebenskunst" und ihre praktische Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
II. Glück bei Aristoteles
Dieses Kapitel analysiert Aristoteles' Verständnis von Glück als höchstes menschliches Gut. Es werden seine zentralen Thesen zur Tugendlehre und der Bedeutung der Freundschaft für ein gelungenen Leben dargelegt.
III. Glück bei Epikur
Dieses Kapitel stellt Epikurs Philosophie des Glücks vor, die auf der Suche nach einem Leben frei von Angst und Schmerz basiert. Es werden seine Ideen zur Bedeutung von Empfindungen, insbesondere der Lust, und zur Rolle der Freundschaft erläutert.
IV. Glück im aktuellen Kontext - am Beispiel von Wilhelm Schmid
Dieses Kapitel untersucht, inwiefern antike Glücksphilosophie auch heute noch relevant ist. Es wird Wilhelm Schmids Ansatz einer "Lebenskunst" vorgestellt, der praktische Handlungsempfehlungen für ein glückliches Leben bietet.
Schlüsselwörter
Glück, Glückseligkeit, Aristoteles, Epikur, Wilhelm Schmid, Tugend, Freundschaft, Lust, Schmerz, Lebenskunst, Philosophie, Ethik.
- Quote paper
- B.A Lena Gabel (Author), 2018, Auf der Suche nach Glück bei Aristoteles und Epikur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429774