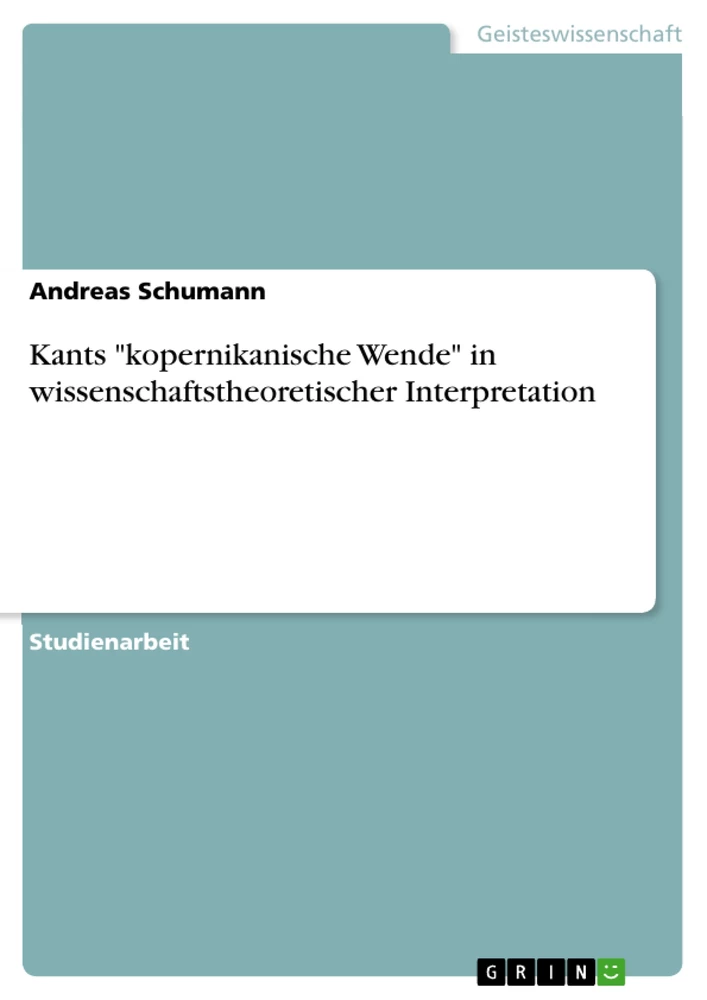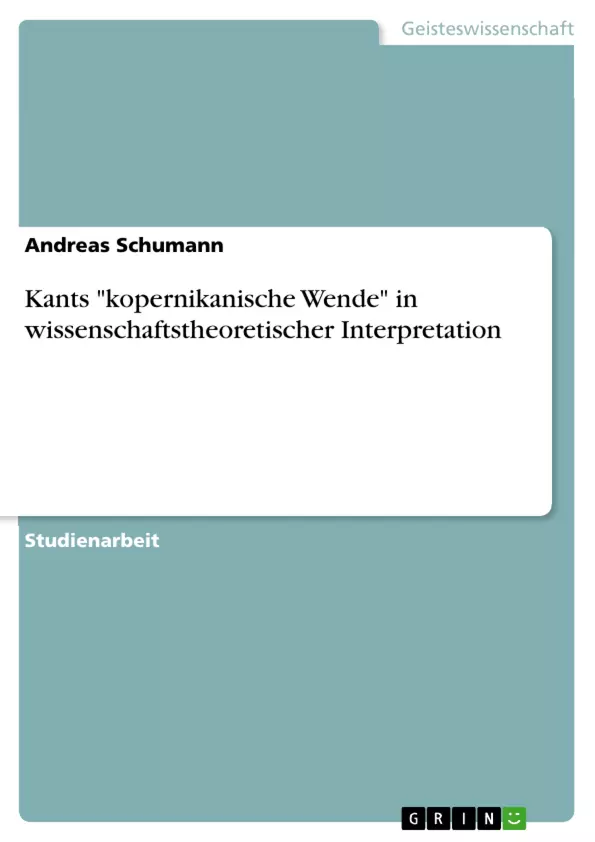Aus erkenntnistheoretischer Perspektive gelingen selbst alltägliche Problemlösungen häufig erst durch eine Wende in der Betrachtung der beobachteten Phänomene: Man „versuche es daher einmal“, ob man nicht nach Einstellen erfolgloser Probierversuche und stattdessen durch Aufstellen einer zuvor noch nicht in Betracht gezogenen alternativen Hypothese, diese weiter zu überprüfen und „damit besser fortkommen“ möge. Dieser aus Vernunft begründete Perspektivenwechsel kann als ein intuitiver Schritt verstanden werden, wie er sich mit der kopernikanischen Wende vollzieht. Tatsächlich verbindet man traditionell Kants erste Kritik mit einer subjektivistischen erkenntnistheoretischen Wende, die als kopernikanisch bezeichnet wird. In der Vorrede zur 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft (im weiteren Text: „B-Vorrede“) taucht der Name des Copernicus auf. Dessen astronomischer wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt wird mit dieser Wende analogisch komplementiert.
Zur Interpretation der „kopernikanischen Wende“ existieren Lesarten mit dem angedeuteten erkenntnistheoretischen Fokus. Gegenwärtig präsentiert sich nun eine alternative Sichtweise, die man als wissenschaftstheoretische Interpretation bezeichnen kann. Der Vorteil, den diese Position aufweist, beruht auf der Methode, mit der die Plausibilität der Argumente erhöht und anhand historischer Textquellen belegt werden kann. Die Integration des Ergebnisses in Kants philosophisch-biographischen Werdegang ist eine weitere Stärke. Die Ausstrahlung der von Kant erarbeiteten Kritik der praktischen Vernunft auf sein eigenes inzwischen verändertes Denken lässt sich hierin nachvollziehen.
Das Ziel meiner Arbeit liegt darin, diese Interpretationslinie nachzuzeichnen und ihre über die erkenntnistheoretische Sicht hinaus weitergehende Stimmigkeit mittels der argumentativen Beiträge hierzu zu unterstreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Problem und Ziele
- Zum Ereignis der kopernikanischen Wende
- Zur Metaphorik der „kopernikanischen Wende“
- Wandel des Revolutionsbegriffs
- Bedeutungswandel der Metapher
- Kants kopernikanische Wende in der B-Vorrede
- Frühe begriffliche Verwendung des „Copernicanischen“
- Der sichere Gang der Wissenschaften”
- Erfolgreichere Wissenschaften
- Die wissenschaftstheoretische Interpretation
- „Erste Gedanken des Copernicus“: eine wissenschaftliche Hypothese
- Die Analogie zu Kants „praktischen Data“
- Die intertextuell-historische Lesart der Wende
- Galilei, Torricelli, Stahl: Das „Licht“ der Wende
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der „kopernikanischen Wende“ bei Immanuel Kant aus wissenschaftstheoretischer Perspektive. Ziel ist es, die Interpretationslinie dieser Wende als wissenschaftsmethodischen Wandel von der Induktion zur Deduktion aufzuzeigen und ihre Stimmigkeit mit argumentativen Beiträgen zu unterstreichen.
- Die kopernikanische Wende bei Kant ist nicht nur erkenntnistheoretisch zu interpretieren, sondern auch als eine wissenschaftsmethodische Wende.
- Die kopernikanische Wende ist ein entscheidender Schritt des gesamten „kritischen Geschäfts“ der kantischen Philosophie.
- Die „kopernikanische Wende“ steht als Metapher für den deduktiv erbrachten Nachweis des „Faktums der Vernunft“ in der Kritik der praktischen Vernunft.
- Die Arbeit analysiert den historischen Kontext und die wissenschaftliche Bedeutung der kopernikanischen Wende.
- Sie zeigt, wie Kant die Rolle des Kopernikus verstanden haben will, indem sie historische Texte analysiert, die seinen philosophischen Prozess beeinflusst haben.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Problem und die Ziele der Arbeit ein. Im zweiten Kapitel wird das Ereignis der kopernikanischen Wende im Kontext der Schriften von Nikolaus Kopernikus beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Metaphorik der „kopernikanischen Wende“ und ihrem Bedeutungswandel. Das vierte Kapitel untersucht Kants kopernikanische Wende in der B-Vorrede und analysiert dessen frühe begriffliche Verwendung des „Copernicanischen“. Das fünfte Kapitel präsentiert eine wissenschaftstheoretische Interpretation der kopernikanischen Wende, die sich auf Kants „praktische Data“ und intertextuelle Bezüge zu historischen Quellen stützt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die „kopernikanische Wende“ bei Immanuel Kant, ihre wissenschaftstheoretische Interpretation und ihre Rolle in der kantischen Philosophie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kopernikanische Wende, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Deduktion, Induktion, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Systemdualismus, historische Quellen, Textkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Kants „kopernikanischer Wende“?
Es bezeichnet Kants Perspektivenwechsel in der Erkenntnistheorie, bei dem sich nicht mehr die Erkenntnis nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände nach unserer Erkenntnis richten sollen.
Welchen Vorteil bietet die wissenschaftstheoretische Interpretation dieser Wende?
Sie betrachtet die Wende als methodischen Wandel von der Induktion zur Deduktion und belegt dies durch historische Textquellen und Kants philosophischen Werdegang.
Wie hängen die Kritik der reinen Vernunft und die Kritik der praktischen Vernunft hier zusammen?
Die kopernikanische Wende dient als Metapher für den deduktiven Nachweis des „Faktums der Vernunft“, der in Kants praktischer Philosophie vollendet wird.
Welche Rolle spielen Galilei, Torricelli und Stahl in Kants Argumentation?
Kant nutzt diese Wissenschaftler als Beispiele für den „sicheren Gang der Wissenschaft“, bei dem die Vernunft nur das einsehen kann, was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt.
Was bedeutet der Wandel des Revolutionsbegriffs bei Kant?
Die Arbeit analysiert, wie sich die Metaphorik der „Revolution der Denkart“ von einer rein astronomischen Analogie zu einem umfassenden wissenschaftsmethodischen Prinzip entwickelte.
- Citar trabajo
- Andreas Schumann (Autor), 2018, Kants "kopernikanische Wende" in wissenschaftstheoretischer Interpretation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429782