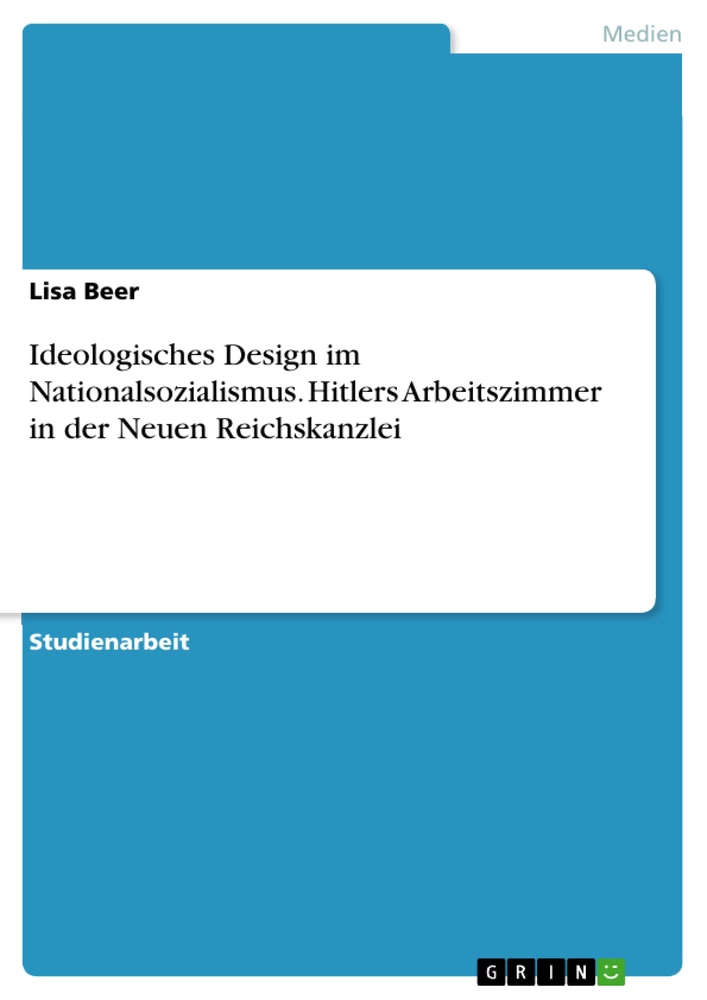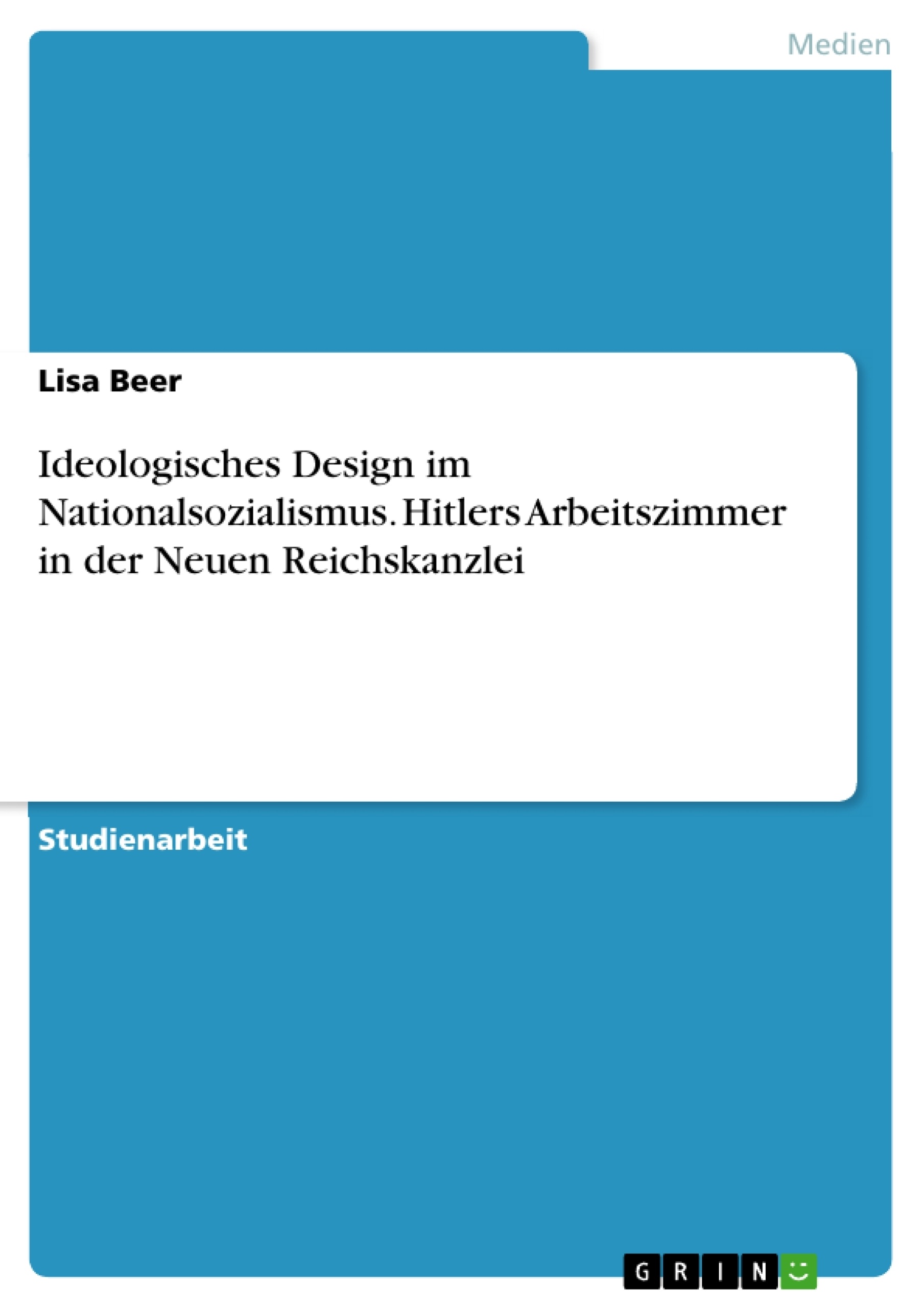Für Adolf Hitler war eine Sache von besonderer Bedeutung für die Repräsentation seines Plans eines 1000-jährigen Reichs: imposante, monumentale Bauten. Um Gedanken wie den eines Berlins als Welthauptstadt Germania in die Tat umzusetzen, brauchte es vor allem einen fähigen Architekten. Diesen fand Hitler in Albert Speer, welcher sich nicht nur als fachlich geeignet erwies, sondern auch glühender Anhänger der nationalsozialistischen Bewegung war.
Diese Arbeit soll die ideologische Aufladung von nationalsozialistischem Design untersuchen. Jedoch wird sie dabei nicht das gesamte neu gestaltete Berlin erfassen, womit man mehrere hundert Seiten füllen könnte und müsste, sondern explizit auf Hitlers Arbeitszimmer in der Neuen Reichskanzlei eingehen. Aufgrund der Bedeutung als Herz der Reichskanzlei und damit auch Nabel von Hitlers nationalsozialistischer Welt steht das Design hier besonders exemplarisch für die darin verbaute Ideologie und bietet interessante Einblicke in jene.
Im ersten Abschnitt der Arbeit erfolgt zunächst eine genauere Beschreibung der Person Albert Speers und dessen Verhältnis zu Hitler sowie des Designs in der Neuen Reichskanzlei. Die darauffolgende Interpretation soll dieses im Hinblick auf die NS-Ideologie erörtern und dabei die Auswirkungen der Rassenideologie berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung: Hitlers Arbeitszimmer in der Neuen Reichskanzlei
- Der Architekt und Innenausstatter Albert Speer und sein Verhältnis zu Hitler
- Beschreibung des Designs von Hitlers Arbeitszimmers in der Neuen Reichskanzlei
- Interpretation: Erörterung des Designs von Hitlers Arbeitszimmers in der Neuen Reichskanzlei im Hinblick auf die nationalsozialistische Ideologie und Kulturpolitik
- Grundlagen der Rassenideologie des Nationalsozialismus in Deutschland
- 'Gobineau's Rassenphilosophie' von Paul Kleineke
- Die Schriften Darwins und Chamberlains
- Weitere Ursprünge und Reflexe der Rassenideologie
- Auswirkungen der Rassenideologie auf die Kulturpolitik und Kunstproduktion zur Zeit des Nationalsozialismus
- Einfluss der NS-Ideologie auf das Design von Hitlers Arbeitszimmer
- Das Hoheitszeichen und andere Symbole des Nationalsozialismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ideologische Aufladung des Designs von Hitlers Arbeitszimmer in der Neuen Reichskanzlei, welches als Herz der Reichskanzlei und damit auch Nabel Hitlers nationalsozialistischer Welt gilt. Sie soll die Bedeutung des Designs für die nationalsozialistische Ideologie und Kulturpolitik aufzeigen.
- Die Rolle des Architekten Albert Speer und dessen Verhältnis zu Hitler
- Die Beschreibung und Analyse des Designs von Hitlers Arbeitszimmer
- Die Auswirkungen der Rassenideologie auf die Kunstproduktion und Kulturpolitik
- Der Einfluss der NS-Ideologie auf das Design von Hitlers Arbeitszimmer
- Die Symbolik des Nationalsozialismus und deren Repräsentation im Design
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Beschreibung des Architekten Albert Speer und dessen Verhältnis zu Hitler. Sie erläutert Speers Karriere und dessen Rolle bei der Gestaltung der Neuen Reichskanzlei. Im Anschluss daran wird das Design von Hitlers Arbeitszimmer im Detail beschrieben, wobei auf die Raumgestaltung, die Materialien und die Symbolik eingegangen wird.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Interpretation des Designs im Hinblick auf die nationalsozialistische Ideologie. Hier werden die Auswirkungen der Rassenideologie auf die Kunstproduktion und Kulturpolitik untersucht, sowie der Einfluss der NS-Ideologie auf das Design von Hitlers Arbeitszimmer.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Design, Architektur, Nationalsozialismus, Ideologie, Rassenideologie, Kulturpolitik, Albert Speer, Hitler, Neue Reichskanzlei, Arbeitszimmer, Symbolik, Hoheitszeichen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatte Hitlers Arbeitszimmer in der Neuen Reichskanzlei?
Es galt als das „Herz“ der Reichskanzlei und als Nabel der nationalsozialistischen Welt, weshalb sein Design explizit zur Repräsentation der NS-Ideologie gestaltet wurde.
Wer war für das Design und die Architektur verantwortlich?
Albert Speer, Hitlers bevorzugter Architekt und glühender Anhänger der Bewegung, entwarf das Arbeitszimmer sowie die gesamte Neue Reichskanzlei.
Wie spiegelte sich die Rassenideologie im Design wider?
Die Arbeit untersucht, wie Konzepte wie Monumentalität und bestimmte Symbole (Hoheitszeichen) die Überlegenheit der „arischen Rasse“ und den Machtanspruch des Regimes untermauern sollten.
Was war das Ziel von Hitlers Bauplänen für Berlin?
Hitler plante, Berlin zur Welthauptstadt „Germania“ auszubauen, mit imposanten, monumentalen Bauten, die den Bestand eines „1000-jährigen Reichs“ symbolisieren sollten.
Welche Symbole wurden im Arbeitszimmer verwendet?
Neben dem Hakenkreuz als Hoheitszeichen wurden verschiedene Materialien und gestalterische Elemente genutzt, um Autorität, Stärke und die nationalsozialistische Kulturpolitik auszudrücken.
Welche Schriften beeinflussten die NS-Rassenideologie?
Die Arbeit nennt unter anderem die Rassenphilosophie von Gobineau sowie die Schriften von Chamberlain und Darwin-Interpretationen als Ursprünge der Ideologie.
- Quote paper
- Lisa Beer (Author), 2018, Ideologisches Design im Nationalsozialismus. Hitlers Arbeitszimmer in der Neuen Reichskanzlei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429828