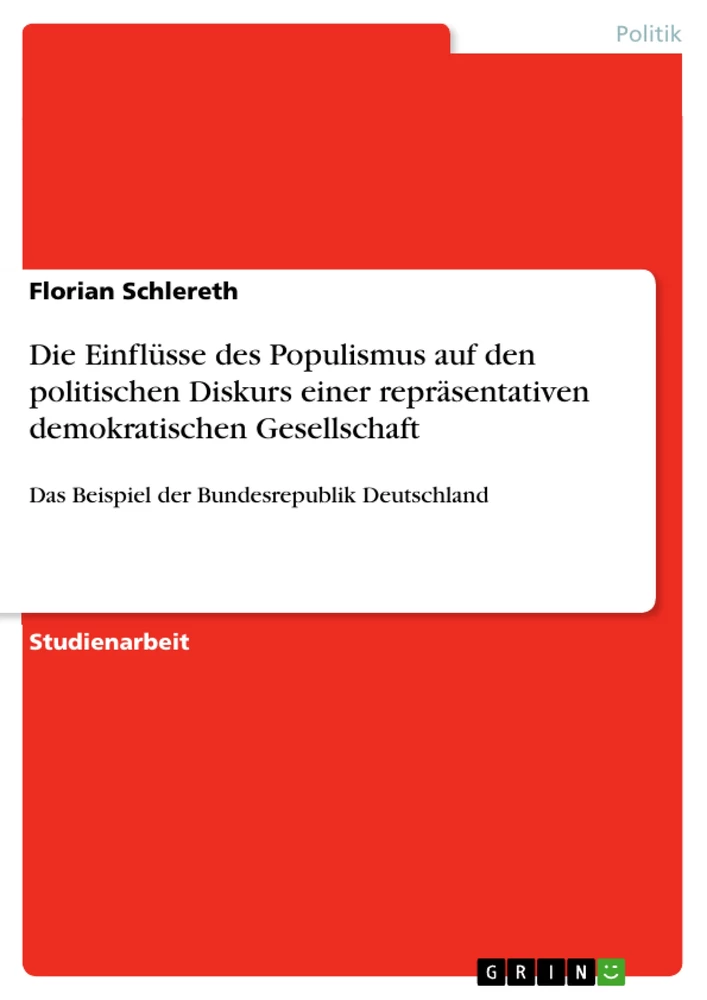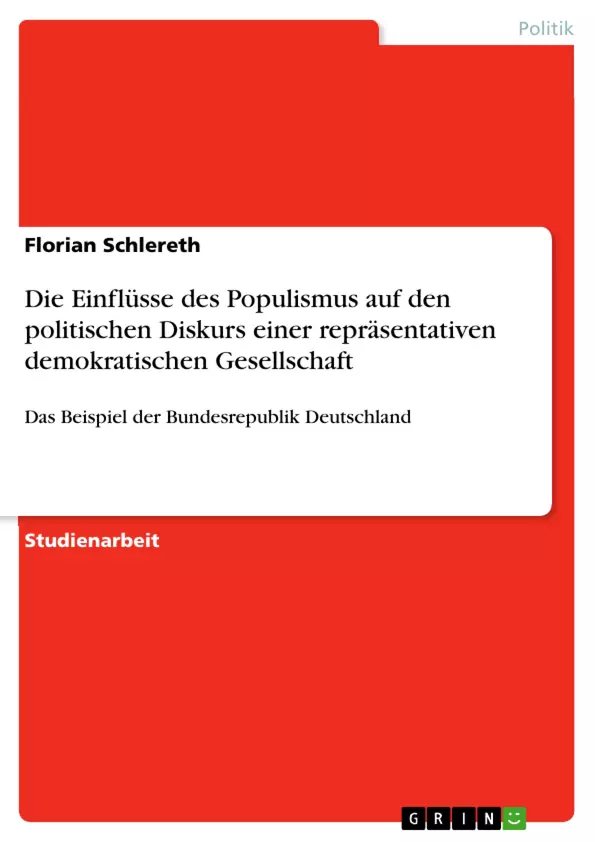Die vorliegende Arbeit untersucht, ob der Populismus als solcher per se eine Gefahr für die Demokratie ist. Als zentrales Beispiel einer demokratischen Gesellschaft dient die Bundesrepublik Deutschland. Dazu nähert sich die Arbeit zunächst dem Populismusbegriff an, gibt eine Überblick über die Verwendung des Begriffs und grenzt ihn von (politischem) Extremismus ab. Anschließend werden Populismusformen in Deutschland vorgestellt, auf denen eine Einschätzung der positiven und negativen Einflüsse des Populismus in demokratischen Gesellschaften erörtert werden. Schlussendlich wird das Gefahrenpotenzial des Populismus eingeschätzt.
Inhaltsverzeichnis
- Ein Gespenst geht um in Europa...
- Theoretische Annäherungen an den Begriff Populismus.
- Einleitende Anmerkungen
- Definition des Begriffs Populismus
- Verwendung des Begriffs im politischen Diskurs in Deutschland.
- Abgrenzung vom Extremismus
- Populismus in der modernen demokratischen Gesellschaft Deutschlands.
- Vorüberlegungen…
- Varianten des Populismus in Deutschland.
- Einflüsse des Populismus auf eine repräsentative demokratische Gesellschaft
- Anmerkungen zur weiteren Vorgehensweise.
- Positive Einflüsse des Populismus
- Negative Einflüsse des Populismus
- Einschätzung des Gefahrenpotenzials des Populismus für die repräsentative Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland
- Mehr Gelassenheit im Umgang mit Populismus..
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Populismus
- Verwendung und Perzeption des Begriffs im politischen Diskurs in Deutschland
- Einflüsse des Populismus in Deutschland
- Einschätzung des Gefahrenpotenzials des Populismus für die repräsentative Demokratie
- Zusammenhang zwischen Populismus und Extremismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich der Frage, ob Populismus per se eine Gefahr für die repräsentative Demokratie ist oder evtl. zu einer werden könnte. Dazu werden zunächst theoretische Annäherungen an den Begriff Populismus vorgestellt, einschließlich Abgrenzung von ähnlichen Phänomenen wie Extremismus. Anschließend wird die Verwendung des Begriffs im politischen Diskurs in Deutschland beleuchtet, um Rückschlüsse auf Akzeptanz und Wirkweisen des Populismus zu ermöglichen. Schließlich werden die Einflüsse des Populismus in Deutschland exemplarisch betrachtet, und eine Einschätzung des Gefahrenpotenzials des Populismus für die repräsentative Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland wird vorgenommen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der theoretischen Annäherung an den Begriff Populismus. Es werden verschiedene Definitionsansätze vorgestellt, die von negativen Politikstilen bis hin zu soziopolitischen Bewegungen mit Massenbasis reichen. Das Kapitel beleuchtet auch die historischen Wurzeln des Begriffs und seine vielfältigen Untertypen. Der zweite Teil des Buches gibt einen Überblick über die Spielarten und Ausprägungen des Populismus im politischen und gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland.
Schlüsselwörter
Populismus, repräsentative Demokratie, politische Diskurse, Deutschland, Extremismus, Einflüsse des Populismus, Gefahrenpotenzial.
Häufig gestellte Fragen
Ist Populismus grundsätzlich eine Gefahr für die Demokratie?
Die Arbeit untersucht, ob Populismus eine Gefahr darstellt oder auch korrigierend wirken kann, indem er vernachlässigte Themen anspricht.
Wie unterscheidet sich Populismus von politischem Extremismus?
Populismus zielt oft auf die Mobilisierung der „Masse“ gegen eine „Elite“ ab, während Extremismus die demokratische Grundordnung als Ganzes ablehnt.
Welche positiven Einflüsse kann Populismus haben?
Er kann die politische Beteiligung erhöhen und etablierte Parteien zwingen, sich mit den Sorgen breiterer Bevölkerungsschichten auseinanderzusetzten.
Was sind die negativen Auswirkungen von Populismus?
Negativ sind die Vereinfachung komplexer Probleme, die Spaltung der Gesellschaft und die Diskreditierung demokratischer Institutionen.
Wie wird Populismus im deutschen politischen Diskurs wahrgenommen?
Der Begriff wird oft als Kampfbegriff zur Abwertung politischer Gegner verwendet, was eine sachliche Auseinandersetzung erschwert.
- Quote paper
- Florian Schlereth (Author), 2018, Die Einflüsse des Populismus auf den politischen Diskurs einer repräsentativen demokratischen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429896