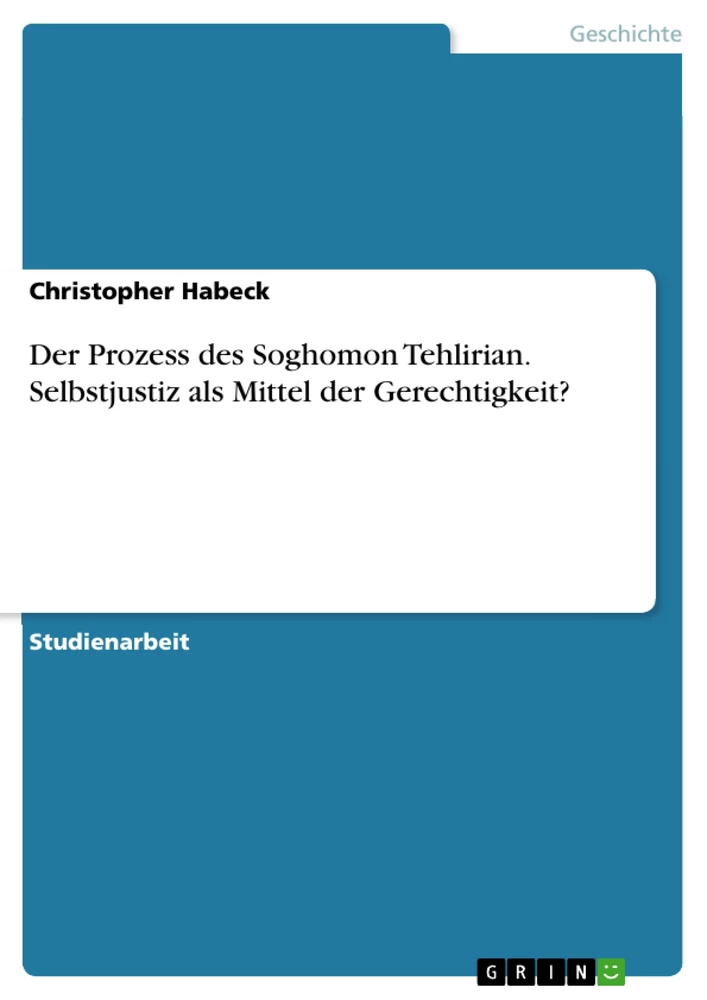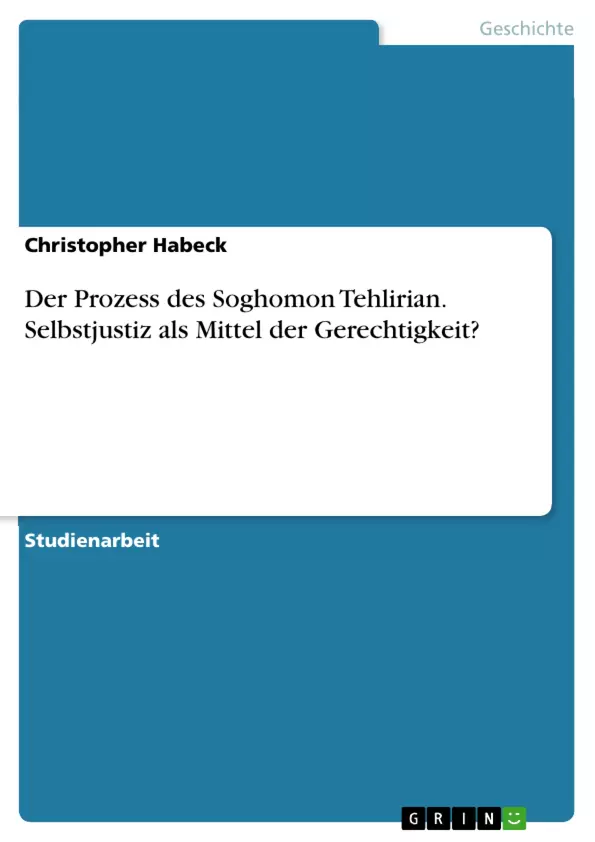Heute ist bekannt, dass sich Tehlirian 1920 der Operation Nemesis anschloss, die das Ziel hatte, Selbstjustiz zu betreiben. Aber welche Motive hatte er, Talât Paşa zu töten? Warum beteiligte er sich an der Attentatskampagne? Welche Vorfälle verleiten einen Menschen zu einer solchen Tat? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit.
Dr Johannes Werthauer verglich in seinem Verteidigungsplädoyer eindrucksvoll den Armenier Soghomon Tehlirian mit Wilhelm Tell, der als Tyrannenmörder gefeiert wurde. Auch Tehlirian, der den Großwesir der Jungtürken Mehmed Talât Paşa am 15. März 1921 in Berlin erschossen hatte, wurde nicht verurteilt. Dieser Freispruch wurde zwar nicht so zelebriert wie der tödliche Armbrustschuss Wilhelm Tells, aber dennoch stand die Presse dem Urteil überwiegend positiv gegenüber. Es sei der „erste wirkliche Kriegsverbrecherprozeß“, der eine „große moralpolitische Wirkung“ erzielen müsse.
Aber Tehlirian wurde nicht wegen des Mordes eines Kriegsverbrechers freigesprochen, sondern nach §51 StGB, da er vermutlich zur Tatzeit nicht wusste, was er tat, weil er unter „psychasthenische[r] Epilepsie“ litt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte
- Komitee für Einheit und Fortschritt
- Operation Nemesis
- Der Prozess des Soghomon Tehlirian
- Politische und juristische Auswirkungen
- Selbstjustiz als Mittel der Gerechtigkeit?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Attentat von Soghomon Tehlirian auf den Großwesir der Jungtürken Mehmed Talât Paşa im Jahr 1921 in Berlin. Sie analysiert das Attentat im Kontext der Geschichte des Osmanischen Reiches und der armenischen Frage sowie der politischen und juristischen Auswirkungen des Prozesses gegen Tehlirian.
- Die Geschichte des Osmanischen Reiches und die Lage der Armenier im 19. Jahrhundert
- Die Rolle des Komitees für Einheit und Fortschritt (CUP) im Völkermord an den Armeniern
- Der Prozess gegen Soghomon Tehlirian und seine politische und juristische Bedeutung
- Die Frage der Selbstjustiz im Kontext von Völkermord und Kriegsverbrechen
- Die Auswirkungen des Prozesses auf die internationale Diskussion um Völkermord und Kriegsverbrechen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Prozess des Soghomon Tehlirian vor und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit: Was waren Tehlirians Motive für den Mord an Talât Paşa? War das Attentat juristisch und moralisch vertretbar?
- Vorgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Attentats. Es beschreibt die Lage der Armenier im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert, den Aufstieg des Komitees für Einheit und Fortschritt (CUP) und dessen Rolle im Völkermord an den Armeniern.
- Der Prozess des Soghomon Tehlirian: Dieses Kapitel fokussiert auf den Prozess gegen Tehlirian. Es analysiert die Aussagen Tehlirians, die Beweise der medizinischen Sachverständigen und die Plädoyers der Verteidigung. Zudem werden die politischen und juristischen Auswirkungen des Prozesses untersucht.
- Selbstjustiz als Mittel der Gerechtigkeit?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der Selbstjustiz im Kontext des Attentats. Es beleuchtet verschiedene Perspektiven auf das Attentat und diskutiert die Argumentation von Raphael Lemkin und David Luban zum Thema der Bestrafung von Verbrechen gegen die Menschheit.
Schlüsselwörter
Armenien, Osmanisches Reich, Völkermord, Komitee für Einheit und Fortschritt (CUP), Operation Nemesis, Selbstjustiz, Kriegsverbrechen, Prozess, Tehlirian, Talât Paşa, Recht, Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Soghomon Tehlirian?
Tehlirian war ein Armenier, der 1921 in Berlin den ehemaligen Großwesir des Osmanischen Reiches, Mehmed Talât Paşa, erschoss.
Was war das Ziel der „Operation Nemesis“?
Das Ziel dieser Geheimoperation war es, Selbstjustiz an den Verantwortlichen des Völkermords an den Armeniern zu üben.
Warum wurde Tehlirian trotz des Mordes freigesprochen?
Der Freispruch erfolgte nach §51 StGB, da medizinische Gutachter eine „psychasthenische Epilepsie“ feststellten und er zur Tatzeit als schuldunfähig galt.
Welche politische Bedeutung hatte der Prozess in Berlin?
Die Presse bezeichnete ihn als den „ersten wirklichen Kriegsverbrecherprozess“, der eine große moralpolitische Wirkung hinsichtlich der armenischen Frage erzielte.
Wie wird die Selbstjustiz in diesem Fall bewertet?
Die Arbeit diskutiert, ob das Attentat als Mittel der Gerechtigkeit im Kontext von Völkermord und fehlender internationaler Strafverfolgung moralisch vertretbar war.
- Arbeit zitieren
- Christopher Habeck (Autor:in), 2018, Der Prozess des Soghomon Tehlirian. Selbstjustiz als Mittel der Gerechtigkeit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429913