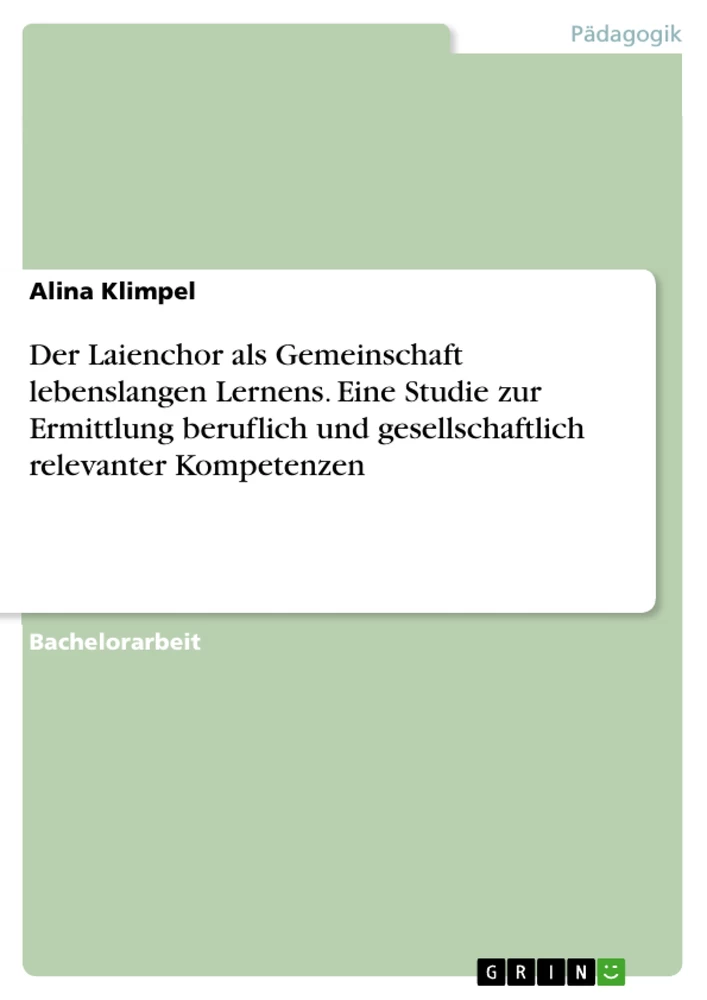Die vorliegende Arbeit widmet sich der Erforschung dessen, welche Lernprozesse ein gemeinsames Musizieren heutzutage fördert. Hierzu werden zwei Laienchöre danach untersucht, welche Kompetenzen eine Mitgliedschaft hervorbringen und wie diese anerkannt werden können. Dadurch, dass bisher bevorzugt formale Abschlüsse dem Deutschen Qualifikationsrahmen zugeordnet wurden, wird dem nichtformalen Bildungsbereich nicht nur das Recht auf Ebenbürtigkeit versagt, er wird sogar benachteiligt, da Inhabern dieser Lernleistungen nicht die gleichen Vorteile einer europaweiten Mobilität zur Verfügung stehen. Diese Arbeit ist in einen theoretischen Teil, der den Forschungsprozess durch Analyse von Studien, Theorien und aktuellen Befunden begründet und fundiert und einen empirischen Teil, der die Durchführung der Studie sowie deren Ergebnisse zusammenstellt, aufgeteilt. Kap. 2 beinhaltet eine Definition und Darstellung der Entwicklung lebenslangen Lernens, bevor auf die individuelle Bedeutung des LLL eingegangen wird.
Ugah, ugah, bumm, bumm, bumm! Was aus heutiger Sicht als eine primitive, bisweilen süffisante Form des menschlichen Ausdrucks erscheinen mag, ebnete lange Zeit, bevor sprachlich präzise Repräsentationssysteme Hochkulturen und damit gesellschaftlichen Fortschritt ermöglichten, intragruppale Kohäsion: Die Rede ist vom gemeinsamen Musizieren, das durch stetige Weiterentwicklung zu einer bedeutsamen Form der modernen Kunst gewachsen ist. In ihrer holistischen Natur diente Musik als sprachliches Subelement im Zeitalter der Ur- und Naturvölker primär dem Überleben, während sie gegenwärtig vielmehr als Genussform in Erscheinung tritt. Als ein frühzeitliches Mittel „to express and induce emotions and to develop group identities“ kann sie – angelehnt an die amerikanische Reformpädagogik des Pragmatismus als relevantes System für die Entwicklung menschlichen Gemeinschaftslebens angesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lebenslanges und non-formales Lernen
- Die politische Entwicklung lebenslangen Lernens in Deutschland
- Zur individuellen Bedeutung lebenslangen Lernens
- Lernarten
- Non-formales LLL durch kulturelle Bildung
- Lernen aus sozialkonstruktivistischer und pragmatistischer Perspektive
- Pragmatismus und Konstruktivismus
- Pragmatismus
- Pragmatismus nach Dewey
- Die Idee der Gemeinschaft nach John Dewey
- Konstruktivismus
- Sozialer Konstruktivismus nach Kersten Reich
- Lernen in und durch Gemeinschaften
- Pragmatismus und Konstruktivismus
- Kompetenzen
- Aktuelle Situation in Deutschland
- Kompetenzarten
- Informelle und non-formale Kompetenzen - vom Erwerb zur Anerkennung
- EQR und DQR als Instrumente zur Anerkennung von Bildungs-leistungen
- Zusammenfassung
- Der Laienchor als Ort des lebenslangen Gemeinschaftslernens und Kompetenzerwerbs
- Aktuelle Situation
- Bildung und Barrieren
- Konklusion
- Zwischenfazit
- Einleitung und Methoden der Datenerfassung und -auswertung
- Der Fragebogen als Forschungsinstrument
- Auswahl der Probanden
- Fragebogenkonstruktion
- Durchführung
- Auswertung und Ergebnisse
- Auswertungsmethode
- Ergebnisse
- Empfehlungen zur Aufnahme in den DQR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht die Lernprozesse, die durch gemeinsames Musizieren in Laienchören gefördert werden. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die beruflich und gesellschaftlich relevanten Kompetenzen aufzudecken, die durch eine Mitgliedschaft in einem Laienchor erworben werden. Dabei werden zwei Laienchöre analysiert und die Möglichkeiten der Anerkennung dieser Kompetenzen im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) diskutiert.
- Lebenslanges Lernen und Non-formales Lernen
- Kompetenzentwicklung in Laienchören
- Anerkennung von Kompetenzen aus dem non-formalen Bereich
- Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)
- Soziale und kognitive Kompetenzen im Kontext musikalischer Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand – das Musizieren in Laienchören als Form des lebenslangen Lernens – einführt und die Relevanz der Thematik erläutert.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Konzept des lebenslangen Lernens (LLL) und beleuchtet dessen politische Entwicklung in Deutschland sowie die individuelle Bedeutung. Es werden verschiedene Lernarten definiert und der Laienchor als Ort des non-formalen LLL im Bereich der kulturellen Bildung eingeordnet.
In Kapitel 3 werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit aus sozialkonstruktivistischer und pragmatistischer Perspektive beleuchtet, mit einem Schwerpunkt auf Deweys Pragmatismus und dem sozialen Konstruktivismus nach Kersten Reich. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Konzept der Kompetenzen, insbesondere den informellen und non-formalen Kompetenzen, die im Kontext des Laienchores erworben werden. Darüber hinaus werden der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) und der DQR als Instrumente zur Anerkennung von Bildungs-leistungen vorgestellt.
Kapitel 5 analysiert den Laienchor als Ort des lebenslangen Gemeinschaftslernens und Kompetenzerwerbs, beleuchtet die aktuelle Situation sowie die Bildungs- und Barrieren, die mit einer Mitgliedschaft in einem Laienchor verbunden sein können.
Kapitel 6 stellt ein Zwischenfazit der bisherigen Ausführungen dar.
Kapitel 7 führt in die Methoden der Datenerfassung und -auswertung ein. Kapitel 8 beschreibt die Konstruktion und Durchführung des Fragebogens als Forschungsinstrument.
Kapitel 9 befasst sich mit der Auswertung der gewonnenen Daten und stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar.
Das Kapitel über Empfehlungen zur Aufnahme in den DQR ist nicht in dieser Vorschau enthalten.
Schlüsselwörter
Lebenslanges Lernen, Non-formales Lernen, Laienchor, Kompetenzen, Bildung, Gemeinschaft, Sozialer Konstruktivismus, Pragmatismus, Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR)
Häufig gestellte Fragen
Was lernt man in einem Laienchor außer Singen?
Man erwirbt soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Empathie sowie kognitive Fähigkeiten und Disziplin im Rahmen des lebenslangen Lernens.
Was ist der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)?
Der DQR ist ein Instrument zur Einordnung von Qualifikationen aus allen Bildungsbereichen, um Transparenz und Vergleichbarkeit von Kompetenzen in Europa zu schaffen.
Warum wird non-formale Bildung oft benachteiligt?
Da bisher primär formale Abschlüsse (Schule, Uni) im Fokus standen, fällt es schwerer, informell erworbene Kompetenzen (wie aus dem Chor) offiziell anzuerkennen.
Welche Rolle spielt John Deweys Pragmatismus in dieser Studie?
Deweys Theorie betont das Lernen in der Gemeinschaft und durch Erfahrung, was die soziale Natur des gemeinsamen Musizierens theoretisch untermauert.
Können Chorkompetenzen beruflich relevant sein?
Ja, Soft Skills wie Verlässlichkeit, Gruppenkoordination und Ausdauer sind in vielen Berufsfeldern hoch angesehen und werden im Chor intensiv trainiert.
- Arbeit zitieren
- Alina Klimpel (Autor:in), 2018, Der Laienchor als Gemeinschaft lebenslangen Lernens. Eine Studie zur Ermittlung beruflich und gesellschaftlich relevanter Kompetenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430197