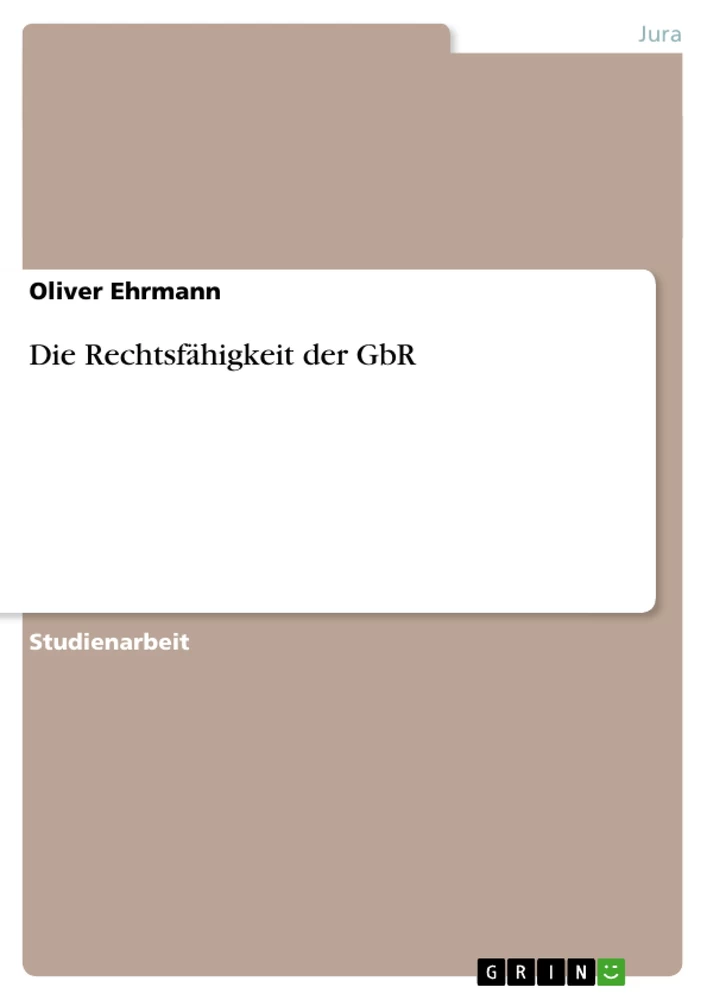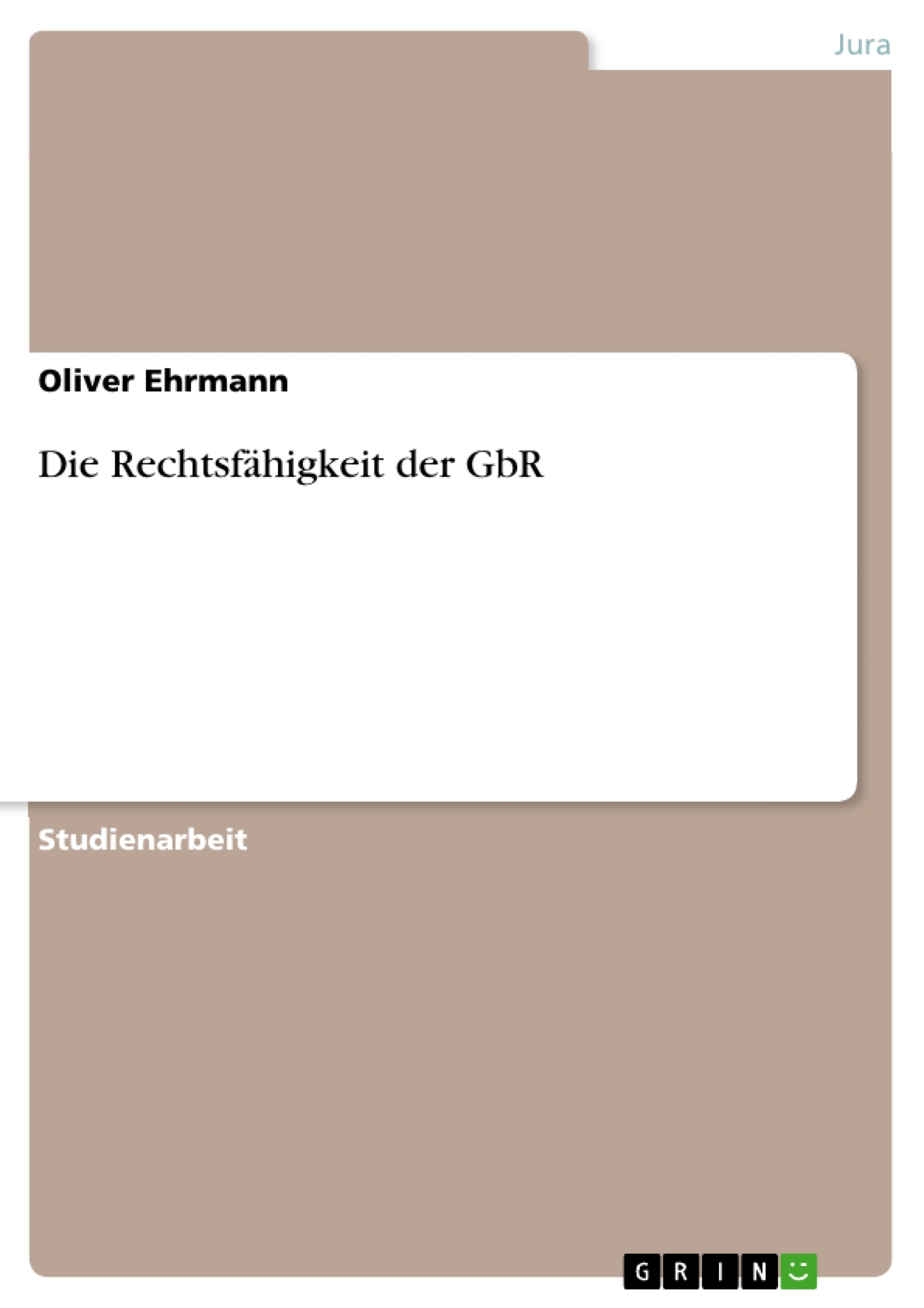Zu Beginn
1. Die bürgerlich-rechtliche Gesellschaft als unvollkommen normierte Form
Die bürgerlich-rechtliche Gesellschaft1, wie sie in §§705 ff BGB2 als Grundform der Personengesellschaft geregelt ist, überwiegt alle anderen Gesellschaftsformen an praktischer Bedeutung im Wirtschaftsleben. Das liegt zum einen an der Flexibilität dieser Form des Zusammenschlusses, die Ausgestaltungen von der nur als Innengesellschaft bestehenden Ehegatten-GbR über freiberufliche Praxis- und Kanzleigemeinschaften und ARGE bin hin zu höherstufigen, unternehmenstragenden GbR zulässt, zum anderen daran, dass keine Gesellschaftsform3 so leicht zugänglich ist, d.h. ohne umfangreichen finanziellen oder administrativen Aufwand zu errichten.
Umso schwerer wiegt der Umstand, das grundlegende, nicht nur rechtstheoretische bedeutsame Umstände der GbR weder vom historischen Gesetzgeber, noch von späteren Generationen abschließend geregelt wurden und somit über Jahrzehnte ,,Dauerbrenner" der Diskussion und Rechtsfortbildung geblieben sind. Letztlich entsprechen die Regelungen des 16. Titel im 2. Buch des BGB noch der ursprünglich vorrausgesetzten, rein schuldrechtlichen Konstruktion der Gesellschaft4.
Ursprung dieser Unklarheiten ist der lange und heftig geführte Streit um das Institut der gesellschaftsrechtlichen Gesamthand, das in den europäischen Rechtsordnungen seinesgleichen sucht. Nachdem man von der GbR als reines Schuldverhältnis unter den Gesellschaftern Abstand genommen hatte und ihr in §§ 718, 719 als Vermögensverfassung die Gemeinschaft zur gesamten Hand zugrundelegte, beließen es die Autoren des BGB bei der lakonischen Feststellung, ,,zu der wissenschaftlichen Streitfrage über das Wesen der gesamten Hand nicht Stellung nehmen zu sollen5". Aus den unterschiedlichen Ausgestaltungen und Bestimmungen dieses positiv nicht normierten Instituts ergeben sich die entsprechenden Positionen zu den aktuellen Problemen im Recht der GbR, zur Vermögensverfassung und Rechtsfähigkeit, zur aktiven und passiven Parteifähigkeit, zur Haftungsordnung.
[...]
______
1 Im folgenden GbR.
2 Alle folgende Paragraphen, sofern nicht anders gekennzeichnet, sind solche des BGB.
3 Mit Ausnahme des nichtrechtsfähigen Vereins.
4 Flume ZHR 136, S. 178f.
5 Prot. II, 429, zit. nach Flume, ZHR 136, S. 177, 178.
6 Az II ZR 331/00; NJW 2001, 1056.
Inhaltsverzeichnis
- Zu Beginn
- Die bürgerlich-rechtliche Gesellschaft als unvollkommen normierte Form
- Gegenstand und Gang der Untersuchung
- Von der deutschrechtlichen zur „neueren“ Gesamthandslehre - ein umstrittenes Institut
- Erste Stimmen pro Rechtssubjektivität
- Gesellschaft und Gesamthand
- Vom Sondervermögen zum Rechtssubjekt
- Bisherige Rechtsprechung
- Senate
- Die GbR als Gesellschafter - II. Senat des BGH
- Sonstige Beteiligung am Rechtsverkehr - andere
- Das aktuelle Urteil zur Rechts- und Parteifähigkeit
- Ausgewählte Problemfelder
- Gesellschafterwechsel
- Innenverhältnis
- Außenverhältnis
- Haftungsfragen
- Rechtsformwandel
- Gesellschafterwechsel
- Gesetzesverträglichkeit
- Die Gesellschaft im BGB
- Insolvenzordnung
- Vollstreckung in das Gesellschaftsvermögen
- Zwischenergebnis
- Abgrenzungsprobleme
- Senate
- Bisherige Rechtsprechung
- Schluß
- Folgeprobleme
- Mangelnde Publizität
- Grundbucheintragung
- GbR als Gesellschafterin einer OHG/KG
- Erbfähigkeit
- Mangelnde Publizität
- Ausblick - Die GbR auf dem Weg zur juristischen Person?
- Folgeprobleme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und analysiert die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf die Frage, ob die GbR als Rechtssubjekt betrachtet werden kann. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Rechtsprechung vom Sondervermögen zur Rechtssubjektivität und den damit verbundenen Problemen und Herausforderungen.
- Entwicklung der Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit der GbR
- Bewertung der Rechtsprechung des BGH zur Rechtssubjektivität der GbR
- Analyse der Problemfelder im Zusammenhang mit der Rechtsfähigkeit der GbR
- Diskussion der Folgen der Rechtsfähigkeit der GbR für den Rechtsverkehr
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
- Zu Beginn: Dieses Kapitel stellt die GbR als unvollkommen normierte Form vor und definiert den Gegenstand und die Methodik der Untersuchung.
- Von der deutschrechtlichen zur „neueren“ Gesamthandslehre - ein umstrittenes Institut: Hier werden die ersten Stimmen, die sich für die Rechtssubjektivität der GbR ausgesprochen haben, sowie die Verbindung von Gesellschaft und Gesamthand diskutiert.
- Vom Sondervermögen zum Rechtssubjekt: Dieses Kapitel analysiert die bisherige Rechtsprechung zum Thema, insbesondere die Entscheidungen des BGH, und beleuchtet das aktuelle Urteil zur Rechts- und Parteifähigkeit der GbR. Außerdem werden ausgewählte Problemfelder wie Gesellschafterwechsel, Haftungsfragen und Rechtsformwandel behandelt.
- Schluß: Dieser Abschnitt geht auf Folgeprobleme wie die mangelnde Publizität und die Erbfähigkeit der GbR ein und bietet einen Ausblick auf die mögliche Entwicklung der GbR hin zu einer juristischen Person.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Rechtssubjektivität, Gesamthandslehre, Sondervermögen, BGH-Rechtsprechung, Gesellschafterwechsel, Haftungsfragen, Rechtsformwandel, Publizität und Erbfähigkeit.
- Quote paper
- Oliver Ehrmann (Author), 2002, Die Rechtsfähigkeit der GbR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4303