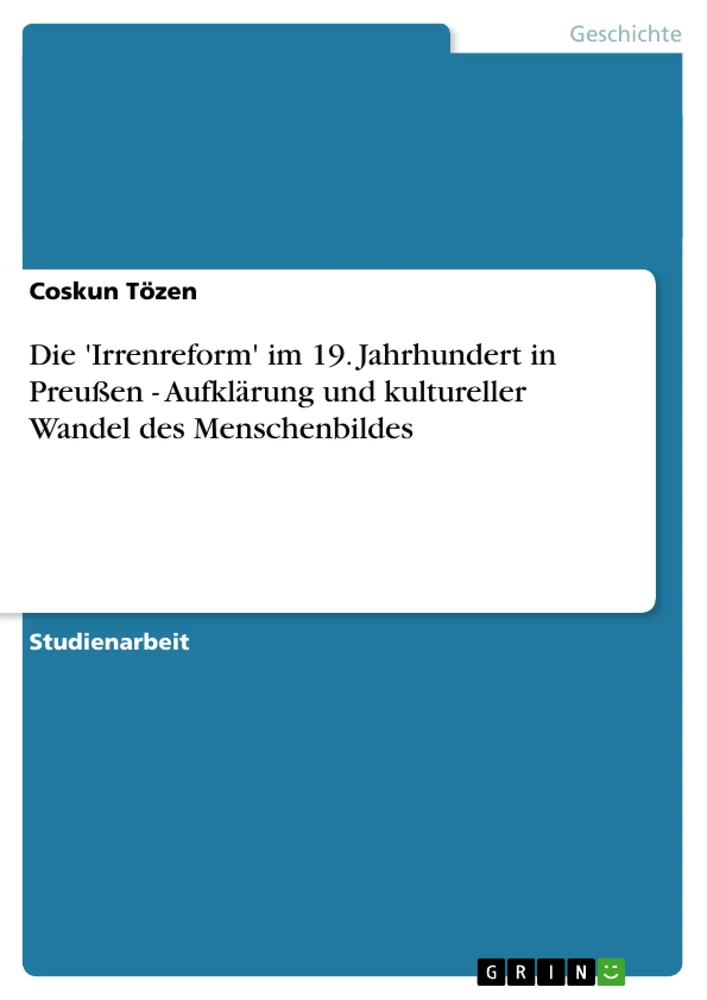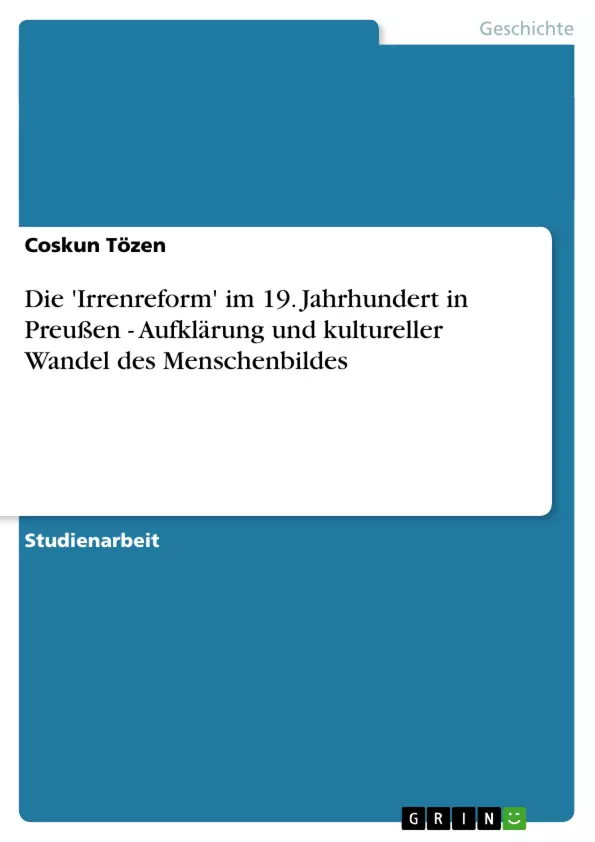In dieser Arbeit werden die Inhalte der Irrenreform in Preußen im 19. Jahrhundert aufgezeigt. Ferner wird danach gefragt, welche gesellschaftlichen Gruppen diesen Reformprozess in Gang gebracht haben, gegen welche Widerstände und mit welchen Motiven. Außerdem wird der Frage nachgegangen, welche gesellschaftlichen Veränderungen zu einem anderen Umgang mit ‚Irren‘ beigetragen haben.
Während im 18. Jahrhundert letztlich kaum ein Unterschied in der Behandlung und Unterbringung von als irre und wahnsinnig geltenden Personen zu anderen Randgruppen gemacht wurde, änderte sich dieses im 19. Jahrhundert. Diese Veränderungen weisen sowohl auf Wandlungen der Normen und des Menschenbildes der Gesellschaft als auch allgemein auf eine zunehmende gesellschaftliche Komplexität bzw. Differenzierung hin.
In der einschlägigen Literatur zu diesem Thema gibt es verschiedene Positionen, die im Widerstreit miteinander liegen. Eine allgemeine Kritik der neueren Forschungen bemängelt den Fokus der älteren, welche die gesamtgesellschaftliche Tragweite reduzierten und nicht kritisch genug an das Thema herangingen. In der Kritik stehen dabei medizinhistorische Ansätze und die Psychiatrie-Geschichtsschreibung. Die sozialgeschichtliche Aufarbeitung dieses Themas betont den gesamtgesellschaftlichen Kontext, aus dem diese Prozesse nicht herauszulösen seien. Diese Perspektive wird durch die Tatsache bestärkt, dass Irrenreformen in dieser Zeit nicht ein spezifisches Phänomen in den deutschen Ländern darstellen, sondern alle ‚westlichen‘ Länder betreffen. (Vgl. Blasius, S. 21ff.) Damit erweist sich das ‚Irrenproblem‘ als Charakteristikum sich industrialisierender Länder – zeitliche Unterschiede in der Durchsetzung ähnlicher Reformen in den angehenden Industriegesellschaften sind somit durch zeitliche Unterschiede im Industrialisierungsprozess und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Transformation begründet. (Vgl. Blasius, S. 23ff.) Ferner begründet sich durch den gesamtgesellschaftlichen Kontext eine mentalitätsgeschichtliche Herangehensweise an die Thematik. Die zentrale gesellschaftliche Bedeutung der Irrenfrage - trotz der Marginalität der Anzahl der Irren im Vergleich mit den Armen - spiegelt sich auch in der Frage, warum „...die Irrengesetzgebung allen anderen Fürsorgemaßnahmen um fünfzig Jahre vorauslief und sie an Systematizität übertraf?“ ( Blasius, S. 23)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die,Irrenreform' im 19. Jahrhundert - Ein Überblick
- 1.1. Begriffsdefinition: Irre
- 1.2. Anstaltspsychiatrie versus Universitätspsychiatrie
- 1.3. Hauptformen des Wahnsinns im 19. Jahrhundert
- 1.4. Aufklärung und der veränderte Blick auf den Menschen
- 2. Die administrativ durchgesetzte Entwicklung des Irrenwesens im 19. Jahrhundert
- 2.1. Das Beispiel Siegburg
- 2.2. Das preußische Einweisungsverfahren
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Inhalte der Irrenreform in Preußen im 19. Jahrhundert und untersucht die gesellschaftlichen Gruppen, die den Reformprozeß initiierten, sowie die Widerstände und Motive, die damit verbunden waren. Darüber hinaus untersucht sie die gesellschaftlichen Veränderungen, die zu einem anderen Umgang mit „Irren“ beigetragen haben.
- Entwicklung der Irrenreform im 19. Jahrhundert
- Institutionelle Veränderungen im Irrenwesen
- Veränderung des Menschenbildes in der Aufklärung
- Einfluss von gesellschaftlicher Komplexität und Differenzierung
- Sozialgeschichtlicher Kontext der Irrenreform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Irrenreform im 19. Jahrhundert in Preußen ein und beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel, der zu einer Veränderung des Umgangs mit „Irren“ führte. Sie skizziert unterschiedliche Positionen in der Forschung und betont die Bedeutung des gesamtgesellschaftlichen Kontextes.
Kapitel 1 bietet einen Überblick über die „Irrenreform“, definiert den Begriff „Irre“ und setzt sich mit der Entwicklung der Anstaltspsychiatrie und der Universitätspsychiatrie auseinander. Es untersucht die verschiedenen Formen des Wahnsinns im 19. Jahrhundert und beleuchtet den Einfluss der Aufklärung auf das veränderte Menschenbild.
Kapitel 2 geht auf die administrative Entwicklung des Irrenwesens im 19. Jahrhundert ein. Es präsentiert das Beispiel Siegburg und analysiert das preußische Einweisungsverfahren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen der Irrenreform, Anstaltspsychiatrie, Universitätspsychiatrie, Wahnsinn, Aufklärung, Menschenbild, gesellschaftliche Komplexität, Differenzierung, Sozialgeschichte, Industrialisierung, Irrenwesen, Einweisungsverfahren, preußische Verwaltung, Humanisierung und Sozialdisziplinierung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern der 'Irrenreform' im 19. Jahrhundert in Preußen?
Die Reform markierte einen Wandel weg von der bloßen Unterbringung hin zu einer differenzierten Behandlung und einer Humanisierung des Umgangs mit psychisch Kranken.
Welchen Einfluss hatte die Aufklärung auf die Reform?
Die Aufklärung führte zu einem kulturellen Wandel des Menschenbildes, was die gesellschaftliche Wahrnehmung und den Umgang mit dem 'Wahnsinn' grundlegend veränderte.
Warum war die Irrenreform international von Bedeutung?
Das Problem erwies sich als Charakteristikum sich industrialisierender westlicher Länder, wobei Preußen eine Vorreiterrolle in der Systematik der Gesetzgebung einnahm.
Was ist der Unterschied zwischen Anstalt- und Universitätspsychiatrie?
Die Arbeit beleuchtet die institutionelle Entwicklung und den methodischen Widerstreit zwischen der praxisorientierten Anstalt und der forschungsorientierten Universität.
Welches Fallbeispiel wird für das Einweisungsverfahren genutzt?
Die administrativ durchgesetzte Entwicklung wird exemplarisch am Beispiel der Anstalt in Siegburg und dem preußischen Einweisungsverfahren analysiert.
- Quote paper
- Coskun Tözen (Author), 2002, Die 'Irrenreform' im 19. Jahrhundert in Preußen - Aufklärung und kultureller Wandel des Menschenbildes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43034