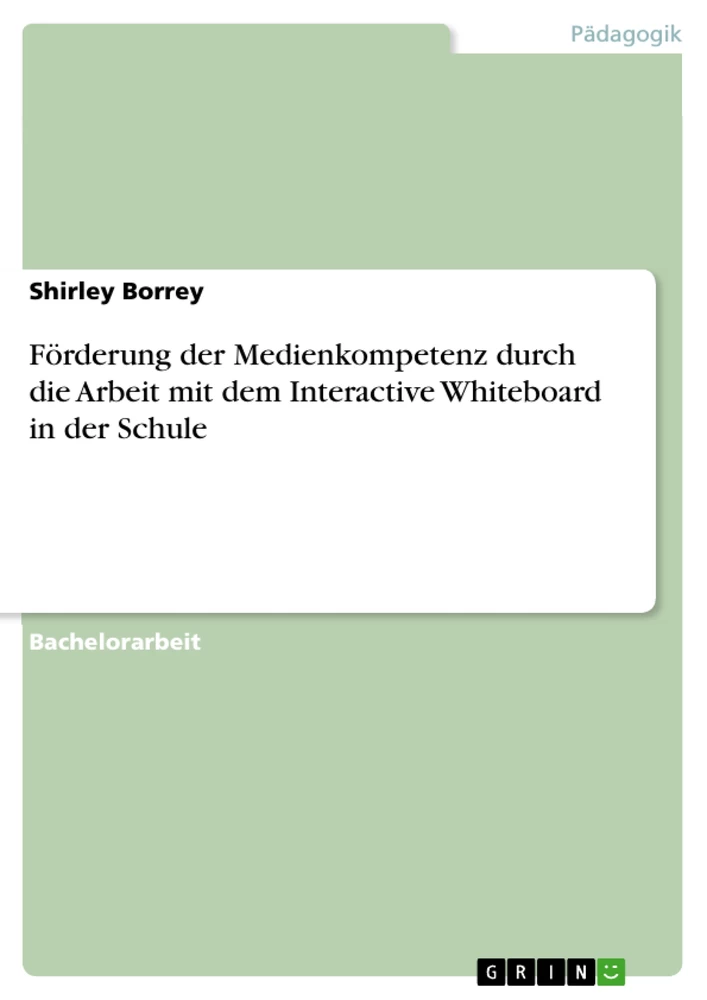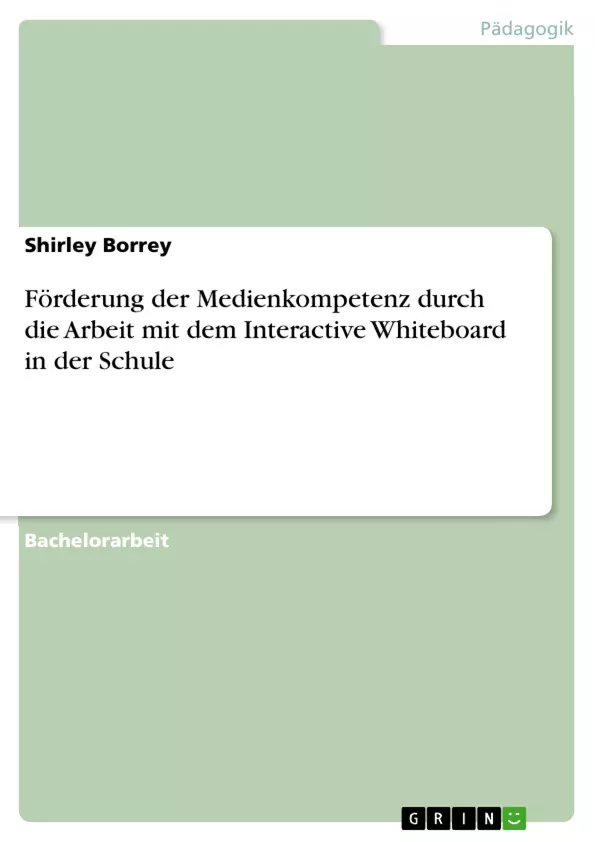Medien sind ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens geworden und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie beeinflussen unser Denken, Handeln und Arbeiten. Diese Arbeit soll beleuchten, was Medien in unserer Gesellschaft für den Einzelnen bedeuten und wie sie vor allem die didaktische Lebenswelt beeinflussen. Ein ausschlaggebender Aspekt ist hierbei die Sicht auf Jugendliche. Ob Fernsehen, Computerspiele oder soziale Netzwerke – unsere Jugend hat einen natürlichen Umgang mit diversen Medien entwickelt und sie in ihre Lebenswelt integriert. Dies ist auf der einen Seite bewundernswert, wenn man sieht mit welcher intuitiven Selbstverständlichkeit sie hochsensible und äußerst komplexe Geräte bedienen, kann einem aber auch Angst machen, wenn man bedenkt wie unvorhersehbar die Folgen des Medienkonsums sein können.
Der Erkenntnisgewinn dieser Arbeit wird vor allem zu Aspekten der Medienkompetenz von Jugendlichen im Hinblick auf eine mediendominierte Zukunft angestrebt. Es wird daher zum einen der private Medienumgang von Jugendlichen untersucht und dargestellt und zum anderen die schulische Relevanz von Medien betrachtet. „Die Liste der Technologien, die beim Lernen und Lehren eingesetzt werden, ist lang und entwickelt sich ständig weiter“ (Ebner, Schön & Nagler, 2011) und der Begriff des E-Learning hat sich längst etabliert. Ob Medien als Teil des Unterrichts von didaktischer Bedeutung sind, soll an dieser Stelle nicht diskutiert, sondern als Gegebenheit vorausgesetzt werden. Da Medien und hier vor allem der Computer und das Internet zu selbstverständlichen Elementen des Alltags und somit zu einem festen Bestandteil unserer Kultur geworden sind, steht außer Frage, dass die entsprechenden Umgangsweisen gelehrt und erlernt werden müssen. Medienkompetenz als eine Art vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen wird somit zu einer elementaren Fähigkeit.
Wenn wir Medien als gegebene Faktoren des Alltags akzeptieren, müssen wir sicherstellen, dass der eigenverantwortliche Umgang von Jugendlichen mit neuen Medien gewährleistet ist. Entsprechend lautet die Forschungsfrage:
Inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen der Arbeit am IWB im Unterricht und der Medienkompetenz der Schüler im Hinblick auf eine mediendominierte Zukunft?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsthema
- 2.1 Verortung der Mediendidaktik und des IWB
- 2.2 Der Medienbegriff
- 2.3 Medienkompetenz
- 2.4 Medien im Alltag von Jugendlichen
- 2.4.1 Medienumgang
- 2.4.2 Medienkritik
- 2.4.3 Mediensozialisation
- 2.5 Technologien in der Schule
- 2.5.1 Das IWB im Unterricht
- 2.5.2 Funktionen und Möglichkeiten im Unterricht
- 2.5.3 Vor- und Nachteile des IWB
- 2.6 Entwicklung der Hypothesen
- 3. Empirische Untersuchung
- 3.1 Gegenstand der Untersuchung/Stichprobe
- 3.2 Entwicklung des Fragebogens
- 3.3 Operationalisierung
- 3.4 Analyse des Fragebogens
- 3.4.1 Überprüfung von Hypothese [H1]
- 3.4.2 Überprüfung von Hypothese [H2]
- 3.4.3 Überprüfung von Hypothese [H³]
- 3.4.4 Überprüfung von Hypothese [H4]
- 3.4.5 Überprüfung von Hypothese [H5]
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Generalisierungsoptionen
- 4.2 Besondere Aspekte bei Medien in der Schule
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Medien auf die Lebenswelt von Jugendlichen und untersucht die Bedeutung von Mediendidaktik in Bildungseinrichtungen. Ziel ist es, die Medienkompetenz von Jugendlichen im Hinblick auf eine mediendominierte Zukunft zu analysieren und zu untersuchen, inwieweit das Interactive Whiteboard (IWB) im Unterricht zur Förderung der Medienkompetenz beitragen kann.
- Mediensozialisation und Medienumgang von Jugendlichen
- Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation im digitalen Zeitalter
- Didaktischer Einsatz des IWB im Unterricht
- Relevanz von Medien im schulischen Kontext
- Zusammenhang zwischen schulischer Medienarbeit und allgemeiner Medienkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Medien im modernen Alltag von Jugendlichen dar und führt in das Thema der Medienkompetenz und ihrer Förderung durch Mediendidaktik ein. Kapitel 2 beleuchtet den Medienbegriff, die Medienkompetenz und den Umgang von Jugendlichen mit Medien. Dabei werden die Mediensozialisation und die Bedeutung von Medienkritik betrachtet. Anschließend wird die Rolle von Technologien in der Schule und insbesondere das IWB als didaktisches Werkzeug im Unterricht analysiert.
Kapitel 3 beschreibt die empirische Untersuchung, die durchgeführt wurde, um den Zusammenhang zwischen der Arbeit mit dem IWB und der Medienkompetenz von Jugendlichen zu untersuchen. Es wird der Aufbau und die Durchführung des Fragebogens sowie die Operationalisierung der Hypothesen erläutert.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Dabei werden die Generalisierungsoptionen der Ergebnisse sowie besondere Aspekte im Zusammenhang mit Medien in der Schule diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Medienerziehung, Mediensozialisation, Medienkompetenz, Mediendidaktik, Interactive Whiteboard (IWB), E-Learning, Jugendliche, Medienumgang, Medienkritik, schulische Medienarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Medien kritisch, eigenverantwortlich und kreativ zu nutzen, und gilt heute als vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen.
Wie fördert das Interactive Whiteboard (IWB) das Lernen?
Das IWB ermöglicht interaktiven Unterricht, die Einbindung multimedialer Inhalte und fördert die aktive Beteiligung der Schüler am digitalen Medium.
Was ist Mediensozialisation?
Es beschreibt den Prozess, in dem Kinder und Jugendliche durch den alltäglichen Umgang mit Medien geprägt werden und diese in ihre Identität integrieren.
Welche Gefahren birgt der Medienkonsum bei Jugendlichen?
Gefahren sind unter anderem Cybermobbing, Suchtpotenzial und der unkritische Umgang mit persönlichen Daten oder manipulativen Informationen.
Warum ist Mediendidaktik in der Schule so wichtig?
Da Medien den Alltag dominieren, muss die Schule den reflektierten Umgang mit ihnen lehren, um Schüler auf eine mediendominierte Zukunft vorzubereiten.
- Arbeit zitieren
- Shirley Borrey (Autor:in), 2013, Förderung der Medienkompetenz durch die Arbeit mit dem Interactive Whiteboard in der Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430720