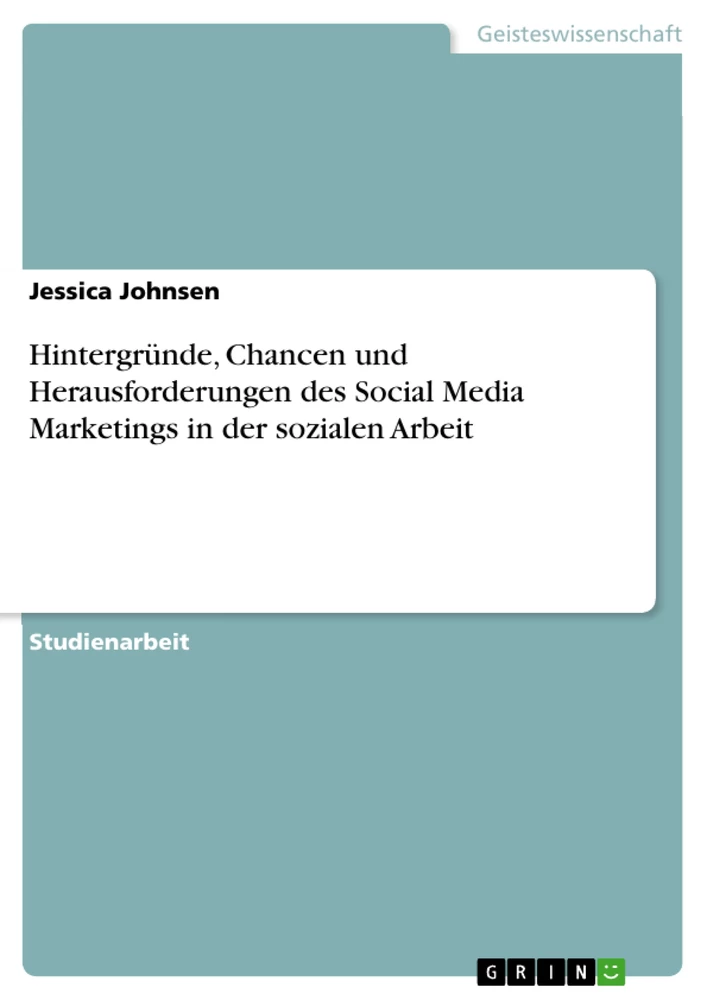In allen Bereichen des Alltags machen sich die Auswirkungen der Digitalisierung bemerkbar. Immer mehr bestimmt sie die gesellschaftliche Wirklichkeit. Unsere heutige Lebenswelt gleicht einer digitalen Lebenswelt. So wird die Auseinandersetzung mit Digitalisierung im beruflichen Bereich zunehmend wichtiger, auch in der sozialen Arbeit. Digitalisierung gibt uns neue Möglichkeiten der Kommunikation. Sie ermöglicht ebenso eine mediale freie Meinungsäußerung, welche sich natürlich auch negativ auswirken kann, wie sie es zum Beispiel bei Online-Mobbing oder Netz-Kriminalität tut.
Für die soziale Arbeit sind zwei Folgen der Digitalisierung genauer zu betrachten: zum einen gibt es immer mehr einen exzessiven Nutzen von Medien – vor allem von Kindern und Jugendlichen. Dies führt zunehmend zu Suchtproblematiken, welche wiederum soziale Folgen nach sich ziehen und somit Gegenstand der sozialen Arbeit werden. Zum anderen werden in der sozialen Arbeit Medien immer häufiger als Arbeitsmittel eingesetzt, da sie einen besonderen Zugang zu den Adressaten und Adressatinnen ermöglichen.
In dieser Arbeit soll der zweite Aspekt betrachtet werden. Im Zuge der Digitalisierung ändert sich auch das Kommunikationsverhalten der Bevölkerung: immer mehr junge Leute schauen nicht mehr regelmäßig in ihre E-Mails, verbringen aber täglich viel Zeit in den verschiedensten Social Media Netzen. Sie sind also über Social Media einfacher zu erreichen. Anhand ein paar Zahlen lässt sich die Entwicklung von Social Media darstellen: 1999 gab es weltweit genau 23 Blogs. 2002 bereits ca. 50.000, 2006 ca. 35 Millionen und letztlich 2011 rund 173 Millionen. Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei dem sozialen Netzwerk Facebook zu sehen: wo es vor gut 10 Jahren (2008) noch lediglich 600.000 Nutzer in Deutschland gab, sind es 2013 rund 26 Millionen und 2018 2,1 Milliarden. Social Media bietet sich aufgrund dieser Entwicklung immer mehr auch als Marketinginstrument für Sozialunternehmen an. Die Vielfaltigkeit von Social Media ermöglicht allen Organisationen eine Plattform zu finden, mit der sie ihre Marketingziele erreichen können und somit von Social Media profitieren.
In dieser Arbeit soll die Frage beantwortet werden, welche Chancen und Herausforderungen Social Media Marketing in der sozialen Arbeit bringt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung von Marketing in der sozialen Arbeit
- Social Media
- Die unterschiedlichen Formen von Social Media
- Social Media Marketing
- Chancen des Social Media Marketings in der sozialen Arbeit
- Herausforderungen des Social Media Marketings in der sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Chancen und Herausforderungen des Social Media Marketings in der sozialen Arbeit. Sie untersucht, wie Social Media-Plattformen als Marketinginstrument für Non-Profit-Organisationen genutzt werden können und welche spezifischen Herausforderungen sich dabei stellen.
- Die Bedeutung von Marketing in der sozialen Arbeit und die Besonderheiten von sozialen Dienstleistungen.
- Die Entwicklung und Verbreitung von Social Media und seine Relevanz für die Kommunikation.
- Chancen des Social Media Marketings für soziale Einrichtungen, wie z.B. Reichweite, Bekanntheitssteigerung und neue Zielgruppenansprache.
- Herausforderungen des Social Media Marketings, wie z.B. Datenschutz, Ressourcenmanagement und die Bewältigung von negativer Kritik.
- Die Rolle von Social Media Marketing für die Zukunft der sozialen Arbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Bedeutung der Digitalisierung für die soziale Arbeit. Besonderes Augenmerk liegt auf den Folgen der Digitalisierung, insbesondere auf den exzessiven Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen sowie dem Einsatz von Medien als Arbeitsmittel in der sozialen Arbeit.
- Die Bedeutung von Marketing in der sozialen Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Besonderheiten von sozialen Dienstleistungen und erklärt, warum Marketing in der sozialen Arbeit notwendig ist. Es werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit, das Potenzial von Organisationen zu verdeutlichen, die Integration externer Faktoren (Leistungsempfänger), die standortgebundene Natur sozialer Dienstleistungen, die Nicht-Lagerfähigkeit und die komplexen Tauschbeziehungen mit Stakeholdern betrachtet.
Schlüsselwörter
Social Media Marketing, soziale Arbeit, Non-Profit-Organisationen, Digitalisierung, Kommunikation, Chancen, Herausforderungen, Stakeholder, Ressourcenmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Welche Chancen bietet Social Media für die Soziale Arbeit?
Social Media ermöglicht eine höhere Reichweite, den Zugang zu jungen Zielgruppen und eine effiziente Plattform für das Marketing sozialer Dienstleistungen.
Was sind die größten Herausforderungen beim Social Media Marketing?
Zu den Herausforderungen zählen Datenschutzbedenken, das Ressourcenmanagement sowie der Umgang mit negativer Kritik oder Online-Mobbing.
Warum ist Marketing für NPOs überhaupt notwendig?
Marketing hilft sozialen Organisationen, ihr Potenzial gegenüber Stakeholdern zu verdeutlichen und die komplexen Tauschbeziehungen im sozialen Sektor zu managen.
Wie hat sich die Social Media Nutzung entwickelt?
Von wenigen Blogs Ende der 90er Jahre ist die Nutzerzahl auf Milliarden in Netzwerken wie Facebook gestiegen, was Social Media zu einem unverzichtbaren Kommunikationskanal macht.
Welche negativen Folgen der Digitalisierung gibt es für Kinder?
Ein exzessiver Medienkonsum kann zu Suchtproblematiken führen, die wiederum soziale Folgen nach sich ziehen und ein Handlungsfeld für die Soziale Arbeit darstellen.
- Quote paper
- Jessica Johnsen (Author), 2018, Hintergründe, Chancen und Herausforderungen des Social Media Marketings in der sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430790