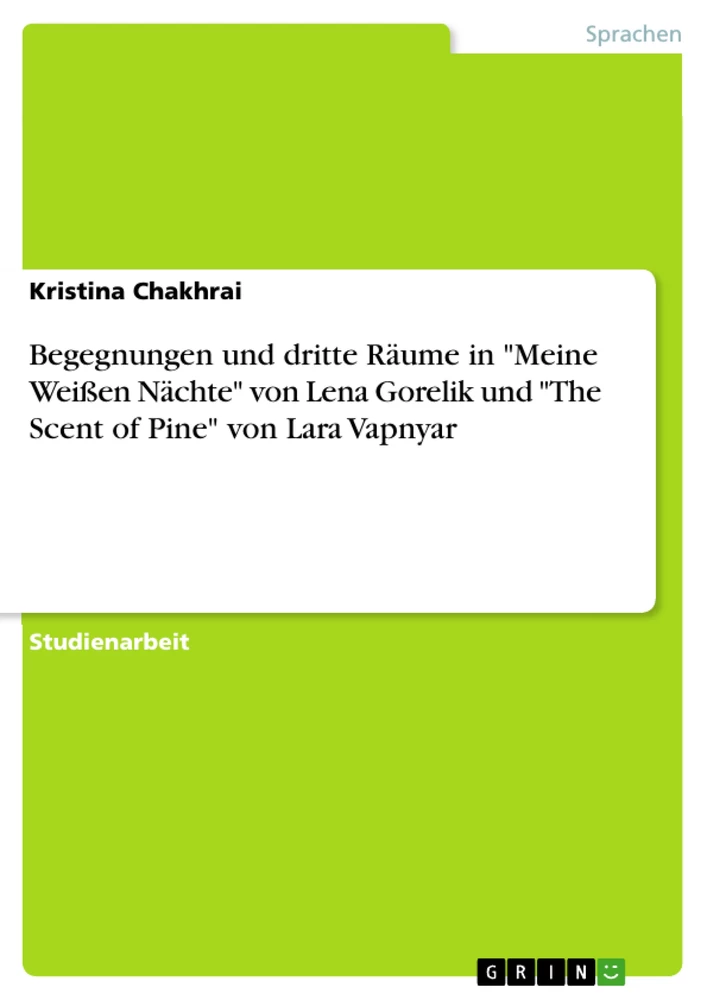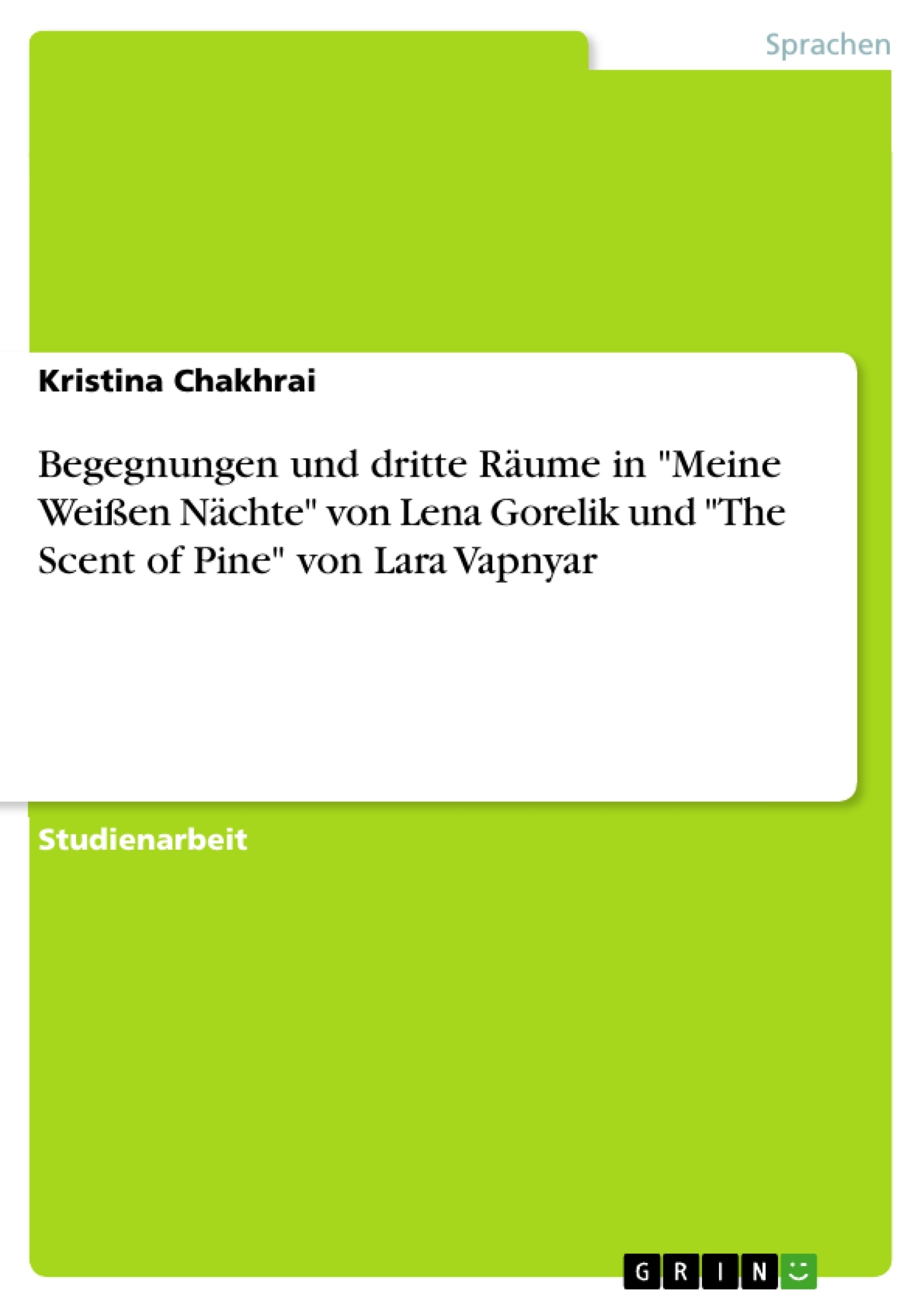Die vorliegende Arbeit möchte durch das Neben- und Miteinanderlesen von "Meine Weiße Nächte" der Autorin Lena Gorelik und "The Scent of Pine" von Lara Vapnyar zwei Romane von aus der UdSSR emigrierten jüdischen Autorinnen auf ihre inhaltlichen Ähnlichkeiten hin untersuchen und ebendie transnationalen und translationalen Begegnungsräume aufzeigen, die Homi K. Bhabha in seiner Postkolonialen Theorie als Dritte Räume bezeichnet. Es soll sich zeigen, inwiefern dieses von ihm entwickelte Konzept auch bei nicht klassisch kolonialen Literaturen produktiv angewandt werden kann und welche Erkenntnisse über den Umgang mit
Migration in diesem Vergleich sichtbar werden.
Inhalt
Abstract
Einführung und Methode
Theoretische Ausarbeitung
Meine Weißen Nächte und The Scent of Pine - Ausarbeitung
Conclusio
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Sekundärliteratur
Abstract
Die vorliegende Arbeit möchte durch das Neben- und Miteinanderlesen von Meine Weißen Nächte1 der Autorin Lena Gorelik und The Scent of Pine2 von Lara Vapnyar zwei Romane von aus der UdSSR emigrierten jüdischen Autorinnen auf ihre inhaltlichen Ähnlichkeiten hin untersuchen und ebendie transnationalen und translationalen Begegnungsräume aufzeigen, die Homi K. Bhabha in seiner Postkolonialen Theorie als Dritte Räume bezeichnet. Es soll sich zeigen, inwiefern dieses von ihm entwickelte Konzept auch bei nicht klassisch kolonialen Literaturen produktiv angewandt werden kann und welche Erkenntnisse über den Umgang mit Migration in diesem Vergleich sichtbar werden.
Einführung und Methode
Es existieren viele verschiedene Arten, über Äweibliche Erfahrung“ in der Literatur zu sprechen. Das gesamte weibliche Schrifttum als sogenannte Frauenliteratur zusammenzufassen ist eine dieser Möglichkeiten3. Dabei beschreibt dieser Begriff nicht nur Werke von Autorinnen, sondern auch Werke von Autor*innen, die ein bestimmtes Zielpublikum zu bedienen versprechen - Frauen. Zu dieser zweiten Kategorie könnte man auch das Genre der sogenannten Chick Lit zählen, welches als Unterhaltungslektüre beschrieben werden kann, die an junge Frauen gerichtet ist, ganz nach dem Beispiel Bridget Jones Diary4. Auch Meine Weißen Nächte könnte als ein Vertreter dieses Genres gezählt werden. Angefangen bei der pastelligen Covergestaltung5, bis hin zum humorvollen Erzählton des Textes6. Auch wenn diese Labels und Genrebezeichnungen aus unserem Alltag kaum wegzudenken sind, muss beachtet werden, dass sie hauptsächlich pejorativ verwendet und nicht selten mit Trivialliteratur gleichgesetzt werden. Die Bezeichnung ÄFrauenroman“ wird bei literarisch anspruchsvolleren Werken kaum verwendet, wie man auch an den Reviews von The Scent of Pine sehen kann. Die Kritiker*innen beschreiben es als Äelegant writing and propulsive storytelling“7 oder auch Ävivid and rich“8. Es wird auch nicht einem (Sub-)Genre wie etwa der Chick Lit zugeschrieben, sondern fällt auf Plattformen wie Goodreads unter den Bereich Fiction9.
Auch wenn die zwei Romane auf den ersten Blick nicht viele Berührungspunkte zu haben scheinen, weisen sie doch eine große inhaltliche Nähe auf, die auf die Akkumulation von ähnlichen Erfahrungen in der UdSSR und bei der Immigration ins westliche Ausland zurückgeführt werden können. Als Teil ihrer jeweiligen Nationalbibliografie, werden sie hinsichtlich ihres russisch-jüdischen Hintergrundes bereits untersucht, ebenso wie innerhalb ihrer jeweiligen Genres, jedoch noch nicht in einem Vergleich miteinander. Lena Gorelik lebt und veröffentlicht in Deutschland, Lara Vapnyar in den USA. Ihre hier behandelten Werke sind in einem Abstand von etwa zehn Jahren erschienen, jedoch sind beide Frauen im selben Zeitraum aus der UdSSR ausgewandert10, als Anfang der 1990er Jahre die Immigration von russischen Juden und Jüdinnen in Deutschland und den USA durch verschiedene Programme11 erleichtert wurde. All diese Verbindungen zwischen den zwei Werken, nämlich Geschlecht, religiöse Zugehörigkeit, Migrationserfahrung und Fremdheit in der alten und der neuen Heimat, wollen nun gemeinsam betrachtet werden, ohne bei der Analyse des einen, die anderen zu ignorieren. Einige Strömungen in diese Richtung werden in einem breiteren Kontext von Elke Sturm-Trigonakis zusammengetragen, die systematisch versucht, das Konzept einer hybriden ÄNeuen Weltliteratur“ zu entwickeln12, die mit unserer neuen globalisierten Umwelt korreliert. In dieser Neuen Weltliteratur sind Ämultiple affiliations of texts with various homologous categories […] perfectly permissible and even desirable “13.
Dieser Ansatz ist für die folgende Analyse nicht ganz praktikabel, da der Zugang von Sturm- Trigonakis strukturalistisch ist, und die außerliterarischen Aspekte ausgegrenzt werden, wie etwa die ÄErfahrung von Migration, kulturelle Fremde, Hybridisierung und Globalisierung, die meist zum Anlass und Ausgangspunkt des Schreibens wurden.“14 Ein anderer Ansatz, der ursprünglich aus den Postcolonial Studies stammt, ist ein von Homi K. Bhabha geprägter Begriff, nämlich der sogenannte Dritte Raum, welcher als räumliche (metaphorische) Ausformulierung seines Hybriditätskonzeptes gilt und aufzeigt, dass eine gewanderte Person (bei ihm eine Person im kolonialen Kontext) sich in einem Zustand des Dazwischen befinden kann, ohne sich dem einen oder anderen Pol (man könnte auch salopp sagen ÄKultur“) zugehörig zu fühlen.
Im Folgenden wird dieses Modell definiert und für die vorliegende Analyse nutzbar gemacht. Dafür wird es mithilfe von Doris Bachmann-Medick auf die interkulturelle Situation außerhalb des Postkolonialen Kontextes umformuliert. Es ist zu zeigen, ob und an welchen Stellen Bhabhas Dritte Räume in den beiden Werken sichtbar werden und welche Momente in ihnen eingefangen werden. Schließlich bleibt herauszufinden, ob in beiden Romanen in Bezug auf das Empfinden der Fremde und der Migrationserfahrung ähnliche Strukturen zum Vorschein treten.
Theoretische Ausarbeitung
Die Begriffe Hybridität und Dritter Raum nehmen bei Homi K. Bhabha und seiner Verortung der Kultur15 einen sehr wichtigen Raum ein, jedoch ist es auch wichtig abzustecken, was er unter ÄKultur“ und ÄIdentität“ versteht, handelt es sich hier doch um die Grenzen bzw. Akteure der vermeintlichen ÄVermischung“ beim Hybriden. Bhabha, als postkolonialer Theoretiker (und in erster Linie Literaturtheoretiker), setzt seine Begrifflichkeiten in einen anderen Kontext als es hier getan wird, daher wird im Folgenden auch nur das Grundgerüst der erwähnten Begriffe verwendet in Vorbereitung auf eine kulturtheoretische bzw. praktische Interpretation von Doris Bachmann-Medick, welche dann der weiteren Analyse dienen wird.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass Kultur nicht als etwas Homogenes gedacht wird, das dann im Zuge einer Durchmischung mit einer anderen Kultur als hybrid bezeichnet werden kann. Es ist auch falsch zu sagen, dass diese neue Form, also das Hybrid, auf zwei (oder mehr) Urkulturen zurückgeführt werden kann. ÄKultur ist für [Bhabha] in erster Linie ein bedeutungsgenerierendes System und folglich als Sprache, als Äußerung, als Performance denkbar.“16 Dieses System zeichnet sich durch die Gleichzeitigkeit konkurrierender Bedeutungskonstruktionen aus - und dies nicht nur kulturenübergreifend, sondern auch innerhalb der jeweiligen Kultur präsent als gleichzeitig widersprüchliche Wertevorstellungen, Narrative oder Machtansprüche.17 Natürlich hat dies auch eine Auswirkung auf die Subjekte in dieser Kultur, sie sind laut Bhabha ebenfalls immer instabil. ÄThe subject is not what you start with, as an origin, nor where you end, as closure. The subject is what is discovered about the movement of discourse, texts, action without those polarities.“18 Und wie Subjekte, sind auch Kulturen oder kulturelle Repräsentationsformen kein authentischer Ausdruck einer prädiskursiven Identität, sondern Ämore about the activity of negotiating, regulating and authorising competing, often conflicting demands for collective self-representation“19 Man sieht also, dass hier Kulturen bereits als in sich hybrid gedacht sind, nicht erst nach der Vermischung mit anderen Kulturen. Das gilt auch für das Subjekt. Es existiert keine fixe Identität, sondern lediglich ein Prozess der Identifikation. Bhabha verwehrt sich nicht komplett gegen den Begriff der Identität, jedoch wird sie seiner Meinung nach erst produziert, und das in Form eines wiederkehrenden Bildes einer Identität, wobei dieses Bild immer auch schon eine Spaltung mit sich führt.20
Was ist nun Hybridität und wie wird sie konstituiert? ÄThe process of cultural hybridity gives rise to something different, something new and unrecognisable, a new area of negotiation of meaning and representation. “21 Ursprünglich aus der Biologie kommend (und daher in den Literatur- und Geisteswissenschaften mit Kritik verbunden), beschreibt Hybridität Kreuzungen aus unterschiedlichen Pflanzen. Später, v.a. im 20. Jahrhundert wurde der Begriff pejorativ für Menschen verwendet, deren Herkunft nicht Ärein“ war.22 Homi Bhabha hingegen verwendet den Begriff anders.
[Hybridity] refers to the process of the emergence of a culture, in which its elements are being continually transformed or translated through irrepressible encounters. Hybridity offers the potential to undermine existing forms of cultural authority and representation.23
Bhabha stellt sich mit seiner Auffassung von Hybridität einerseits gegen die Vorstellung holistischer Kulturen, aber auch gegen eine Vorstellung der Synthese von verschiedenen Kulturen. Es gibt keinen ÄAusgleich zwischen zwei oppositionellen Kulturen“ und keinen kulturellen Ämelting pot.“24 Stattdessen könnte man von einem Äheterogenen Gemisch“ 25 sprechen. Einerseits betont Bhabha demnach die Neuartigkeit dessen, was durch Hybridisierung entsteht und lehnt somit die Vorstellung ab, dass eine Mischung aus zwei oder mehreren vorhergehenden Kulturen entsteht, die weiterhin durch Spuren der Geschichte, Machtverhältnisse etc. zurückzuverfolgen wären.26 In Bhabhas Worten:
But for me the importance of hybridity is not to be able to trace two original moments from which the third emerges, rather hybridity to me is the ‚third space‘ which enables other positions to emerge.27
Hybridität funktioniert auf dieser Ebene als der Äzwischenräumliche Übergang zwischen festen Identifkationen“, der Ädie Möglichkeit einer kulturellen Hybridität“ eröffnet, Äin der es einen Platz für Differenz ohne eine übernommene Hierarchie gibt.“28 Der Dritte Raum von Bhabha ist ebendieser Platz und wirkt als metaphorische Konkretion der Hybridität.29 Urspünglich bezieht er sich hier auf eine Installation mit dem Namen ÄSites of Genealogy“ der afro-amerikanischen Künstlerin Renée Green, bei der sie die Architektur des Museums selbst als Bezugssystem verwendet, Äum Assoziationen zwischen gewissen binären Aufteilungen […] herzustellen.“30 Bhabha sagt über ihre Installation und somit auch über seinen Dritten Raum:
Das Treppenhaus als Schwellenraum zwischen den Identitätsbestimmungen wird zum Prozeß symbolischer Interaktion, zum Verbindungsgefüge, das den Unterschied zwischen Oben und Unten, Schwarz und Weiß konstituiert. Das Hin und Her des Treppenhauses, die Bewegung und der Übergang in der Zeit, die es gestattet, verhindern, daß sich Identitäten an seinem oberen und unteren Ende zu ursprünglichen Polaritäten festsetzen.31
Dieser Ort ist nicht stabil, keine Synthese zwischen verschiedenen Kulturen, sondern mehr ein Übergang zwischen den Binaritäten und so eine Zone der kulturellen Differenz, oder auch Fremdheit.32 Man kann ihn also auch als Begegnungsraum denken, in dem Migrant*innen ihre eigene Identität entwickeln, sich Äidentifizieren“, fremd in der einen und der anderen Kultur, etwas Neues darstellend, das keine reine Vermischung von Vergangenheit und Gegenwart ist.
Wie bereits erwähnt, fokussiert Bhabha sich in seinem Werk vorwiegend auf koloniale und postkoloniale Phänomene und - als Literaturtheoretiker - auf die Einflüsse der englischen Sprache bzw. von englischsprachigen Werken auf ebendiese. Somit lassen sich auch viele Literaturbeispiele in Verortung der Kultur finden, die Bhabha mithilfe von Derrida u.a. dekonstruiert. Eine Interpretation von Bhabhas Werk von Doris Bachmann-Medick öffnet es für nicht-koloniale Diskurse. In ihrem Text Ä1+1=3?“33 schreibt sie über den Umgang mit der Globalisierung und der Nützlichkeit, deren Herausforderungen mit der Literatur zu lernen. Sie sieht die Migration als einen dritten Zustand, neben der komplizierten Verflechtungslage zwischen Ost und West, und dadurch eine Herausbildung Äneuer, überlagerter, heimatloser Identitäten.“34 Sie beschreibt den Dritten Raum gleichsam als Äspezifische Existenzform der Selbstverfremdung durch Migration“, aber auch als ÄAusgangspunkt eines kulturwissenschaftlichen Konzepts von transnationaler ‚hybrider‘ Kulturenüberlagerung.“35 Er ist außerdem nicht nur ein Ort zwischen den Kulturen, sondern auch eine Strategie der Vervielfältigung nicht homogener Schichtung innerhalb einer jeweiligen Kultur.36 Gerade für die behandelten Texte scheint auch der Ausspruch wichtig: ÄLiterarische Verarbeitung von Alteritätserfahrungen in sozialen Lebenssituationen[…]“37 Es wird also, angelehnt an Bhabha, jedoch durch Bachmann-Medick weitergedacht, jener Dritte Raum oder auch jene Dritten Räume gesucht, in denen ebendie Alteritätserfahrungen zu finden sind, von denen vorher die Rede war. Es bleibt zu zeigen, inwiefern sich diese in den zwei Werken ähneln und wie, bzw. in welchen spezifischen Lebenssituationen dies literarisch verarbeitet wird. Es wird also nach Ausdrücken einer gemeinsamen Migrationserfahrung gesucht. Dafür werden Passagen herausgegriffen, in denen explizit und implizit über die Identifikationen der Charaktere gesprochen wird und im weiteren Verlauf die Stilmittel aufgezeigt, mit denen dies getan wird.
Meine Weißen Nächte und The Scent of Pine - Ausarbeitung
Die Protagonistinnen beider Romane kommen aus der ehemaligen UdSSR, wobei Anja aus Meine Weißen Nächte mit etwa elf Jahren nach Deutschland zieht und Lena aus The Scent of Pine mit etwa zwanzig in die USA. Durch den Altersunterschied und die unterschiedlichen Familienverhältnisse (Anja ist Studentin, Lena unterrichtet auf der Universität und ist verheiratet, hat zwei Kinder) nehmen sie ihr eigenes Leben anders wahr, ebenso wie ihre Rolle darin. Für Anja ist das Russische in ihrem Alltag reduziert auf ihre Eltern, die einzigen Personen, mit denen sie noch ihre Muttersprache spricht und gewisse Werte teilt (man könnte hier eher von Traditionen sprechen). Die Jahre, die sie tatsächlich in der UdSSR verbracht hat, sind für sie Ä[w]ie ein Abenteuerurlaub aus der Kindheit.38 “ Zwar fühlt sie sich in Deutschland oftmals als ÄExotin“39, und spielt auch gerne mit Klischees im Gespräch mit anderen,40 doch ist ihre Identifikation als Russin in Deutschland auch ein zeitliches Problem, da vieles, das sie mit Russland verbindet, keine Aktualität mehr hat und damit nicht authentisch ist.
Meine deutschen Freunde lachen über mich, aber meine russischen Freunde erzählen mir, meine Mutter sei ja recht eingedeutscht, ihre eigenen wären noch schlimmer.41
Einerseits sieht man hier die Hybridität innerhalb der Kultur, von der oben die Rede war.
Andererseits kommt nun auch eine zeitliche Linie dazu, da Anjas Identifikation mit gewissen russischen Werten gewissermaßen anachronistisch ist, was sie jedoch selbst nicht wahrnimmt. Hier ist der erste Hinweis auf einen Dritten Raum, in dem sie sich befindet. Sie ist einerseits geografisch nach Deutschland Ägewandert“ und somit hier selbst nach Jahren eine Fremde, doch hat sie auch kein Gefühl mehr für das Äbedeutungsgenerierende System“ der aktuellen russischen Kultur.
Für Lena ist die Situation anders, da sie ihre ganze Kindheit und Jugend in der UdSSR verbracht hat und dann als Erwachsene in die USA zieht. Sie ist berufstätig, hat zwei Kinder und ist mit einem Russen verheiratet. Ihr Umgang mit ihrer Migrationserfahrung bzw. dem Gefühl der Fremdheit wird nur an wenigen Stellen explizit behandelt.
Lena was suddenly seized by an acute feeling of being a stranger in America.42
there was the incomprehension and dejection which characterized her first months in America, when everything had seemed so strange and hostile: […]43
Eine Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit findet nur implizit über Erinnerungen statt. Etwa die Hälfte des Romans sind Erzählungen aus einem Sommercamp, bei dem Lena als Jugendliche gearbeitet hat. Sie beschreibt die generelle Szenerie und die Menschen darin mit Nostalgie aber auch Distanz, welche nach und nach abnimmt. Zwischen den Erzählungen über das Camp und dem Hauptstrang der Geschichte gibt es kaum Verbindungen, stattdessen scheint da eine Art luftleerer Raum, der wiederum auf einen Zwischenraum hindeutet, in dem sie sich selbst befindet. Immer dann, wenn ihre Vergangenheit sie einzuholen scheint, fühlt sich Lena unsicher, scheint ihr eigenes Leben als öde zu empfinden.
And now Inka. Lena had lost touch with Inka after Lena and Vadim left Russia for the U.S.
years ago, but in the last few years, news of Inka had been popping up here and there. […] She was annoyed with Inka. Her condescending “Oh”! when Lena said that she worked at a community college, her tapping fingers, but most of all, her surprise that Lena was still married to Vadim.44
Dieser luftleere Raum existiert auch in Meine Weißen Nächte, in dem sich Kapitel über die Kindheit in Russland bzw. die Migration nach Deutschland mit dem Erzählstrang in Deutschland ohne Überleitung abwechseln. Auch hier wird eine Distanz zu diesen Erinnerungen gesucht, die Anjas Leben und Charakter sehr geprägt haben, die sie jedoch auch nicht in ihr jetziges Leben mitnehmen möchte.
Ich will nicht über das Wohnheim reden. Das Wohnheim führt zu unangenehmen Fragen. Es setzt mich ab, macht mich von einer russischen Exotin zu einem Fremdkörper, weil doch Wohnheim - und dann auch noch ein Asylantenwohnheim - na ja, schon komisch ist.45
Sie und Lena scheinen in beiden Welten gleichzeitig zu existieren, aber auch in beiden nicht vollständig. Sie werden immer wieder von ihren Erinnerungen heimgesucht, im gleichen Maße, wie sich ihr Leben außerhalb dieser Erinnerungen verändert. Dieses Dazwischen ist wieder ein Indiz für den Dritten Raum, in dem sie sich aufhalten, wobei das Stiegenhaus (mit Bhabhas Metapher gesprochen) nicht klar ausformuliert und nur implizit zu erahnen ist. In beiden Büchern ist das bindende Glied zwischen damals und jetzt eine Liebesbeziehung.
Beide Romane behandeln zumindest indirekt die Auseinandersetzung zwischen einer alten Liebe und einer neuen, wobei die alte ganz eng mit den Erinnerungen an Russland verknüpft ist und die neue für Gegenwart und Zukunft steht. Für Anja ist Ilja die Liebe ihrer Jugend, der beste Freund aus der Zeit im Asylwohnheim und somit eine Verbindung zu dieser Zeit, die sie so mit anderen Menschen nicht hat. Ihr aktueller Freund, Jan, versteht sie in ihrer momentanen Lage wohl am besten, er ist ihr Anker in Deutschland und zugleich ein Kontrast zu ihrer Vergangenheit. Anja liebt ihn und die Sicherheit, die er ihr gibt, stößt aber gleichzeitig auf Unterschiede, mit denen sie zu kämpfen hat.
ÄBist du jetzt traurig, weil wir uns nicht alle gesagt haben, wie sehr wie uns lieben?“ neckt Jan mich, als wir uns im Zug hingesetzt haben. ÄDenkst du jetzt, wir sind keine richtige Familie?“46
Als Ilja in ihr Leben zurückkehrt, fühlt Anja gleich die alte Verbundenheit und sehnt sich zurück nach ihrer alten Beziehung. Sie merkt jedoch auch, dass diese Zeit nun vorbei ist und sie einerseits die Vergangenheit nicht zurückbringen kann, es andererseits auch nicht möchte. Sie entscheidet sich für Jan, damit indirekt auch für ihr Leben jetzt und für all die Diskrepanzen, die dieses mit sich bringt. Ähnlich ist es auch bei Lena. Sie ist mit ihrer Ehe nicht glücklich, fühlt sich ihrem Mann Vadim zwar durch ihre lange Beziehung sehr verbunden, hält diese aber auch nicht mehr aus.47 Sie trifft während einer Dienstreise auf Ben und beginnt eine kurze aber intensive Affäre mit ihm. In den Tagen, die sie mit ihm verbringt, erzählt sie ihm von ihrer Zeit im Sommercamp und ihren Bemühungen, dort einen Freund zu finden. Erst am Ende des Romans wird klar, dass einer der jungen Männer im Camp später zu ihrem Ehemann wird. Dadurch schließt sich der Raum zwischen den Erinnerungen und der aktuellen Zeit und es wird klar, dass ihr Ehemann die Schlüsselfigur zu ihrer Vergangenheit darstellt und ihr Umgang mit ihrer Ehe auch ein Schlüssel zu ihrem Umgang mit ihrer Migrationserfahrung ist. Gerade das Verschweigen seiner Identität bis zum Ende, lässt diese Verbindung noch wichtiger erscheinen, da er umso deutlicher zum Platzhalter für ihre eigene Geschichte wird. Analog zu Meine Weißen Nächte scheint die Auseinandersetzung mit den Gefühlen für die beiden Männer Lena zu helfen, ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart miteinander zu versöhnen. Im Gegensatz zu Anja, ist Lenas Beziehung mit der Vergangenheit (verkörpert durch ihren Mann) noch sehr präsent und die Trennung bzw. die Entscheidung fällt ihr sehr schwer. Der Übergang zu ihrem jetzigen Leben ist noch nicht abgeschlossen, jedoch scheint klar zu sein, dass ihre Vergangenheit an ihr zehrt. Ben ist der Faktor, der diesen Stein zum Rollen bringt. Er zieht sie nicht so sehr in eine neue Richtung, wie Jan dies bei Anja macht, jedoch helfen Lena die Tage mit ihm, ihr Leben aus einer neuen Perspektive zu sehen und ihre Erfahrungen aufzuarbeiten.48
Für beide Protagonistinnen ist die Migration ein wichtiger Meilenstein in ihrem Leben und die Erinnerungen an das Leben, das sie hinter sich gelassen haben, von immanenter Bedeutung für jenes, das sie nun führen. Die Liebesbeziehungen bzw. die Liebesdreiecke, die in beiden Geschichten behandelt werden, sind ein Werkzeug, um die inneren Prozesse zu verdeutlichen. Die Männer in den Leben der Protagonistinnen stehen metaphorisch für die Momente der Identifikation mit einem einen oder dem anderen Pol (also Russland und Deutschland/USA). Gerade die implizite Behandlung des durch die Migration erzeugten neuen Lebensgefühls bzw. der Fremdheitserfahrung, lässt den Dritten Raum spüren, in dem sie sich befinden. Man könnte hier auch von einem Begegnungsraum sprechen, da die Männer gleichsam eine Begegnung mit der einen oder anderen Lebensrealität darstellen und diese miteinander versöhnen, indem sie die Gefühle ihnen gegenüber auf eine andere Ebene stellen als die Entscheidung, mit wem sie ihr Leben verbringen wollen. Dennoch kann man nicht von einer russischen und einer deutschen/U.S.-amerikanischen Identifikation sprechen, die in den Frauen gegeneinander kämpfen. Es ist auch keine Synthese zwischen den beiden. Denn sie können (und wollen) ihre Vergangenheit nicht aus sich herausschneiden, ebenso wenig, wie diese in sich durch das neue Leben geändert wird. Die Auseinandersetzung damit aus einer neuen Perspektive ändert die Rückschlüsse, die sie daraus ziehen, doch die Erinnerungen bleiben trotzdem Teil einer anderen Welt, die Anja und Lena hinter sich gelassen haben. Sie sind hybrid im Sinne einer Äheterogenen Mischung“ (siehe oben) und bewegen sich, aller Kontraste bewusst, in dem Dazwischen, von dem auch Bhabha in seiner Verortung der Kultur spricht.
Conclusio
Sowohl Meine Weißen Nächte, als auch The Scent of Pine zeichnen ein Bild weiblicher Migrationserfahrung und bieten für sich genommen viel Material, um über Migration zu sprechen, ohne sich von ihrer Genrezuweisung einengen zu lassen. Durch das Aufdecken der Dritten Räume lässt sich zeigen, dass durch die Migration etwas Neues entsteht und nicht lediglich die Vermischung von zwei essentialistischen ÄUrkulturen.“ Es wurde auch gezeigt, wie der Einsatz von Plots wie der Liebesgeschichte bzw. des Liebesdreiecks, wiederum die zugrundeliegende Beschäftigung mit oben genannten Dritten Räumen als Metapher bekräftigen kann und dies in beiden behandelten Romanen auf eine ähnliche Art und Weise gemacht wurde. Die Anwendung von Bhabhas Hybridität und der Dritten Räume ist nicht nur im Kontext der Postkolonialen Theorie nützlich und produktiv. Als Methode hilft sie auch, innere Konflikte sowie äußere und inhaltliche Ähnlichkeiten aufzudecken, die zwischen scheinbar unverwandten Texten bestehen. Zusammengelegt öffnen sie auch global einen Begegnungsraum, also wieder einen Dritten Raum, in dem bestehende Hierarchien beiseitegelegt werden und eine Diskussion über diesen Zwischenzustand geführt werden kann. Es ist auch ein Raum, in dem die unterschiedlichen zeitlichen Stränge und Entwicklungen aneinandergelegt werden können - die Erfahrungen in Russland und diejenigen in der neuen Heimat können z.B. gleichzeitig betrachtet werden, auch wenn einige Jahre dazwischenliegen, sie beeinflussen sich gegenseitig in beide Richtungen. Die Analyse dieser Begegnungsräume in hybriden Literaturen können nach Bachmann-Medick ein Ausdruck Ätransnationaler ‚hybrider‘ Kulturenüberlagerung“49 sein und damit ein Verständnis für dieses Phänomen schaffen, das wiederum ein besseres Verständnis für die einzelnen Akteur*innen in der neuen globalen Welt schafft.
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
- Gorelik, Lena: Meine Weißen Nächte. München: Diana Verlag 2006.
- Vapnyar, Lara: The Scent of Pine. New York: Simon & Schuster Paperbacks 2015.
Sekundärliteratur
- Bachmann-Medick, Doris: 1+1=3? Interkulturelle Beziehungen als ‚dritter Raum‘. In: Weimarer Beiträge 45/4, 1999, S. 518-531.
- Bhabha, Homi K.: Cultural Choice and the Revision of Freedom. In: Sarat, Austin; Kearns, Tomas R. (Hg.): Human rights. Concepts, contests, contingencies. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press 2001. S. 45 - 62.
- Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH 2011.
- Cohen, Yinon; Haberfeld, Yitchak; Kogan, Irena: 'Who went where? Jewish immigration from the Former Soviet Union to Israel, the USA and Germany, 1990- 2000'. In: Israel Affairs, Vol:17(1), S.7 — 20.
- Dickstein, M.: Questions of Identity: The New World of the Immigrant Writer. In: J. W. Hunter (Hg.), Contemporary Literary Criticism (Vol. 319). Detroit: Gale. http://link.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/apps/doc/H1100107459/LitRC?u=43wi en&sid=LitRC&xid=fa42047b 2012, 24.04.2018
- Esselborn, Karl: Neue Zugänge zur inter/transkulturellen deutschsprachigen Literatur. In: Schmitz, Helmut (Hg.): Von der nationalen zur internationalen Literatur. Transkulturelle deutschsprachige Literatur und Kultur im Zeitalter globaler Migration. Amsterdam - New York: Rodopi 2009. S.43-58.
- Folie, Sandra: Frauenliteratur. In: Gender Glossar.
http://www.genderglossar.de/de/glossar/item/56-frauenliteratur 2016, 03.04.2018
- Fasman, Jon: Bliss Must Be Just Around the Corner. ‘The Scent of Pine’, by Lara
Vapnyar. In: The New York Times. https://www.nytimes.com/2014/01/01/books/the- scent-of-pine-by-lara-vapnyar.html 2013, 03.04.2018
- Gilman, S. L.: Becoming a Jew by becoming a German: The newest Jewish writing
from the "East". Shofar, 25(1), 16+.
http://link.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/apps/doc/A157037009/LitRC?u=43wie n&sid=LitRC&xid=edabe012 2006, 24.04.2018
Seite 13 von 14
- Göhlich, Michael: Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur. Kontexte und Spuren
einer postkolonialen Identitätstheorie. In: Jörissen, Benjamin; Zirfas, Jörg (Hg.): Schlüsselwerke der Identitätsforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010. S.315-330.
- Mazza, Cris: Who’s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre. In: Ferriss, Suzanne/Young, Mallory (Hg.): Chick Lit: The New Woman’s Fiction. New York: Routledge 2006, S. 17-28.
- Peitz, Annette: Chick lit: genrekonstituierende Untersuchungen unter anglo- amerikanischem Einfluss. Frankfurt am Main: Lang 2010.
- Rutherford, Jonathan, & Bhabha, Homi K.: The Third Space - Interview with Homi Bhabha. In: Jonathan Rutherford (Hg.), Identity. Community, culture, difference. London: Lawrence & Wishart 1990. S. 207 - 221.
- Scott, John: "hybridity." In: A Dictionary of Sociology. Oxford University Press http://www.oxfordreference.com.uaccess.univie.ac.at/view/10.1093/acref/9780199683 581.001.0001/acref-9780199683581-e-1050 2014, 03.04.2018.
- Sruve, Karen: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. Einleitung in sein Werk. In: Moebius, Stephan(Hg.): Aktuelle und klassische Sozialund Kulturwissenschaftler|innen. Wiesbaden: Springer VS 2013.
- Sturm-Trigonakis E, Kaisar M, Margoni A.: Comparative Cultural Studies And The New Weltliteratur. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press 2013.
- The Scent of Pine. In: Goodreads. https://www.goodreads.com/book/show/17571619- the-scent-of-pine , 03.04.2018.
- Tsouderos, Trine: Revie: ‘The Scent of Pine’ by Lara Vapnyar. In: Chicago Tribune. http://www.chicagotribune.com/lifestyles/books/chi-scent-of-pine-lara-vapnyar- 20140102-story.html 2014, 03.04.2018
1 Gorelik, Lena: Meine Weißen Nächte. München: Diana Verlag 2006.
2 Vapnyar, Lara: The Scent of Pine. New York: Simon & Schuster Paperbacks 2015.
3 Folie, Sandra: Frauenliteratur. In: Gender Glossar. http://www.genderglossar. de/de/glossar/item/56-frauenliteratur 2016, 03.04.2018
4 Mazza, Cris: Who’s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre. In: Ferriss, Suzanne/Young, Mallory (Hg.): Chick Lit: The New Woman’s Fiction. New York: Routledge 2006, S. 17-28, hier S. 23
5 Peitz, Annette: Chick lit: genrekonstituierende Untersuchungen unter anglo-amerikanischem Einfluss. Frankfurt am Main: Lang 2010. S.65
6 Ebd. S. 46
Seite 2 von 14
7 Tsouderos, Trine: Revie: ‘The Scent of Pine’ by Lara Vapnyar. In: Chicago Tribune.
http://www.chicagotribune.com/lifestyles/books/chi-scent-of-pine-lara-vapnyar-20140102-story.html 2014,
03.04.2018
8 Fasman, Jon: Bliss Must Be Just Around the Corner. ‘The Scent of Pine’, by Lara Vapnyar. In: The New York Times. https://www.nytimes.com/2014/01/01/books/the-scent-of-pine-by-lara-vapnyar.html 2013, 03.04.2018
9 The Scent of Pine. In: Goodreads. https://www.goodreads.com/book/show/17571619-the-scent-of-pine ,
03.04.2018
10 Dickstein, M.:Questions of Identity: The New World of the Immigrant Writer. In J. W. Hunter (Ed.), Contemporary Literary Criticism (Vol. 319). Detroit: Gale.
http://link.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/apps/doc/H1100107459/LitRC?u=43wien&sid=LitRC&xid=fa420 47b 2012, 24.04.2018 &
Gilman, S. L.: Becoming a Jew by becoming a German: The newest Jewish writing from the "East". Shofar, 25(1), 16+.
http://link.galegroup.com.uaccess.univie.ac.at/apps/doc/A157037009/LitRC?u=43wien&sid=LitRC&xid=edabe0
12 2006, 24.04.2018
11 Cohen, Yinon , Haberfeld, Yitchak and Kogan, Irena: 'Who went where? Jewish immigration from the Former Soviet Union to Israel, the USA and Germany, 1990-2000'. In: Israel Affairs, Vol:17(1), S.7 — 20, hier S. 8
12 Esselborn, Karl: Neue Zugänge zur inter/transkulturellen deutschsprachigen Literatur. In:
Schmitz, Helmut (Hg.): Von der nationalen zur internationalen Literatur. Transkulturelle
deutschsprachige Literatur und Kultur im Zeitalter globaler Migration. Amsterdam - New York: Rodopi 2009. S.43-58, hier S. 51
Seite 3 von 14
13 Sturm-Trigonakis E, Kaisar M, Margoni A.: Comparative Cultural Studies And The New Weltliteratur. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press; 2013. S. 49
14 Esselborn, Karl: Neue Zugänge zur inter/transkulturellen deutschsprachigen Literatur. S. 52
15 Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH 2011.
Seite 4 von 14
16 Sruve, Karen: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. Einleitung in sein Werk. In: Moebius, Stephan(Hg.): Aktuelle und klassische Sozialund Kulturwissenschaftler|innen. Wiesbaden: Springer VS 2013. S. 42
17 Ebd. S. 43
18 Bhabha, Homi K.: Cultural Choice and the Revision of Freedom. In: Sarat, Austin; Kearns, Tomas R. (Hg.): Human rights. Concepts, contests, contingencies. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press 2001. S. 45 - 62, hier S. 56
19 Homi K. Bhabha nach Sruve, Karen: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha.S. 44
20 Göhlich, Michael: Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur. Kontexte und Spuren einer postkolonialen
Identitätstheorie. In: Jörissen, Benjamin; Zirfas, Jörg (Hg.): Schlüsselwerke der Identitätsforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010. S.315-330, hier S 319.
21 Rutherford, Jonathan, & Bhabha, Homi K.: The Third Space - Interview with Homi Bhabha. In: Jonathan Rutherford (Hg.), Identity. Community, culture, difference. London: Lawrence & Wishart 1990. S. 207 - 221, hier S. 211
Seite 5 von 14
22 Scott, John: "hybridity." In: A Dictionary of Sociology. Oxford University Press
http://www.oxfordreference.com.uaccess.univie.ac.at/view/10.1093/acref/9780199683581.001.0001/acref- 9780199683581-e-1050 2014, 03.04.2018
23 Ebd.
24 Sruve, Karen: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. S. 101
25 Ebd.
26 Ebd S. 102
27 Rutherford, Jonathan, & Bhabha, Homi K.: The Third Space - Interview with Homi Bhabha. In: Jonathan Rutherford (Hg.), Identity. Community, culture, difference. London: Lawrence & Wishart 1990. S. 207 - 221, hier S. 211
28 Homi K. Bhabha nach Sruve, Karen: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha.S. 117
29 Sruve, Karen: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. S. 121
30 Green, Renée nach Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH 2011. S. 5
Seite 6 von 14
31 Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur. S. 5
32 Sruve, Karen: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. S. 123
33 Bachmann-Medick, Doris: 1+1=3? Interkulturelle Beziehungen als ‚dritter Raum‘. In: Weimarer Beiträge 45/4, 1999, S. 518-531.
34 Ebd. S. 520
35 Ebd. S. 521
36 Ebd.
37 Ebd S. 527
Seite 7 von 14
38 Gorelik, Lena: Meine weißen Nächte. S. 42
39 Ebd. S. 18
40 Ebd. S. 26
41 Ebd. S.32
Seite 8 von 14
42 Vapnyar, Lara: The Scent of Pine. S.16
43 Ebd.
44 Ebd. S. 4-5
45 Gorelik, Lena: Meine weißen Nächte. S. 18
Seite 9 von 14
46 Ebd. S. 64
47 Vapnyar, Lara: The Scent of Pine. S. 5
Seite 10 von 14
48 Ebd. S.114
Seite 11 von 14
49 Bachmann-Medick, Doris: 1+1=3? S. 521.
Seite 12 von 14
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die thematischen Ähnlichkeiten zwischen Lena Goreliks "Meine Weißen Nächte" und Lara Vapnyars "The Scent of Pine", beides Romane von aus der UdSSR emigrierten jüdischen Autorinnen. Sie untersucht, inwiefern das Konzept der "Dritten Räume" von Homi K. Bhabha auf diese nicht-klassisch kolonialen Literaturen angewendet werden kann und welche Erkenntnisse über den Umgang mit Migration sichtbar werden.
Was sind die "Dritten Räume" nach Homi K. Bhabha?
Der "Dritte Raum" ist ein Konzept, das von Homi K. Bhabha entwickelt wurde, um den Zustand des "Dazwischen" zu beschreiben, in dem sich Migrant*innen befinden können. Es ist ein Raum, in dem sie sich weder der einen noch der anderen Kultur vollständig zugehörig fühlen. Es ist kein Schmelztiegel, sondern eher ein heterogenes Gemisch, in dem Differenz ohne Hierarchie existieren kann.
Wie wird Bhabhas Konzept in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit formuliert das Konzept der Dritten Räume mithilfe von Doris Bachmann-Medick auf die interkulturelle Situation außerhalb des postkolonialen Kontextes um. Es wird untersucht, ob und wo diese Dritten Räume in den beiden Romanen sichtbar werden und welche Momente in ihnen eingefangen werden. Es soll herausgefunden werden, ob in beiden Romanen in Bezug auf das Empfinden der Fremde und der Migrationserfahrung ähnliche Strukturen zum Vorschein treten.
Welche Rolle spielen die Protagonistinnen in den Romanen?
Die Protagonistinnen beider Romane stammen aus der ehemaligen UdSSR und sind nach Deutschland ("Meine Weißen Nächte") bzw. in die USA ("The Scent of Pine") migriert. Die Arbeit analysiert, wie ihre Migrationserfahrungen ihr Leben und ihre Identität prägen, und wie sie sich in den Dritten Räumen zwischen ihrer alten und neuen Heimat bewegen.
Welche Bedeutung haben die Liebesbeziehungen in den Romanen?
Die Liebesbeziehungen, insbesondere die Liebesdreiecke, die in beiden Romanen behandelt werden, dienen als Werkzeug, um die inneren Prozesse der Protagonistinnen zu verdeutlichen. Die Männer in ihrem Leben stehen metaphorisch für die Momente der Identifikation mit der einen oder anderen Kultur (Russland und Deutschland/USA) und die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass sowohl "Meine Weißen Nächte" als auch "The Scent of Pine" wertvolle Einblicke in die weibliche Migrationserfahrung bieten. Durch das Aufdecken der Dritten Räume wird gezeigt, dass durch Migration etwas Neues entsteht und nicht lediglich die Vermischung von zwei essentialistischen Kulturen. Die Analyse dieser Begegnungsräume in hybriden Literaturen kann ein Ausdruck transnationaler Kulturenüberlagerung sein und damit ein Verständnis für dieses Phänomen schaffen, das wiederum ein besseres Verständnis für die einzelnen Akteur*innen in der neuen globalen Welt schafft.
Welche Literatur wurde in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl Primärliteratur (die Romane "Meine Weißen Nächte" und "The Scent of Pine") als auch Sekundärliteratur, darunter Werke von Homi K. Bhabha, Doris Bachmann-Medick und anderen Expert*innen auf dem Gebiet der Migrationsforschung und Postkolonialen Theorie.
- Citar trabajo
- Kristina Chakhrai (Autor), 2018, Begegnungen und dritte Räume in "Meine Weißen Nächte" von Lena Gorelik und "The Scent of Pine" von Lara Vapnyar, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430816