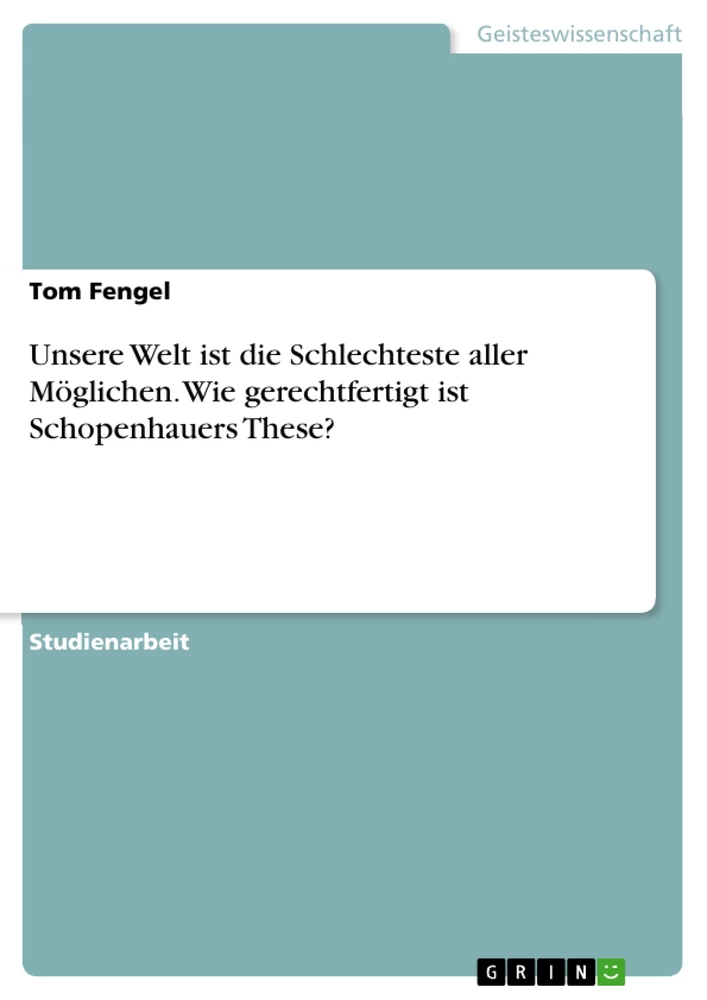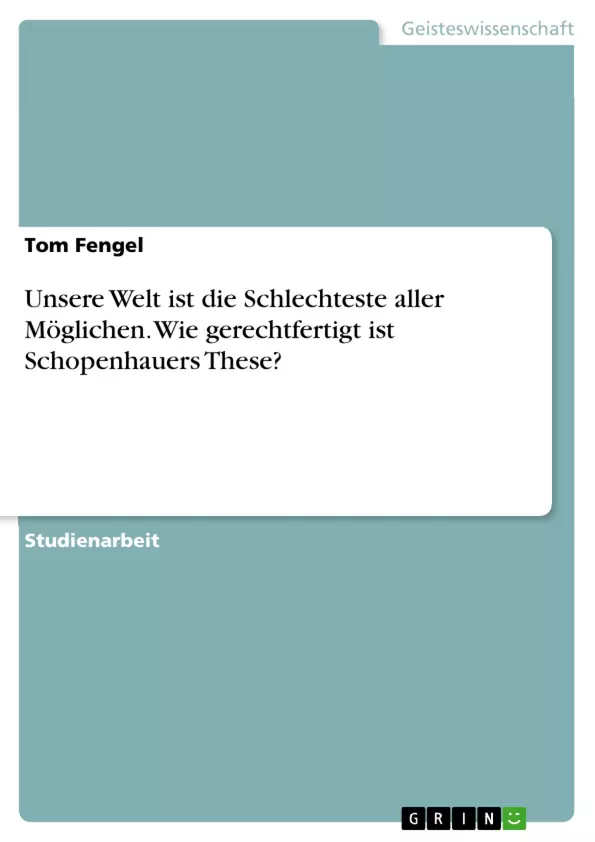Arthur Schopenhauer gilt oft als Pessimist. Der Grund hierfür findet sich in seiner Betrachtung der Welt und des Lebens darin. So kommt er zu dem Schluss, dass unsere Welt, im Gegensatz zum Leibniz’schen Optimismus, eben nicht die beste aller möglichen sondern die Schlechteste des nur Denkbaren sei.
Diese Arbeit untersucht, wie gerechtfertigt Schopenhauers Aussage ist. Dazu werden die grundlegenden philosophischen Positionen seines Hauptwerkes erläutert und bewertet.
Die Erklärungsansätze für mein Vorhaben suche ich in der moderneren Selbstorganisationsforschung, um seine Weltansicht auf ein Modell zu übertragen, welches die Negativität seiner Auslegung entkräften könnte. Zum anderen soll die reine Logik der Bewertung seiner Argumente dienen, da ich einige Widersprüche in den fundamentalen Ansätzen seiner Philosophie in Übertragung auf die fragliche These sehe. Letztendlich will ich also eine Aussage über die Legitimität der These „Unsere Welt ist die schlechteste aller möglichen Welten“ treffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Weltkonzeption Schopenhauers
- 2.1 Die Welt als Wille und Vorstellung
- 2.1.1 Die Welt als Vorstellung
- 2.1.2 Die Welt als Wille
- 2.1 Die Welt als Wille und Vorstellung
- 3 Die Welt als Schlechteste aller Möglichen
- 3.1 Der Tod ist der Unsinn des Lebens
- 3.2 Der Unendliche Fortsatz der Bedürftigkeit
- 3.3 Das Leid wird positiv, die Freude negativ verspürt
- 3.4 Das Verhältnis von Freud und Leid
- 3.5 Der Egoismus des Menschen
- 3.6 Die Welt hat keinen Zweck
- 3.6.1 Das Leben ist eine Strafe
- 3.7 Wäre die Welt noch schlechter, wäre sie nicht mehr möglich
- 4 Kritik an Schopenhauers Argumenten der schlecht-möglichsten Welt
- 4.1 Zu: Der Tod ist der Unsinn des Lebens
- 4.2 Zu: Der Unendliche Fortsatz der Bedürftigkeit
- 4.3 Zu: Das Leid wird positiv, die Freude negativ verspürt
- 4.4 Zu: Das Verhältnis von Freud und Leid
- 4.5 Zu: Der Egoismus des Menschen
- 4.6 Zu: Die Welt hat keinen Zweck
- 4.7 Zu: Wäre die Welt noch schlechter, wäre sie nicht mehr möglich
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arthur Schopenhauers These, dass unsere Welt die schlechteste aller möglichen Welten ist. Es werden zunächst die grundlegenden Elemente seiner Weltanschauung, insbesondere die Unterscheidung von Wille und Vorstellung sowie die Beziehung von Subjekt und Objekt, beleuchtet. Anschließend werden die Argumente Schopenhauers für seine These der schlecht-möglichsten Welt vorgestellt und analysiert.
- Die Welt als Wille und Vorstellung
- Der Tod als Unsinn des Lebens
- Das unendliche Streben nach Bedürfnisbefriedigung
- Das Verhältnis von Leid und Freude
- Die Zwecklosigkeit der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Schopenhauers Pessimismus und seine These der schlecht-möglichsten Welt vor. Sie führt den Leser in die Zielsetzung und die Methodik der Arbeit ein.
Kapitel 2 präsentiert die Weltkonzeption Schopenhauers. Es wird erläutert, wie er die Welt als Wille und Vorstellung versteht und welche Rolle das Verhältnis von Subjekt und Objekt in seiner Philosophie spielt.
Kapitel 3 untersucht die Argumente Schopenhauers für seine These, dass unsere Welt die schlechteste aller möglichen Welten ist. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie z.B. den Tod als Unsinn des Lebens, das unendliche Streben nach Bedürfnisbefriedigung und die Überwiegung von Leid gegenüber Freude.
Kapitel 4 kritisiert Schopenhauers Argumente der schlecht-möglichsten Welt. Es werden verschiedene Kritikpunkte und Einwände gegen seine Argumentation aufgezeigt.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Legitimität der These Schopenhauers.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Arthur Schopenhauer, seiner Philosophie des Willens und der Vorstellung, der These der schlecht-möglichsten Welt, der Kritik an seiner Argumentation, sowie dem Verhältnis von Subjekt und Objekt in der Welt.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Schopenhauers These der „schlechtesten aller möglichen Welten“?
Im Gegensatz zu Leibniz’ Optimismus behauptet Schopenhauer, dass die Welt so schlecht wie gerade noch möglich eingerichtet ist, um noch existieren zu können.
Was bedeutet „Die Welt als Wille und Vorstellung“?
Schopenhauer sieht die Welt einerseits als unsere subjektive Vorstellung und andererseits als einen blinden, rastlosen Urwillen, der alles antreibt.
Warum sieht Schopenhauer das Leid als „positiv“ an?
Er argumentiert, dass Leid unmittelbar spürbar ist, während Freude oder Glück lediglich als Abwesenheit von Schmerz (negativ) empfunden werden.
Welche Rolle spielt der Tod in Schopenhauers Philosophie?
Er betrachtet den Tod als den „Unsinn des Lebens“, der die Zwecklosigkeit des individuellen Strebens verdeutlicht.
Wie kritisiert die Arbeit Schopenhauers Argumentation?
Die Arbeit nutzt Ansätze der modernen Selbstorganisationsforschung und logische Analysen, um Widersprüche in Schopenhauers pessimistischer Auslegung aufzuzeigen.
- Quote paper
- Tom Fengel (Author), 2015, Unsere Welt ist die Schlechteste aller Möglichen. Wie gerechtfertigt ist Schopenhauers These?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/430850