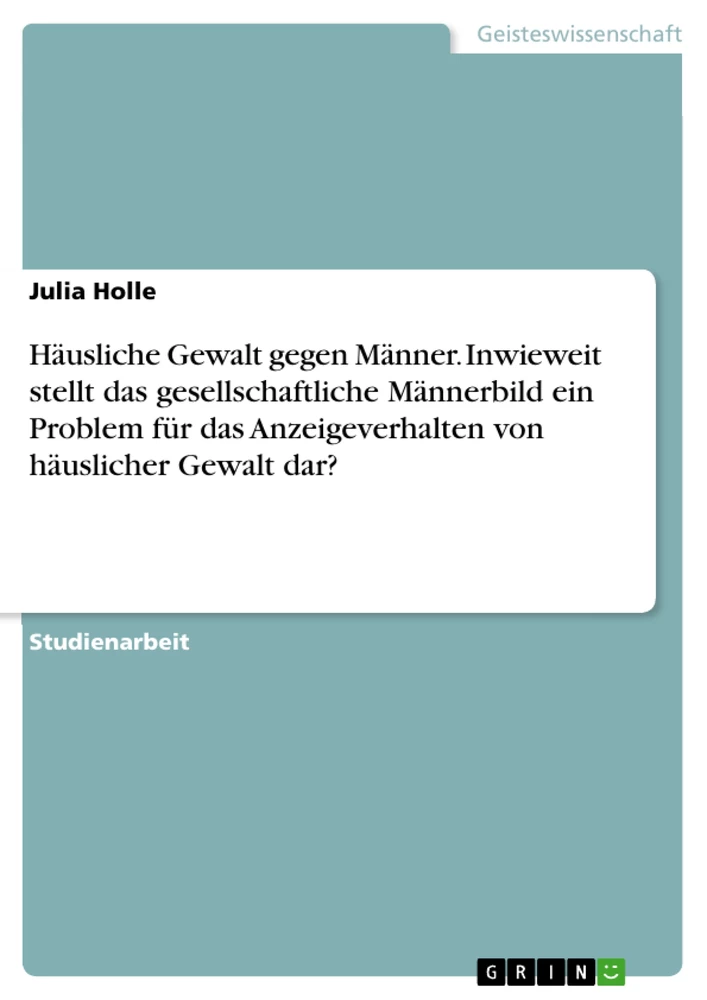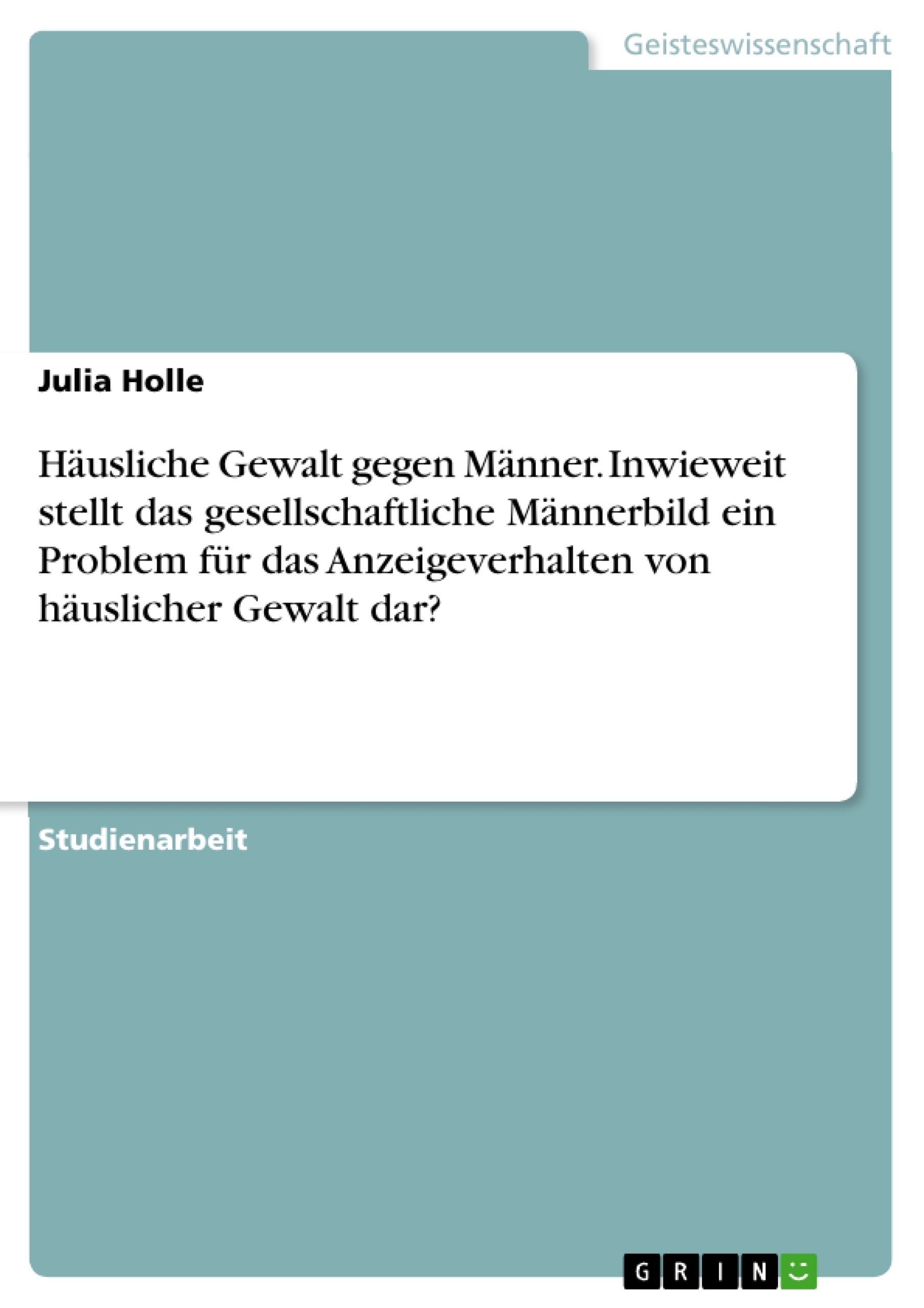Häusliche Gewalt findet in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, noch sehr häufig statt. Wenn von häuslicher Gewalt gesprochen wird, assoziiert man hiermit einen gewalttätigen Mann, der eine unschuldige Frau schlägt. Aber ist das immer so? Wer schlägt eigentlich wen? Und warum ist die Dunkelziffer in diesem Bereich so hoch? Welche Ergebnisse brachte die Forschung in diesem Bereich? Und vor allem: Inwieweit stellt das gesellschaftliche Männerbild ein Problem für das Anzeigeverhalten von häuslicher Gewalt dar? Dieses Themenfeld und die damit zusammenhängenden Fragen werden in dieser Hausarbeit erarbeitet. Im Vordergrund steht das Gewalterleiden von Männern in Deutschland und das Rollenbild des männlichen Geschlechts in der heutigen Gesellschaft und im Kontext häuslicher Gewalt. Zunächst werden in dieser Arbeit die Begrifflichkeiten Gewalt und Häusliche Gewalt zum besseren Verständnis definiert. Außerdem wird auf die Zusammenhänge häuslicher Gewalt in der Gesellschaft geschaut und ob die Stellung in der Gesellschaft wie beispielsweise die Schichtzugehörigkeit eine Rolle spielt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Häusliche Gewalt gegen Männer
- Das männliche Rollenbild
- Das männliche Rollenbild in der Gesellschaft
- Das männliche Rollenbild im Kontext häuslicher Gewalt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht häusliche Gewalt gegen Männer in Deutschland und beleuchtet die Rolle des männlichen Rollenbilds in der heutigen Gesellschaft und im Kontext häuslicher Gewalt. Besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen für das Anzeigeverhalten von Männern bei häuslicher Gewalt.
- Definition der Begriffe Gewalt und Häusliche Gewalt
- Häufigkeit und Ausprägungen von häuslicher Gewalt gegen Männer
- Einfluss des männlichen Rollenbilds auf das Anzeigeverhalten
- Die Bedeutung der Dunkelziffer in diesem Bereich
- Zusammenhänge zwischen häuslicher Gewalt und sozialer Stellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik von häuslicher Gewalt in Deutschland dar und beleuchtet die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Gewalt gegen Frauen und Männern. Sie führt die zentralen Forschungsfragen ein, die in der Hausarbeit behandelt werden.
Häusliche Gewalt gegen Männer
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen von Gewalt und Häuslicher Gewalt. Es werden die Formen und Ausprägungen von Gewalt, sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene, erörtert. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten von Häuslicher Gewalt, der Unterscheidung zwischen systematischem Kontrollverhalten und spontanem Konfliktverhalten und den verschiedenen Gewaltformen, die auftreten können.
Das männliche Rollenbild
Dieses Kapitel analysiert die Rolle des männlichen Rollenbilds in der Gesellschaft und im Kontext häuslicher Gewalt. Es beleuchtet, wie traditionelle männliche Rollenbilder das Anzeigeverhalten von Männern bei häuslicher Gewalt beeinflussen können. Das Kapitel untersucht mögliche Ursachen für die Unterrepräsentation von Männern als Opfer häuslicher Gewalt.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, Männer, Rollenbild, Anzeigeverhalten, Dunkelziffer, Gewaltkreislauf, Systematisches Kontrollverhalten, Spontanes Konfliktverhalten, Gesellschaftliche Normen, strukturelle Gewalt, personale Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Wie oft kommt häusliche Gewalt gegen Männer in Deutschland vor?
Obwohl genaue Zahlen aufgrund einer hohen Dunkelziffer schwer zu ermitteln sind, zeigen Studien, dass Männer signifikant häufiger Opfer häuslicher Gewalt werden als gesellschaftlich wahrgenommen.
Warum zeigen Männer häusliche Gewalt seltener an?
Das gesellschaftliche Männerbild (der „starke“ Mann) führt oft zu Schamgefühlen und der Sorge, als Opfer nicht ernst genommen zu werden.
Was ist der Unterschied zwischen systematischem Kontrollverhalten und spontanem Konfliktverhalten?
Systematische Gewalt dient der Machtausübung und Unterdrückung, während spontanes Konfliktverhalten aus einer akuten Situation heraus ohne langfristiges Kontrollmotiv entsteht.
Spielt die soziale Schicht eine Rolle bei häuslicher Gewalt?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die gesellschaftliche Stellung und Schichtzugehörigkeit Einfluss auf das Vorkommen und die Wahrnehmung von Gewalt haben.
Was versteht man unter struktureller Gewalt im Kontext von Männern?
Strukturelle Gewalt bezieht sich auf gesellschaftliche Normen und Rollenbilder, die Männer daran hindern, sich als Opfer zu bekennen oder Hilfe zu suchen.
- Citation du texte
- Julia Holle (Auteur), 2017, Häusliche Gewalt gegen Männer. Inwieweit stellt das gesellschaftliche Männerbild ein Problem für das Anzeigeverhalten von häuslicher Gewalt dar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431006