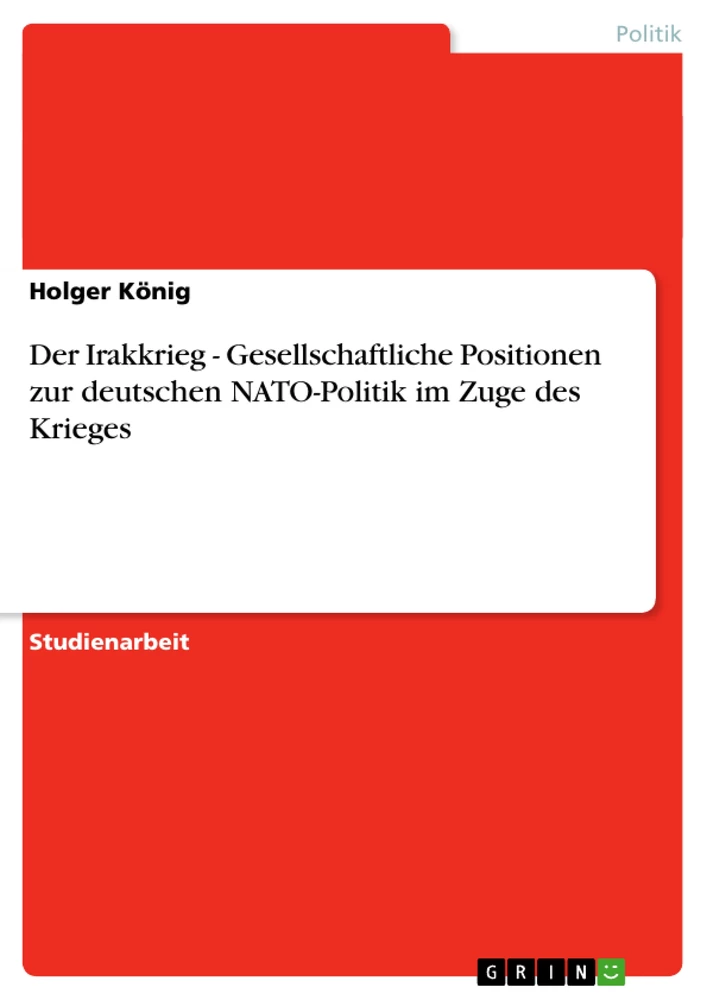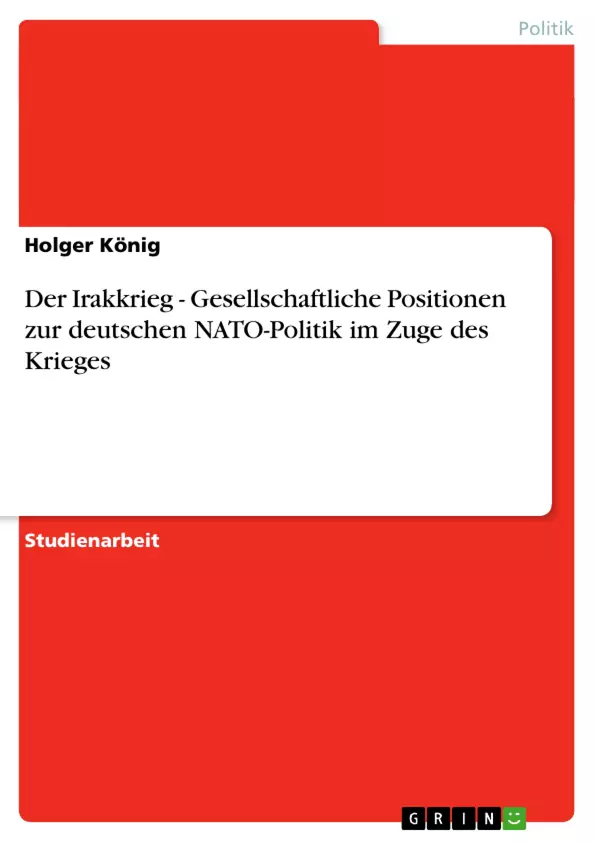Wie es von einem terroristischen Akt dieser Größenordnung zu erwarten war, haben die Anschläge auf die USA am 11. September 2001 die internationale Politik kräftig in Bewegung gebracht. Erstmals in ihrer Geschichte sind die Vereinigten Staaten direkt angegriffen worden und mit dem World Trade Center und dem Pentagon zwei Symbole ihrer Macht getroffen. Fast 3000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Zum ersten Mal war eine der „neuen Gefahren“ manifest geworden, von denen seit 1990 viel gesprochen wurde: der internationale Terrorismus. Zwar gab es schon vor dem 11. September Terroranschläge von zum Teil erheblichem Ausmaß wie zum Beispiel auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam, aber mit dem 11. September hat der Terror eine neue Dimension erlangt.
Angesichts dieser Tatsachen boten die Anschläge jeden Anlass, über die neuen Gefahren intensiver nachzudenken und neue Strategien zu ihrer Bekämpfung auszuarbeiten. Im Gefühl der Verwundbarkeit und im Schock der Verwundung wurden und werden die Gefahren des Terrorismus von den internationalen Akteuren unterschiedlich wahrgenommen. Aus diesen divergierenden Bedrohungswahrnehmungen resultieren unterschiedliche Handlungsszenarien und ein unterschiedlicher Grad an Kooperationsbereitschaft. Die USA sahen und sehen sich in einem Kriegszustand gegen den internationalen Terrorismus, während von den meisten Europäern der Terrorismus zwar ebenfalls als Gefahr anerkannt wird, dessen Bedeutung jedoch in den USA tendenziell überschätzt werde. Nur 64 Prozent der Europäer empfinden den Terrorismus als tatsächlich ernste Gefahr, gegenüber 91 Prozent der Amerikaner.
Der 11. September ereignete sich in einer Zeit globaler politischer Umbrüche. Die relativ festen bipolaren Grundstrukturen des Kalten Krieges waren mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den Transformationsprozessen im Ostblock in Bewegung geraten. Nach anfänglichen Unsicherheiten im Umgang mit der neuen Weltordnung waren die USA spätestens unter George W. Bush zu einer Politik der robusten Interessendurchsetzung und Unilateralismus übergegangen.
In Europa arbeitete man an einem Integrationsprozess mit wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Komponenten sowie einer Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei wollte man zu einem gleichwertigen, emanzipierten Partner der USA heranwachsen und auf internationaler Ebene einen entsprechenden Einfluss sichern, sowie die geforderte Verantwortung tragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Chronik des Konfliktes im Irak
- Chronologie des Krieges im Irak
- Der Irakkrieg im Blickpunkt internationaler Organisationen
- Die Rolle der UNO und des Sicherheitsrates
- Die Rolle der NATO
- Die deutsche Politik im Konflikt um den Irak
- Deutsche NATO-Politik im Vorfeld des Krieges
- Deutsche NATO-Politik während des Krieges
- Deutsche NATO-Politik nach dem Krieg
- Gesellschaftliche Positionen zum Irakkrieg
- Politische Parteien
- Die CDU/CSU
- Die F.D.P.
- PDS
- BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
- Die Friedensdemonstranten
- Die Kirche
- Gewerkschaften
- sonstige Positionen
- Schlussbetrachtungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den gesellschaftlichen Positionen zur deutschen NATO-Politik im Kontext des Irakkrieges. Sie analysiert die verschiedenen Perspektiven und Meinungen im Vorfeld, während und nach dem Krieg im Jahr 2003. Die Arbeit untersucht dabei die Rolle der NATO, die deutsche Politik sowie die Stellungnahmen von politischen Parteien, Friedensdemonstranten, Kirchen, Gewerkschaften und weiteren gesellschaftlichen Akteuren.
- Die Rolle der NATO und ihre Umgestaltung im Zuge des „war on terrorism“
- Die deutsche NATO-Politik im Vorfeld, während und nach dem Irakkrieg
- Die gesellschaftlichen Positionen zum Irakkrieg und der deutschen NATO-Politik
- Die Positionen der verschiedenen politischen Parteien zum Irakkrieg
- Die Rolle von Friedensdemonstranten, Kirchen und Gewerkschaften in der Debatte um den Irakkrieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einordnung des Irakkrieges in den Kontext der internationalen Politik nach dem 11. September 2001. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Reaktionen auf die Anschläge und die resultierenden divergierenden Bedrohungswahrnehmungen. Anschließend wird die Chronik des Konfliktes im Irak dargestellt, wobei die Entwicklung der US-Irak-Beziehungen, die Rolle des Sicherheitsrates und die Position der NATO im Vorfeld des Krieges im Detail behandelt werden.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die deutsche Politik im Konflikt um den Irak. Es werden die verschiedenen Phasen der deutschen NATO-Politik im Vorfeld, während und nach dem Krieg untersucht, insbesondere im Hinblick auf die Rolle Deutschlands innerhalb der NATO-Allianz.
Im vierten Kapitel stehen die gesellschaftlichen Positionen zum Irakkrieg im Mittelpunkt. Hier werden die Standpunkte und Argumentationen von politischen Parteien, Friedensdemonstranten, Kirchen, Gewerkschaften und weiteren gesellschaftlichen Akteuren in Bezug auf den Krieg und die deutsche NATO-Politik analysiert.
Schlussendlich werden in einem abschließenden Kapitel die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf die Zukunft geworfen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der internationalen Politik, der Sicherheitspolitik und der deutschen Außenpolitik. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Irakkrieg, NATO, Deutschland, Sicherheitspolitik, Multilateralismus, Terrorismus, Friedensdemonstranten, politische Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, gesellschaftliche Positionen.
- Quote paper
- Holger König (Author), 2004, Der Irakkrieg - Gesellschaftliche Positionen zur deutschen NATO-Politik im Zuge des Krieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43164