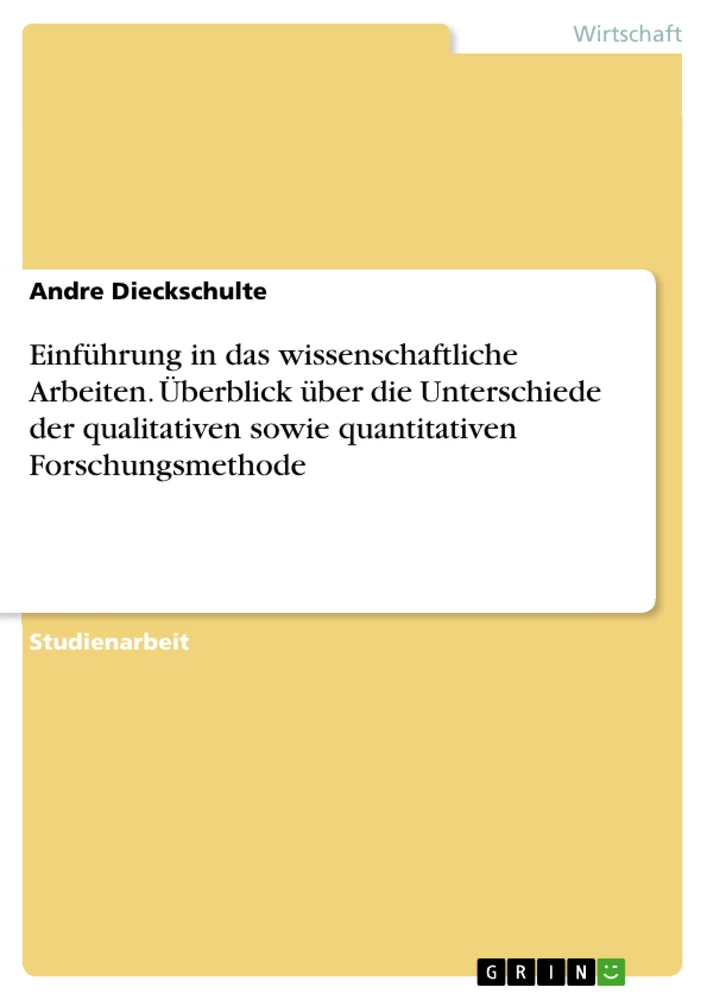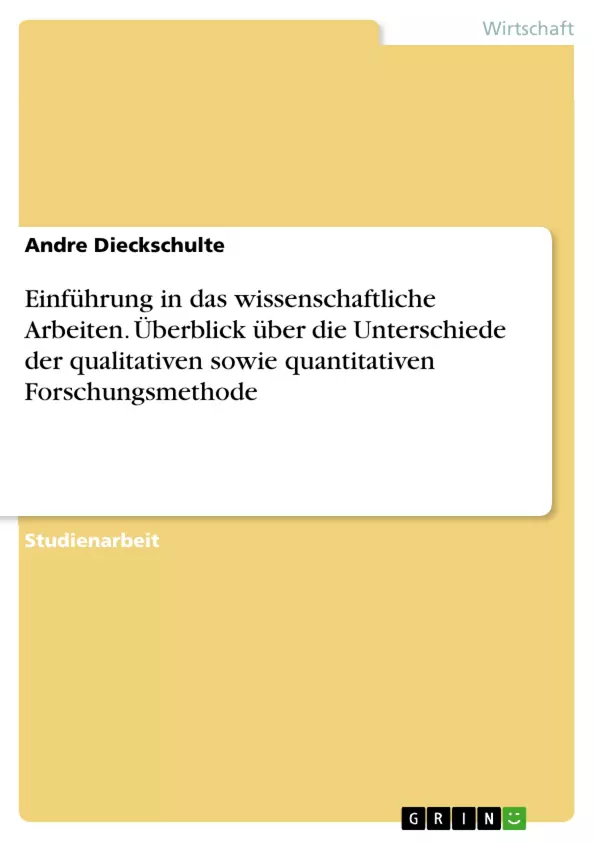In vielen wissenschaftlichen Bereichen ist empirische Forschung von signifikanter Bedeutung. Wichtig ist in Bezug auf die Herangehensweise vor allem das Verfahren. Bevor die Arbeit begonnen wird, muss zunächst entschieden werden, welche Methode angewendet werden soll. Eine tragende Rolle spielt diese Entscheidung besonders in den Sozialwissenschaften, mehr als in den Naturwissenschaften. Methodisches Vorgehen ist unerlässlich in der empirischen Sozialforschung und somit auch für viele sozialwissenschaftliche Studiengänge. Welche Methodik verwendet wird, wird durch die Universität und dem Fach abhängig gemacht. An einigen Universitäten wird der Schwerpunkt auf quantitative Forschung, an anderen Universitäten wird der Fokus auf die qualitative Forschung gelegt, hier macht es durchaus Sinn sich den Ausbildungsplan in den einzelnen Fachbereichen durch zu lesen, ein gleichberechtigter Schwerpunkt zwischen quantitative und qualitative Forschung ist viel zu selten zu finden. Baur und Blasius zeigen auf, das auch auf nationaler bzw. geografischer Ebene, Unterschiede vorhanden sind. Laut ihrer Nachforschung wird in Großbritannien eher die qualitative Forschung herangezogen, die Niederlanden tendieren zur quantitativen Methode. Je nach Wahl der Universität und deren Grundverständnis, als auch die Wahl, in welchem Land man studiert und lernt, entscheidet über die bevorzugte Methodik.
Daher die Schlussfolgerung, dass beide Methoden ihre Berechtigung haben und gleichberechtigt zu behandeln sind bei der eigenen Forschung. Jegliche Art von Eingrenzung im Vorfeld, begrenzt die Möglichkeiten der Forschung und der damit einhergehenden Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Die folgende Metapher soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: In unserer Annahme gehen wir von zwei Tischler aus, Tischler Müller hat eine Handsäge, mit der er alle seine Aufgaben sehr gut erledigt. Tischler Maier hat eine Handsäge und eine Stichsäge im Werkzeugkoffer, auch er ist überzeugt der bessere Tischler zu sein. Wer von den beiden Tischlern hat wirklich in seinem alltäglichen Arbeitsleben den Vorteil? Tischler Maier, weil er mehr Sägen besitzt mit denen er variieren kann, oder Tischler Müller mit seiner Handsäge ohne Variationsmöglichkeit. Es wird der Tischler mit den zwei Sägen sein, er besitzt mehr Einsatzmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abbildungsverzeichnis
- III. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung - Einführung in das Thema
- 2. Unterschiede der qualitativen & quantitativen Forschung
- 2.1 Was ist
- 2.1.1 ..qualitative Forschung?
- 2.1.2..quantitative Forschung?
- 2.1.3. Zwischenfazit - Über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- 2.2 Daten und Datenanalyse
- 2.2.1...der qualitativen Forschung
- 2.2.2...der quantitativen Forschung
- 2.2.3 Zwischenfall - Über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Verfahren
- 2.3 Ablauf der Forschung
- 2.3.1 ... mithilfe der Zirkuläre Strategie (qualitativen Forschung)
- 2.3.2... mithilfe der Lineare Strategie (quantitativen Forschung)
- 2.3.3 Zwischenfall - Darlegung der Unterschiede der Strategien
- 3. Fazit & Ausblick
- IV. Literaturverzeichnis
- Verschiedene Ansätze in der qualitativen und quantitativen Forschung
- Vergleich der Datenanalysemethoden
- Logik und Ablauf der Forschung
- Vorteile und Nachteile beider Methoden im wissenschaftlichen Kontext
- Relevanz der Methodenauswahl für wissenschaftliche Fragestellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Unterschiede zwischen qualitativer und quantitativer Forschungsmethode im wissenschaftlichen Arbeiten aufzuzeigen. Dabei werden die beiden Ansätze zunächst in ihren Grundzügen vorgestellt und anschließend hinsichtlich ihrer Datenanalyse, Logik und Vorgehensweise verglichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der qualitativen und quantitativen Forschung ein und unterstreicht die Bedeutung methodischen Vorgehens in den Sozialwissenschaften. Im zweiten Kapitel wird die qualitative und quantitative Forschung vorgestellt. Es werden jeweils die Grundprinzipien, die Datenanalyse, die Logik und der Ablauf der Forschung erläutert. Abschließende Zwischenfazits betonen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Methoden. Die Kapitel schließen mit einem Fazit und Ausblick auf die Relevanz der Thematik in der wissenschaftlichen Praxis.
Schlüsselwörter
Qualitative Forschung, quantitative Forschung, Methodenvergleich, empirische Sozialforschung, Datenanalyse, Forschungsprozess, wissenschaftliches Arbeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung?
Quantitative Forschung arbeitet linear und zielt auf messbare, statistische Daten ab, während qualitative Forschung zirkulär verläuft und das tiefe Verständnis von Einzelfällen anstrebt.
Wann sollte man die qualitative Methode wählen?
Sie ist ideal, um neue Forschungsfelder zu erschließen, subjektive Erfahrungen zu verstehen oder komplexe soziale Phänomene im Detail zu analysieren.
Was kennzeichnet die quantitative Methode?
Kennzeichnend sind große Fallzahlen, die Arbeit mit Hypothesen, standardisierte Datenerhebung (z. B. Umfragen) und die statistische Auswertung der Ergebnisse.
Gibt es regionale Unterschiede in der Anwendung dieser Methoden?
Ja, Studien zeigen, dass beispielsweise in Großbritannien die qualitative Forschung dominanter ist, während in den Niederlanden eher quantitativ gearbeitet wird.
Warum ist ein Methodenmix (Mixed Methods) oft sinnvoll?
Wie die Metapher der zwei Sägen verdeutlicht, hat ein Forscher mit beiden Methoden mehr Einsatzmöglichkeiten und kann Ergebnisse umfassender validieren.
Wie unterscheidet sich die Strategie des Forschungsablaufs?
Qualitative Forschung nutzt oft eine zirkuläre Strategie (Anpassung während des Prozesses), quantitative Forschung eine lineare Strategie (strikte Abfolge von Planung bis Analyse).
- Citar trabajo
- Andre Dieckschulte (Autor), 2018, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Überblick über die Unterschiede der qualitativen sowie quantitativen Forschungsmethode, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431640