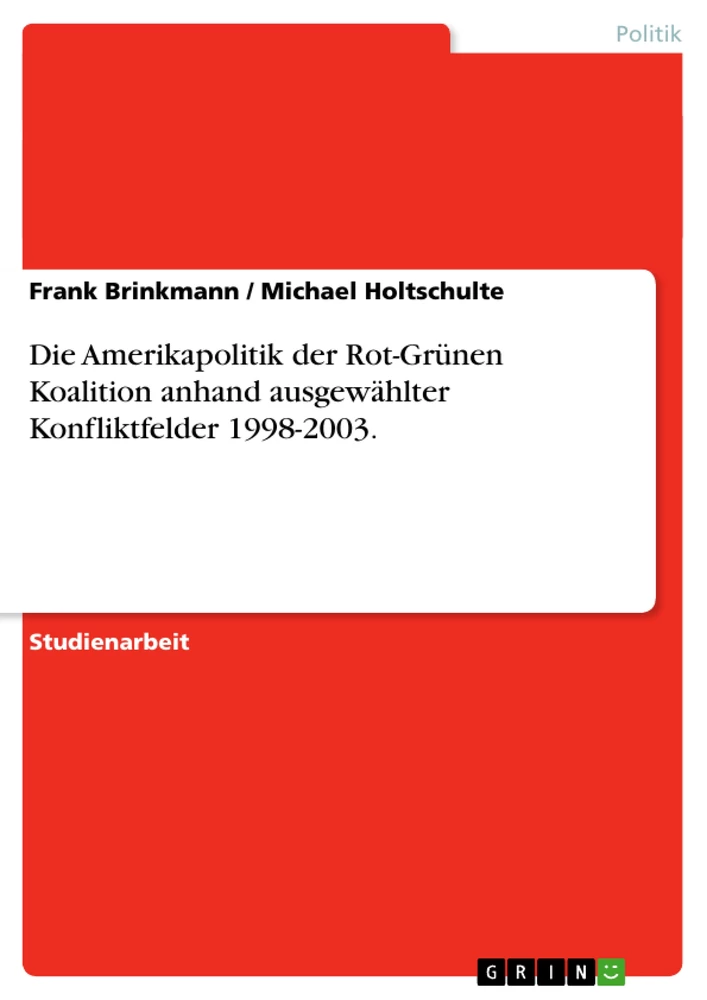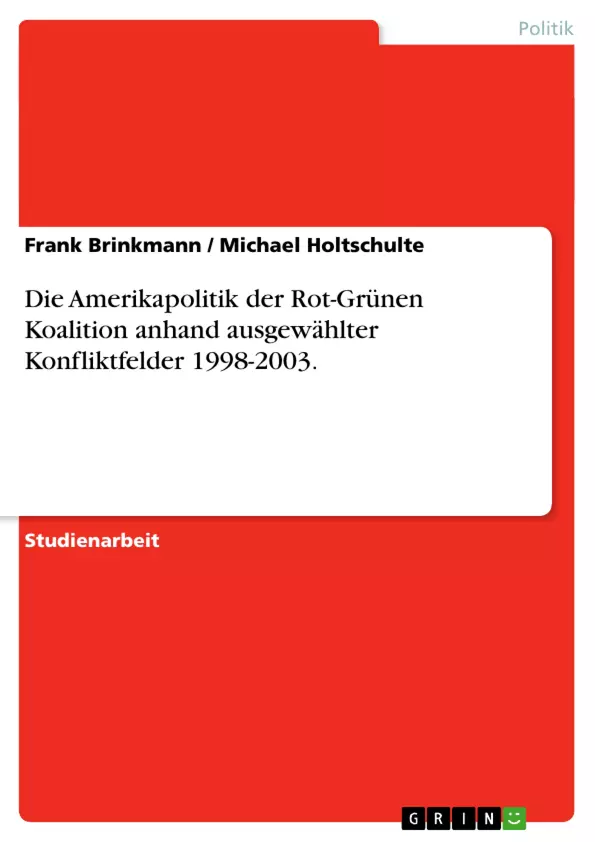Hinsichtlich der Entwicklungsgeschichte deutsch-amerikanischer Beziehungen bietet sich eine grobe Einteilung in drei Phasen an1: 1945 bis 1955 - die Phase der Besatzung und des Besatzungsstatuts: Nach der nationalsozialistischen Herrschaft war Deutschland durch die Alliierten militärisch besetzt. Die Amerikanische Besatzung führte nach wenigen Jahren zu Partnerschaft und Kooperation. Verantwortlich dafür war die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Siegermächten bereits kurz nach Ende des Krieges. Die daraus resultierende Ost-West- Konfrontation veranlasste die Großmächte USA und UdSSR dazu, die Beziehungen zu ihrem neuen Alliierten (BRD, bzw. DDR) zu intensivieren. Die Vereinigten Staaten brauchten einen demokratischen, wirtschaftlich potenten, sowie zu militärischer Kooperation bereiten Verbündeten an der Nahtstelle zum Ostblock. Für die junge Bundesrepublik waren die Beziehungen zu den USA von noch größerer Bedeutung: sie boten Westdeutschland einen Weg zurück auf die internationale Bühne und damit einen Zugang zur internationalen Politik. 1955 bis 1990 - die Phase grundsätzlicher Übereinstimmung:
In den folgenden 35 Jahren stimmten beide Länder in den meisten politischen und militärischen Fragen "im Grundsatz" überein. Das schloss nicht aus, dass es in Einzelfragen Auseinandersetzungen gab: transatlantische Handelsstreitigkeiten, Debatten über Wirtschaftsbeziehungen zum Ostblock, auch persönliche Probleme zwischen Helmut Schmidt und Jimmy Carter zum Ende der siebziger Jahre. Der dominante Konflikt dieser Phase betraf jedoch die Sicherheitspolitik. In den fünfziger Jahren gab es Kontroversen über den deutschen Wehrbeitrag, in den sechziger Jahren ging es um die Frage nach der neuen strategischen Verteidigungskonzeption der flexiblen Antwort, in den siebziger Jahren wurden Amerikas Verstrickungen in den Vietnam-Krieg kritisiert und in den achtziger Jahren beherrschte die Nachrüstungsdebatte und die Entwicklung neuer Waffentechnologien (Neutronenbombe, SDI) die Sicherheitsdiskussion. 2 1990 bis 1998 - Die Phase nach Ende des Ost-West-Konflikts: Die Jahre nach 1990 waren durch beharrliches Suchen nach einer neuen Basis transatlantischer Zusammenarbeit gekennzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Epilog
- 1. Einleitung
- 2. Die Rot-Grüne Koalition 1998: mögliche Bedenken..?
- 2.1. Die SPD vor der Wahl: Rhetorische Kontinuität
- 2-2. Die Grünen vor der Wahl: Gemeinwohl vor nationalen Interessen
- 2 - 3. Der Koalitionsvertrag
- 3. Ausgewählte Konfliktfelder
- 3 1. Erste Anzeichen transatlantischer Irritationen
- 3- 2. Der Kosovo – Krieg
- 3 3. Nationale Raketenabwehr
- 3-4. Die Multilateralismus - Debatten
- 3 - 5. Der 11. September 2001 & Afghanistan: Solidarität unter Vorbehalt
- 3- 6. Der Irak-Konflikt
- 4. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Außenpolitik der Rot-Grünen Koalition in Bezug auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen im Zeitraum von 1998 bis 2003. Sie untersucht die Herausforderungen, die sich für Deutschland durch die veränderte Weltordnung nach dem Ende des Kalten Krieges ergeben, und beleuchtet die Konflikte, die aufgrund unterschiedlicher politischer Vorstellungen zwischen den beiden Ländern entstanden sind.
- Die Rhetorik der Kontinuität in der deutschen Außenpolitik angesichts neuer globaler Herausforderungen
- Die Rolle der Rot-Grünen Koalition in der Gestaltung der deutsch-amerikanischen Beziehungen
- Die Analyse ausgewählter Konfliktfelder wie dem Kosovo-Krieg, der nationalen Raketenabwehr, dem 11. September und dem Irak-Konflikt
- Die Auswirkungen des veränderten Machtgefüges auf die transatlantische Zusammenarbeit
- Die Suche nach einer neuen Ausrichtung der deutschen Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem kurzen Exkurs in die Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen, um den historischen Kontext der aktuellen Problematik zu beleuchten. Anschließend wird die politische Ausrichtung der Rot-Grünen Koalition durch die Analyse der Wahlprogramme der SPD und der Grünen sowie des Koalitionsvertrags dargestellt. Dabei werden bereits die grundlegenden Konfliktfelder zwischen Deutschland und den USA deutlich.
Im Kapitel "Ausgewählte Konfliktfelder" werden verschiedene Problemstellungen aus dem Zeitraum von 1998-2003 analysiert. Dazu gehören der Kosovo-Krieg, die Debatten um die nationale Raketenabwehr, der 11. September mit seinen Folgen und der Irak-Konflikt. Diese Konfliktfelder werden im Kontext der veränderten Weltordnung und der unterschiedlichen politischen Vorstellungen Deutschlands und der USA betrachtet.
Das letzte Kapitel bietet einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen und beleuchtet die gewonnenen Erkenntnisse der Arbeit.
Schlüsselwörter
Deutsch-amerikanische Beziehungen, Außenpolitik, Rot-Grüne Koalition, transatlantische Beziehungen, Kosovo-Krieg, nationale Raketenabwehr, 11. September, Irak-Konflikt, Multilateralismus, neue Weltordnung, Rhetorik der Kontinuität, politisches Selbstverständnis, globale Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen zur Rot-Grünen Amerikapolitik (1998-2003)
Wie veränderte sich das Verhältnis zu den USA nach 9/11?
Zunächst gab es eine Phase der "uneingeschränkten Solidarität", die jedoch durch Differenzen über den Irak-Krieg in eine tiefe Krise überging.
Was war der Hauptkonfliktpunkt im Irak-Krieg?
Die deutsche Bundesregierung unter Gerhard Schröder lehnte eine militärische Beteiligung ohne UN-Mandat strikt ab, was zum Bruch mit der Bush-Administration führte.
Welche Rolle spielte der Kosovo-Krieg für Rot-Grün?
Es war der erste Kampfeinsatz der Bundeswehr, der die Koalition vor große Zerreißproben stellte, aber die transatlantische Bindung festigte.
Was ist Multilateralismus in der deutschen Außenpolitik?
Das Prinzip, internationale Probleme nur gemeinsam mit Partnern und innerhalb internationaler Organisationen (wie der UN) zu lösen.
Was bedeutet "Rhetorik der Kontinuität"?
Das Bestreben der Bundesregierung, trotz neuer Konflikte nach außen hin an der traditionellen Westbindung und Partnerschaft mit den USA festzuhalten.
- Quote paper
- Frank Brinkmann (Author), Michael Holtschulte (Author), 2004, Die Amerikapolitik der Rot-Grünen Koalition anhand ausgewählter Konfliktfelder 1998-2003., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43251