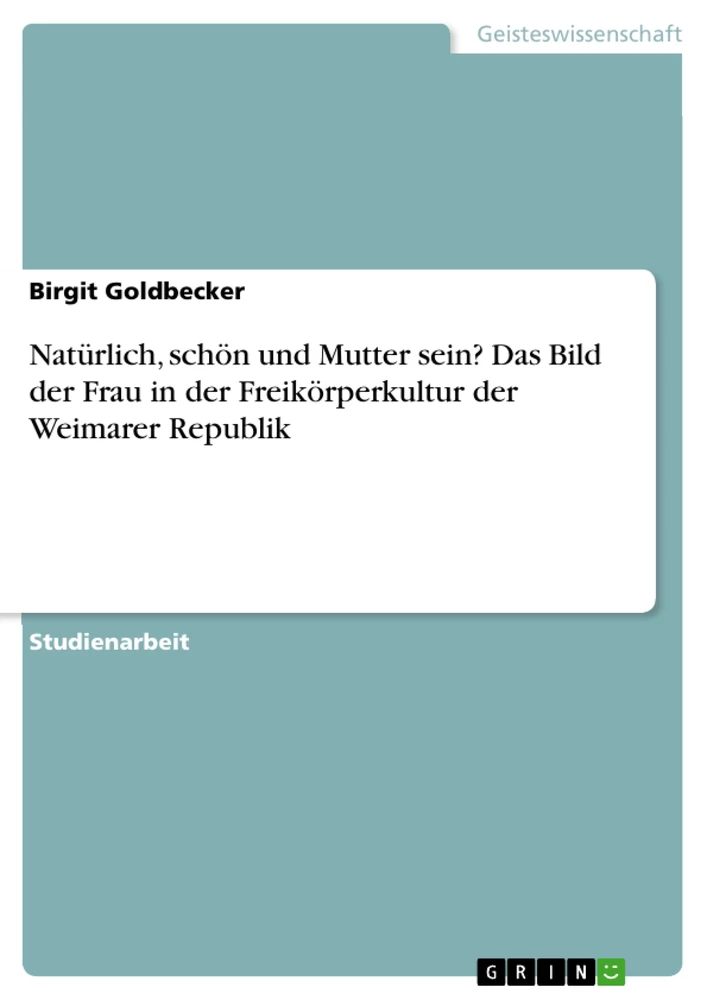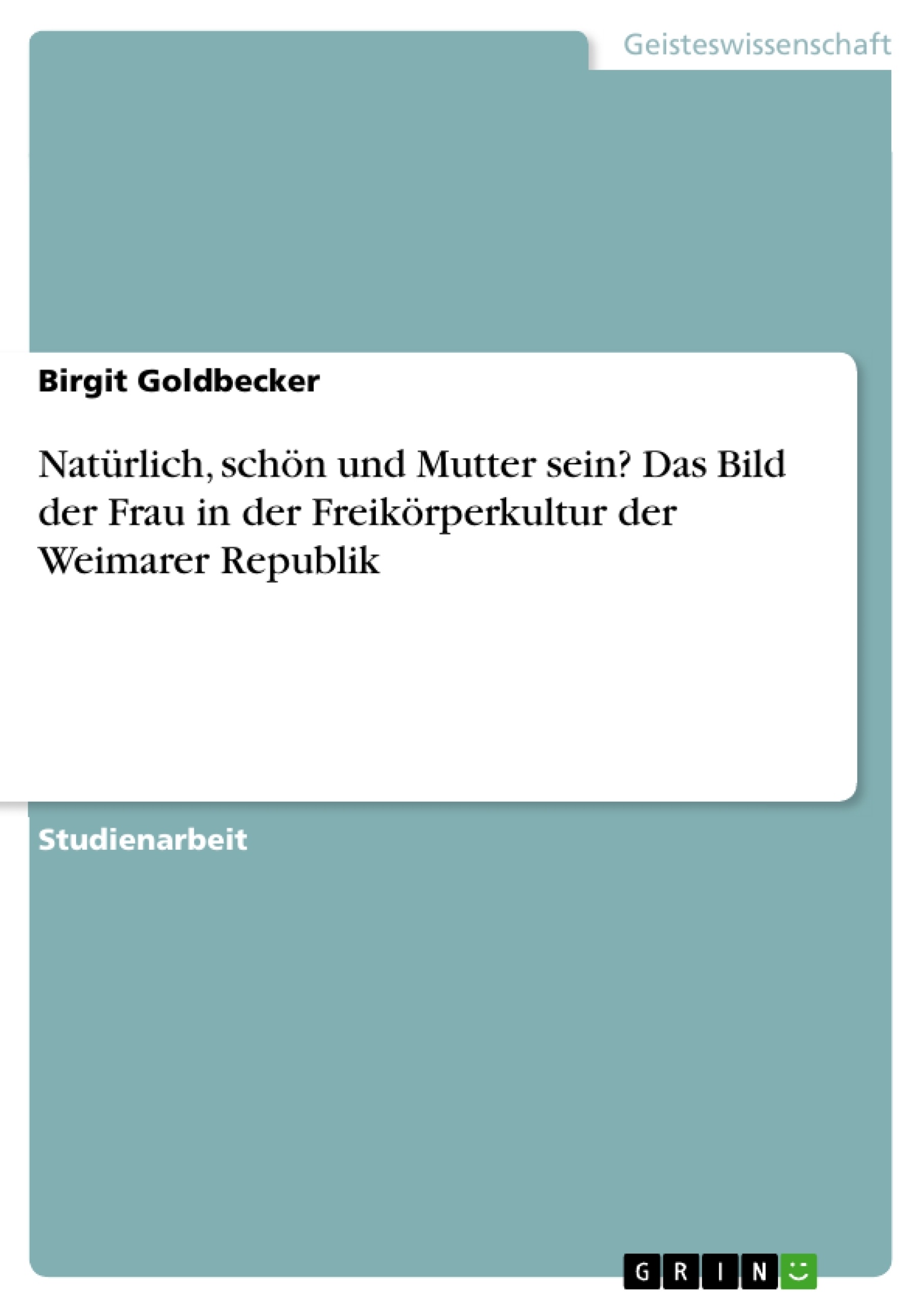Weltwirtschaftskrise, Inflation, parteipolitische Radikalisierung, Demokratisierung, Amerikanisierung, Rundfunk, Werbung, Kino, Mode, Technikboom, Großstadt, Tanz, Theater, Masse, Zerstreuung und die Neue Frau sind Stichpunkte, die in kuren Worten einen Einblick in die Weimarer Republik geben. Deutschland war Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Umbruchsphase und so auch das Bild der Frau. Das Leben wurde schneller und die Menschen mussten dabei mithalten. Es gab jedoch Bevölkerungsgruppen, die daran nicht teilnehmen beziehungsweise davon eine Auszeit nehmen wollten. Dazu gehörten unter anderem die Anhänger der Freikörperkultur. Diese Bewegung, die schon im 19. Jahrhundert entstand, erlebte ihren Höhepunkt in der Weimarer Republik. Während die einen nur am Wochenende und in den Ferien der Freikörperkultur nachgingen, gab es andere, die ihr Leben danach ausrichteten.
Die Städte wurden als Brutstätten von Unmoral und moralischer Verkommenheit verurteilt. Eine „kleine“ Parallelgesellschaft entstand, in der den Frauen der Weimarer Republik eine bestimmte Rolle zugeteilt wurde, die in dieser Arbeit herausgearbeitet werden soll. Welches Bild der Frau entstand in der Freikörperkultur? Wie sah das Ideal aus? In wie weit unterscheidet es sich vom Bild der Neuen Frau, welche eigentlich zu einem verpönten Gesellschaftssystem gehörte? Inwiefern unterscheidet sich das Idealbild von Mann und Frau? Und warum entstanden die Vorstellungen vom wehrfähigen Mann und der gebärfähigen Frau?
Um diese Fragen beantworten zu können, gibt diese Arbeit zunächst einen kurzen Überblick über die Weimarer Republik. Die politische und wirtschaftliche Situation sowie das Alltagsleben und die Kultur werden erläutert, um sich ein besseres Bild davon machen zu können, in welcher Zeit die Anhänger der Freikörperkultur der Weimarer Republik lebten. Zudem erfolgt eine Beschreibung des Frauenbildes zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Daraufhin wird die Freikörperkultur mit ihren Ursprüngen und Einflüssen, ihrer Organisation, den politischen Richtungen, ihren Mitgliedern sowie ihrer Ausübung, beschrieben. Im Anschluss wird das Frauenbild analysiert und mit dem des Mannes verglichen. Im Fazit wird dann ein Bogen zum Theorieteil gezogen und die hier aufgestellten Fragen beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Weimarer Republik – ein Überblick
- 2.1 Politische und wirtschaftliche Situation – Ein Land in der Krise
- 2.2 Alltagsleben und Kultur – Auswirkungen und Umgang mit der Krise
- 3 Die Frau Anfang des 20. Jahrhunderts
- 4 Die Freikörperkultur in der Weimarer Republik
- 4.1 Ein Überblick
- 4.2 Die Frau als schöne Mutter
- 4.3 Die Norm und die Andere
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Frauenbild in der Freikörperkultur der Weimarer Republik. Ziel ist es, das Idealbild der Frau innerhalb dieser Bewegung zu analysieren und es mit dem Bild der „Neuen Frau“ sowie dem Bild des Mannes zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse auf die Entstehung dieser Ideale im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Republik.
- Das Frauenbild in der Freikörperkultur der Weimarer Republik
- Vergleich des Ideals der Freikörperkultur mit dem der „Neuen Frau“
- Der Einfluss der politischen und wirtschaftlichen Situation der Weimarer Republik
- Geschlechterrollen und -ideale in der Freikörperkultur
- Die Freikörperkultur als Gegenbewegung zu gesellschaftlichen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Frauenbild in der Freikörperkultur der Weimarer Republik. Sie beleuchtet den Wandel des Frauenbildes im frühen 20. Jahrhundert und positioniert die Freikörperkultur als eine relevante Bewegung in diesem Kontext. Der kurze Überblick über die historischen und gesellschaftlichen Veränderungen ebnet den Weg zur Analyse des spezifischen Frauenbildes innerhalb der Freikörperkultur und verweist auf die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Der Bezug auf den Wandel des Körperbildes der Frau wird explizit gemacht und als Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung gesetzt. Der Einleitungsteil etabliert den Forschungsrahmen und die Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit behandelt werden sollen.
2 Weimarer Republik - ein Überblick: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die politische und wirtschaftliche Situation der Weimarer Republik. Es beschreibt die Herausforderungen, mit denen die junge Republik konfrontiert war, wie die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, die wirtschaftliche Instabilität und die vielfältigen politischen Strömungen. Der Versailler Vertrag und seine Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft werden ebenfalls detailliert beleuchtet. Die Beschreibung der politischen und wirtschaftlichen Krisen dient als wichtiger Kontext für das Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklungen und der Entstehung der Freikörperkultur als Gegenbewegung. Die Kapitel unterstreicht die Turbulenzen und Unsicherheiten der Zeit, welche die Entwicklungen im Bereich der sozialen Normen und des Frauenbildes maßgeblich beeinflusst haben.
FAQ: Seminararbeit - Frauenbild in der Freikörperkultur der Weimarer Republik
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Frauenbild in der Freikörperkultur der Weimarer Republik. Sie analysiert das Idealbild der Frau innerhalb dieser Bewegung und vergleicht es mit dem Bild der „Neuen Frau“ und dem Bild des Mannes. Dabei werden die gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse auf die Entstehung dieser Ideale im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Republik beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Frauenbild in der Freikörperkultur der Weimarer Republik; Vergleich des Ideals der Freikörperkultur mit dem der „Neuen Frau“; Der Einfluss der politischen und wirtschaftlichen Situation der Weimarer Republik; Geschlechterrollen und -ideale in der Freikörperkultur; Die Freikörperkultur als Gegenbewegung zu gesellschaftlichen Normen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung; 2. Weimarer Republik – ein Überblick (2.1 Politische und wirtschaftliche Situation – Ein Land in der Krise; 2.2 Alltagsleben und Kultur – Auswirkungen und Umgang mit der Krise); 3. Die Frau Anfang des 20. Jahrhunderts; 4. Die Freikörperkultur in der Weimarer Republik (4.1 Ein Überblick; 4.2 Die Frau als schöne Mutter; 4.3 Die Norm und die Andere); 5. Fazit.
Wie wird die Einleitung aufgebaut?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt die Forschungsfrage nach dem Frauenbild in der Freikörperkultur der Weimarer Republik und beleuchtet den Wandel des Frauenbildes im frühen 20. Jahrhundert. Sie positioniert die Freikörperkultur als relevante Bewegung und gibt einen kurzen Überblick über historische und gesellschaftliche Veränderungen. Der Bezug auf den Wandel des Körperbildes der Frau wird explizit gemacht und als Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung gesetzt. Der Einleitungsteil etabliert den Forschungsrahmen und die Forschungsfragen.
Was beinhaltet das Kapitel zur Weimarer Republik?
Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die politische und wirtschaftliche Situation der Weimarer Republik. Es beschreibt die Herausforderungen wie die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, die wirtschaftliche Instabilität und die vielfältigen politischen Strömungen. Der Versailler Vertrag und seine Auswirkungen werden detailliert beleuchtet. Die Beschreibung der politischen und wirtschaftlichen Krisen dient als Kontext für das Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklungen und der Entstehung der Freikörperkultur.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die genaue Methode wird in der Einleitung explizit genannt, ist aber aus dem vorliegenden Textfragment nicht direkt ersichtlich. Die Arbeit analysiert jedoch das Frauenbild innerhalb der Freikörperkultur und vergleicht es mit anderen zeitgenössischen Frauenbildern, was auf eine vergleichende Analyse und möglicherweise auch eine Quellenanalyse hindeutet.
Welches Ziel verfolgt die Seminararbeit?
Ziel der Seminararbeit ist es, das Idealbild der Frau innerhalb der Freikörperkultur der Weimarer Republik zu analysieren und es mit dem Bild der „Neuen Frau“ sowie dem Bild des Mannes zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse auf die Entstehung dieser Ideale im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Republik.
- Citar trabajo
- Birgit Goldbecker (Autor), 2011, Natürlich, schön und Mutter sein? Das Bild der Frau in der Freikörperkultur der Weimarer Republik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432610