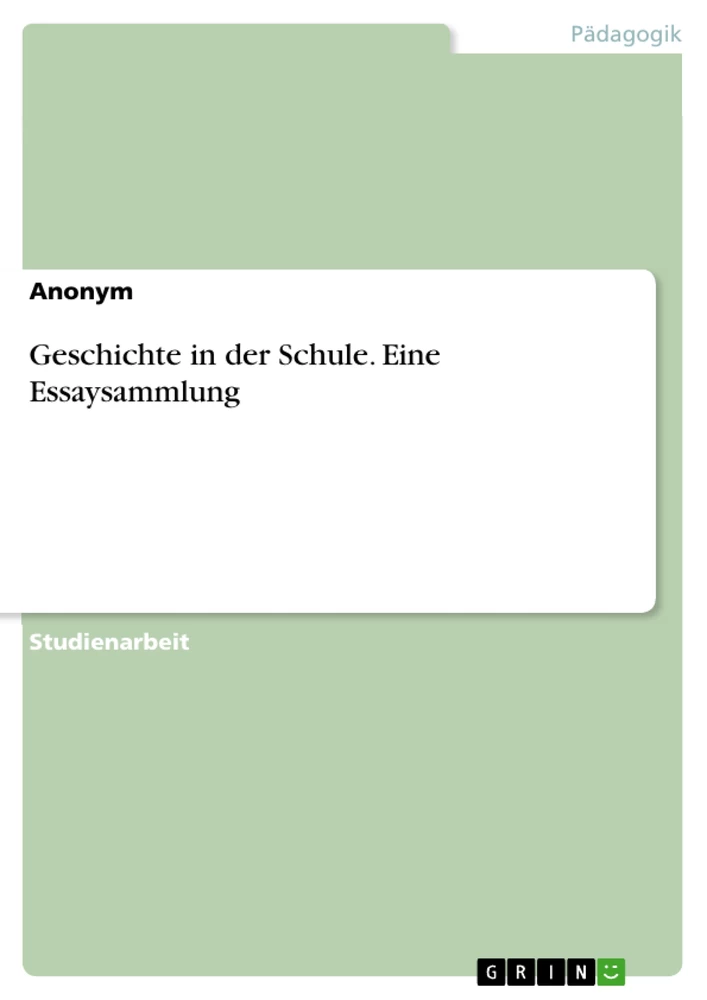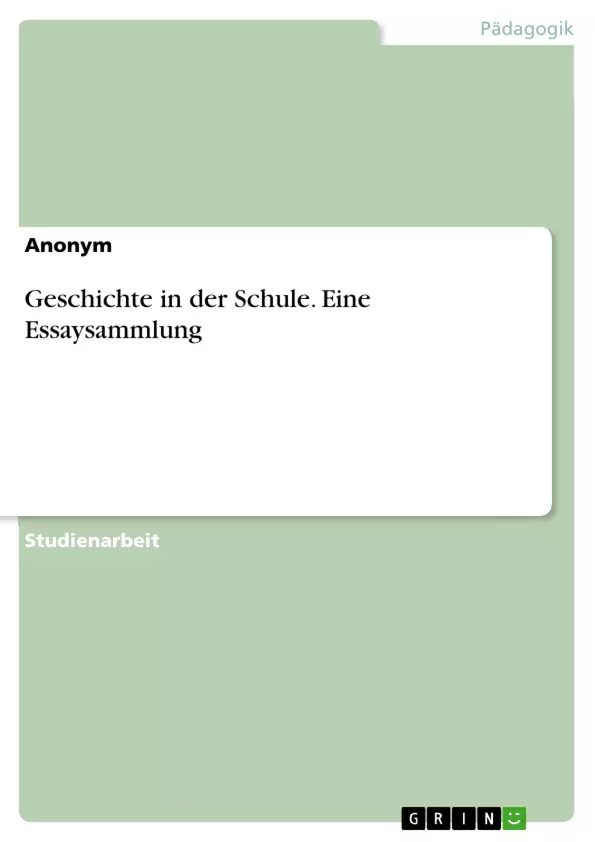Das vorliegende Portfolio ist in fünf Themenpunkte gegliedert, die jeweils anhand eines Essays umgesetzt werden. Die einzelnen Essays setzen sich mit geschichtsdidaktischen Begriffen in Bezug auf den Geschichtsunterricht auseinander. Das erste Kapitel handelt von der theoretischen Auseinandersetzung mit dem fachdidaktischen Kompetenzmodell von Michael Sauer. Vertiefend wird sich hier mit den sechs Aspekten des Geschichtsbewusstseins nach Sauer beschäftigt. Die Vorstellung einer Unterrichtsmethode oder eines Unterrichtsmediums liegt dem zweiten Essay zu Grunde. „Das Schulbuch als Medium des Gesichtsunterrichts“ soll hierzu genauer untersucht werden. Danach findet im dritten Kapitel die Vorstellung eines unterrichtspragmatischen Gegenstandes statt. Der ausgewählte Gegenstand ist die „Direkte Instruktion als Unterrichtsmethode“. Anschließend ist im vorletzten Themenabschnitt „Personalisierung“ als Schwerpunkt festgesetzt. Abschließend handelt das letzte Essay von dem „Kompetenzbegriff“. Die Essays sind für das bessere Verständnis in sich nochmals in Unterpunkte unterteilt, sodass am Anfang eine kleine Einleitung erfolgt und am Ende in der Zusammenfassung des jeweiligen Essays die wesentlichen Punkte festgehalten sind.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Sechs Prinzipien des Geschichtsbewusstseins nach Michael Sauer
- Begriffsentwicklung „Geschichtsbewusstsein“
- Das Modell von Michael Sauer
- Zusammenfassung
- Das Schulbuch als Medium im Geschichtsunterricht
- Die Aufgaben eines Schulbuchs
- Der Aufbau von Schulbüchern
- Einwirkung bei der Selektion und Entstehung von Schulbüchern
- Kriterien für die Analyse von Schulbüchern
- Zusammenfassung
- Die direkte Instruktion
- Wie funktioniert die direkte Instruktion?
- Ziele und Verknüpfung zu John Hatties Studie
- Die direkte Instruktion in sieben Schritten
- Frontalunterricht vs. Direkte Instruktion
- Zusammenfassung
- Personifizierung und Personalisierung
- Personen als Identifikations- und Vorbildfunktion
- Personifizierung und Personalisierung nach Bergmann
- Personalisierung in der geschichtlichen Umgestaltung
- Die Prinzipien Personalisierung und Personifizierung im gegenwärtigen Geschichtsunterricht
- Zusammenfassung
- Der Kompetenzbegriff
- Allgemein
- Kompetenz als Begriff in der Geschichtsdidaktik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Portfolio setzt sich mit verschiedenen geschichtsdidaktischen Begriffen in Bezug auf den Geschichtsunterricht auseinander. Es beleuchtet theoretische Konzepte, Unterrichtsmedien, unterrichtspragmatische Gegenstände und die Rolle der Personifizierung und Personalisierung sowie des Kompetenzbegriffs im Geschichtsunterricht.
- Die Entwicklung und Bedeutung des Begriffs „Geschichtsbewusstsein“
- Das Schulbuch als Medium im Geschichtsunterricht und seine Analyse
- Die direkte Instruktion als Unterrichtsmethode und ihre Anwendung im Geschichtsunterricht
- Die Rolle der Personifizierung und Personalisierung im Geschichtsunterricht
- Der Kompetenzbegriff und seine Bedeutung in der Geschichtsdidaktik
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen
Das Portfolio gliedert sich in fünf Essays, die sich mit geschichtsdidaktischen Begriffen auseinandersetzen. Es werden jeweils eine kleine Einleitung und eine Zusammenfassung der wesentlichen Punkte am Ende jedes Essays hinzugefügt.
Sechs Prinzipien des Geschichtsbewusstseins nach Michael Sauer
Dieses Kapitel behandelt das fachdidaktische Kompetenzmodell von Michael Sauer und seine sechs Aspekte des Geschichtsbewusstseins. Zunächst wird die terminologische Entwicklung des Begriffs „Geschichtsbewusstsein“ skizziert und seine Bedeutung in der Geschichtswissenschaft dargestellt. Im Anschluss wird das Modell von Michael Sauer vorgestellt und erläutert.
Das Schulbuch als Medium im Geschichtsunterricht
Der zweite Essay beschäftigt sich mit dem Schulbuch als Medium im Geschichtsunterricht. Es werden die Aufgaben eines Schulbuchs, der Aufbau von Schulbüchern, die Einwirkung bei der Selektion und Entstehung von Schulbüchern sowie Kriterien für die Analyse von Schulbüchern untersucht.
Die direkte Instruktion
Das dritte Kapitel präsentiert die „Direkte Instruktion“ als unterrichtspragmatischen Gegenstand. Es werden die Funktionsweise der direkten Instruktion, ihre Ziele, die Verknüpfung zu John Hatties Studie, die direkte Instruktion in sieben Schritten, sowie der Vergleich mit dem Frontalunterricht erläutert.
Personalisierung
Der vierte Themenabschnitt widmet sich der „Personalisierung“ als Schwerpunkt. Es werden die Bedeutung von Personen als Identifikations- und Vorbildfunktion, die Personifizierung und Personalisierung nach Bergmann sowie die Personalisierung in der geschichtlichen Umgestaltung behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen des Portfolios sind: Geschichtsbewusstsein, Schulbuch, Direkte Instruktion, Personifizierung, Personalisierung, Kompetenzbegriff, Geschichtsdidaktik, Geschichtsunterricht, Kompetenzmodell, Michael Sauer, John Hattie, Medien, Lehrplan, Geschichte, Methoden, Erinnerungsgemeinschaft, Curriculum.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die sechs Prinzipien des Geschichtsbewusstseins nach Michael Sauer?
Michael Sauer definiert sechs Aspekte, die das Geschichtsbewusstsein im Unterricht prägen und als Grundlage für ein fachdidaktisches Kompetenzmodell dienen.
Welche Rolle spielt das Schulbuch im Geschichtsunterricht?
Das Schulbuch fungiert als zentrales Medium zur Selektion und Aufbereitung historischer Inhalte und muss nach spezifischen fachdidaktischen Kriterien analysiert werden.
Was versteht man unter „Direkter Instruktion“?
Es handelt sich um eine strukturierte Unterrichtsmethode in sieben Schritten, die oft fälschlicherweise mit reinem Frontalunterricht gleichgesetzt wird, aber gezielte Lernprozesse steuert.
Was ist der Unterschied zwischen Personifizierung und Personalisierung?
In der Geschichtsdidaktik dienen beide als Identifikationsfunktionen, wobei die Arbeit die Unterschiede nach Bergmann und ihre Anwendung im Unterricht erläutert.
Was bedeutet der Kompetenzbegriff in der Geschichtsdidaktik?
Der Begriff beschreibt die Fähigkeit der Schüler, historisches Wissen nicht nur zu reproduzieren, sondern kritisch zu reflektieren und auf die Gegenwart zu beziehen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Geschichte in der Schule. Eine Essaysammlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432740