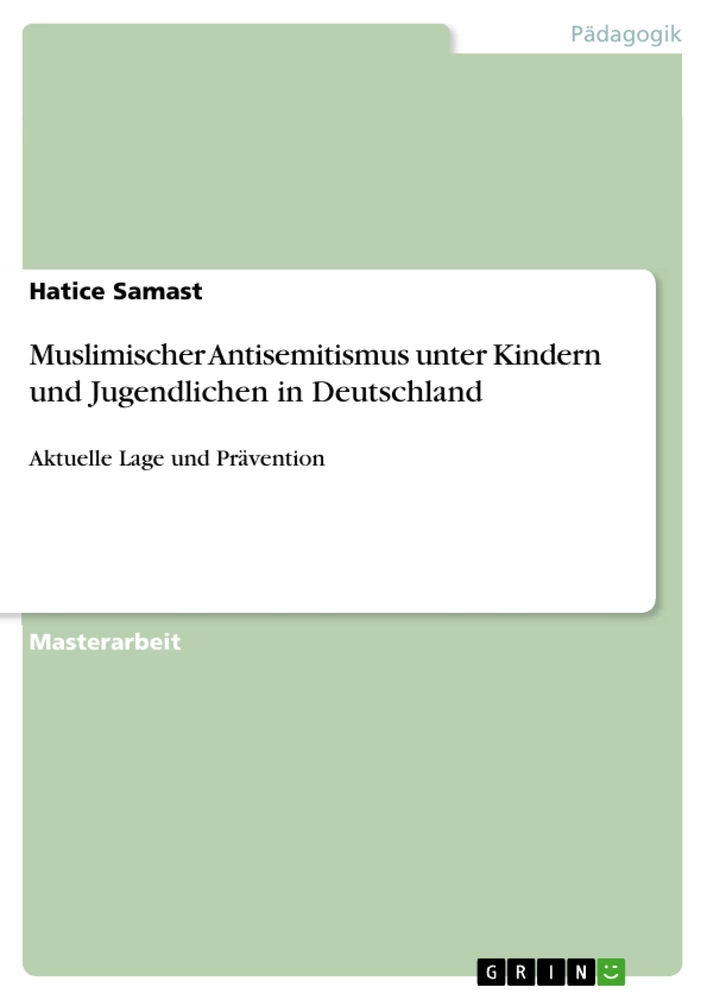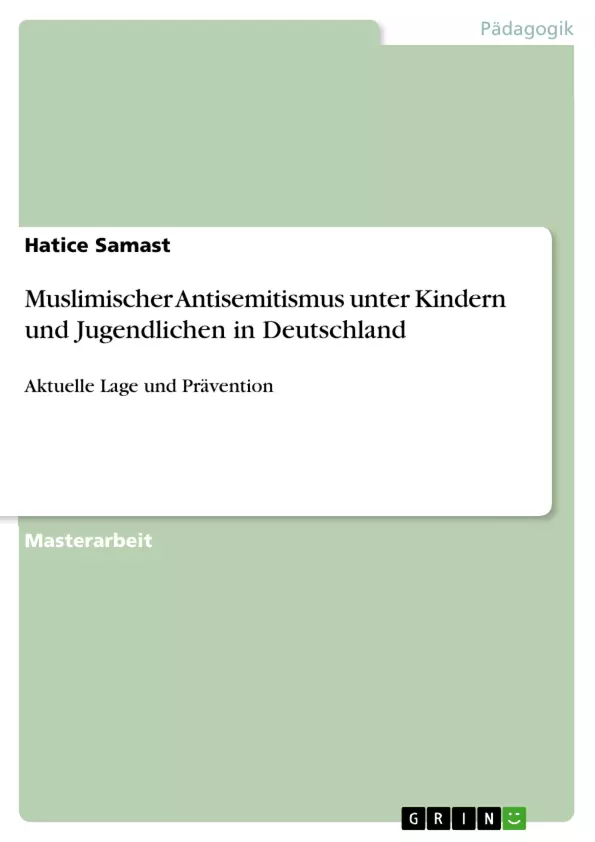In der vorliegenden Arbeit wird insbesondere der muslimische Antisemitismus bei arabisch- und türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen in Deutschland auf seine Ursachen und Präventionsmöglichkeiten hin untersucht. Dazu werden diese Form des Antisemitismus und seine spezifischen Charakteristika dahingehend analysiert, auf welcher Grundlage ein muslimischer Antisemitismus besteht und wie seine Existenz zu begründen ist. Bei der Untersuchung des Begriffs muslimischer Antisemitismus sollen die von Armin Pfahl-Traughber aufgeführten Ideologieformen des Antisemitismus sowie das eingangs angeführte Zitat von Adorno die zentralen Grundlagen der Analyse bilden.
Beim muslimischen Antisemitismus ist aktuell insbesondere in Deutschland und vorrangig in Berlin besonders auffällig, dass arabisch- und türkischstämmige Kinder muslimischen Glaubens bereits im Grundschulalter antisemitische Einstellungen verinnerlicht haben. Die vorliegende Arbeit zielt im Kern darauf, darüber aufzuklären, welche Faktoren beim Antisemitismus unter Kindern und Jugendlichen aus muslimischen Familien eine Rolle spielen und welche Aufgaben die deutsche Gesellschaft und die Schule als Institution im Kampf gegen einen solchen Antisemitismus hat – ganz besonders in migrationsgeprägten Städten wie Berlin. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Antisemitismus in Deutschland
- Definition Antisemitismus
- Forschungsstand muslimischen Antisemitismus
- Muslimischer Antisemitismus bei Kindern und Jugendlichen
- Einfluss sozialer Medien
- Nahostkonflikt und Israel-Bashing im Netz und in nahöstlichen Medien
- Verbreitung von Verschwörungstheorien
- Antisemitische Vorbildfunktionen
- Soziales Umfeld
- Jugendkultur und Rap
- Einfluss sozialer Medien
- Prävention von Antisemitismus bei Kindern und Jugendlichen
- Grundsätzliches
- ,,Fall Oskar\" an der Friedenauer Gemeinschaftsschule
- Paul-Simmel-Grundschule
- Außerschulische Lernorte und Antisemitismus
- Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e. V.
- Anne Frank Zentrum
- Grundsätzliches
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den muslimischen Antisemitismus bei arabisch- und türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Sie analysiert die Ursachen und Präventionsmöglichkeiten dieser Form des Antisemitismus und untersucht die spezifischen Charakteristika, die seine Existenz begründen. Der Fokus liegt dabei auf den von Armin Pfahl-Traughber aufgeführten Ideologieformen des Antisemitismus sowie dem eingangs angeführten Zitat von Adorno.
- Ursachen und Erscheinungsformen muslimischen Antisemitismus bei Kindern und Jugendlichen
- Einflussfaktoren wie soziale Medien, Vorbildfunktionen und das soziale Umfeld
- Rolle von Schule und Gesellschaft bei der Prävention von Antisemitismus
- Analyse von konkreten Beispielen an Berliner Schulen
- Die Bedeutung der Forschung und Politik im Kampf gegen muslimischen Antisemitismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Antisemitismus als ein „Medium“ dar, das vom Menschen als Mittel zur Selbstentlastung genutzt wird. Sie beleuchtet die psychologischen Faktoren, die Menschen zu Antisemiten werden lassen, sowie die unterschiedlichen ideologischen Begründungen, die hinter Antisemitismus stecken.
Kapitel 2 definiert den Antisemitismus und beleuchtet den Forschungsstand zu muslimischem Antisemitismus.
Kapitel 3 analysiert den Einfluss sozialer Medien, insbesondere den Nahostkonflikt und Israel-Bashing, sowie die Verbreitung von Verschwörungstheorien auf die Entwicklung antisemitischer Einstellungen bei Kindern und Jugendlichen. Des Weiteren werden antisemitische Vorbildfunktionen im sozialen Umfeld und in der Jugendkultur beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Prävention von Antisemitismus bei Kindern und Jugendlichen. Es werden verschiedene Ansätze und Initiativen vorgestellt, die sich für den Kampf gegen Antisemitismus einsetzen.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Muslimischer Antisemitismus, Kinder und Jugendliche, Soziale Medien, Nahostkonflikt, Israel-Bashing, Verschwörungstheorien, Vorbildfunktionen, Schule, Prävention, Gesellschaft, Migration, Deutschland, Berlin
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für muslimischen Antisemitismus bei Jugendlichen?
Zu den zentralen Faktoren gehören der Einfluss sozialer Medien, der Nahostkonflikt, die Verbreitung von Verschwörungstheorien sowie antisemitische Vorbildfunktionen im sozialen Umfeld und in der Jugendkultur (z.B. Rap).
Welche Rolle spielen soziale Medien bei diesem Thema?
Soziale Medien fungieren oft als Verstärker für „Israel-Bashing“ und die Verbreitung von antisemitischen Verschwörungstheorien, die besonders Kinder und Jugendliche im Grundschulalter erreichen können.
Wie kann Antisemitismus an Schulen vorgebeugt werden?
Prävention erfolgt durch Aufklärung, die Einbeziehung außerschulischer Lernorte (wie das Anne Frank Zentrum) und spezifische pädagogische Ansätze, die sich mit Identität und Vorurteilen auseinandersetzen.
Gibt es konkrete Beispiele für Antisemitismus an Berliner Schulen?
Ja, die Arbeit untersucht spezifische Fälle, wie den „Fall Oskar“ an der Friedenauer Gemeinschaftsschule oder Vorfälle an der Paul-Simmel-Grundschule, um die Problematik zu verdeutlichen.
Welche Organisationen engagieren sich gegen Antisemitismus in Deutschland?
Wichtige Initiativen sind zum Beispiel die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e. V. (KIGA) und das Anne Frank Zentrum.
Warum ist die Untersuchung von arabisch- und türkischstämmigen Jugendlichen wichtig?
In migrationsgeprägten Städten wie Berlin zeigt sich, dass antisemitische Einstellungen oft bereits im Kindesalter verinnerlicht werden. Eine Analyse hilft, gezielte Präventionsmaßnahmen für diese Zielgruppen zu entwickeln.
- Quote paper
- Hatice Samast (Author), 2018, Muslimischer Antisemitismus unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432750