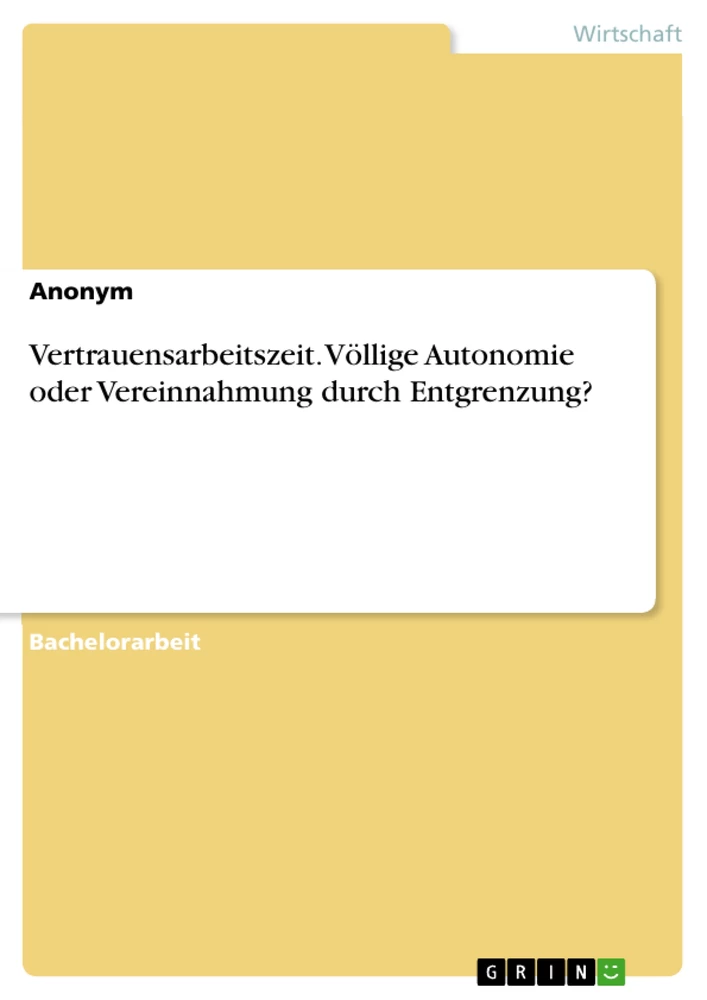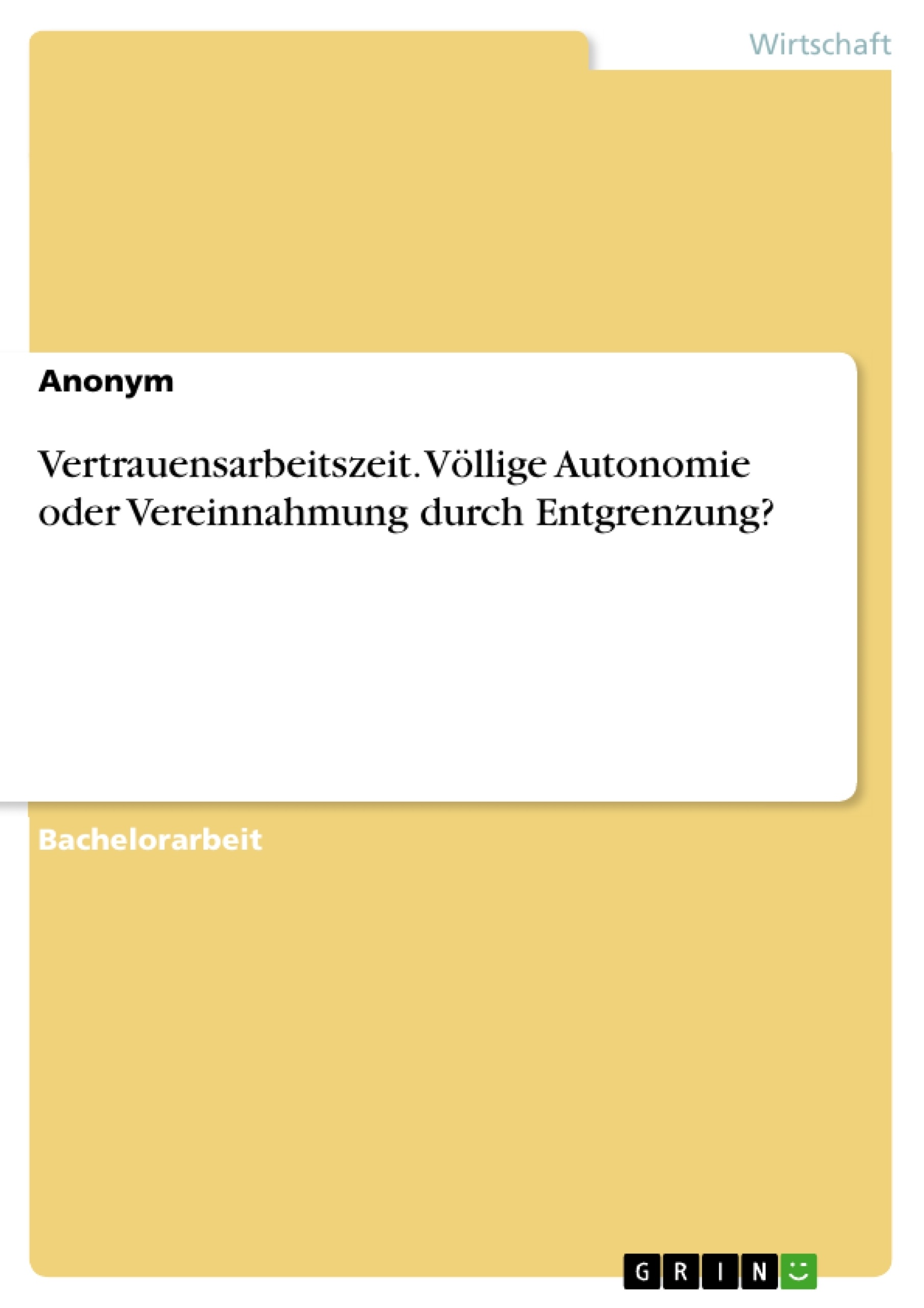Den seit den 1980er Jahren immer stärker werdenden Wünschen der Unternehmen nach optimalen Kapazitätsauslastungen, Kostensenkungen und einer besseren Kundenorientierung sowie den Bedürfnissen der Arbeitnehmern nach größerer Flexibilität und erweiterter Selbstbestimmung, konnte innerhalb des traditionellen Normalarbeitszeitverhältnisses nicht mehr entsprochen werden. Ein tiefgreifender Strukturwandel war zu beobachten welcher die Erosion der Normalarbeitszeit zur Folge hatte. Flexible Arbeitszeitmodelle wie die Gleitzeit, die Jahresarbeitszeit oder auch das Jobsharing wurden in den Unternehmen eingeführt. Erste betriebliche Versuche mit Vertrauensarbeitszeit datieren sich auf das Jahr 1993 in der Siemens AG. Als Rationalisierungskonzept nahm der Produktionsfaktor Arbeitszeit eine wachsende Bedeutung ein. Sie sollte sich verstärkt nach betrieblichen Belangen richten, wurde gleichzeitig aber immer weniger formell reguliert. Arbeitszeit sollte so effizient wie möglich genutzt, unproduktive Anwesenheitszeit vermieden werden. Jener Paradigmenwechsel hin zur Ergebnisorientierung führte dazu, dass flexible Arbeitszeiten kein Privileg höherer Angestellter blieben, sondern nun auch für die breite Masse der Arbeitnehmer zugänglich wurden.
Dennoch gibt es eine konträre Diskussion über die Implikationen der Vertrauensarbeitszeit für Beschäftigte. Während Befürworter von völliger Autonomie der Arbeitnehmer innerhalb von Vertrauensarbeitszeit sprechen, behaupten Skeptiker, dass aufgrund einer Entgrenzung von Arbeit die Beschäftigten in letzter Konsequenz völlig vereinnahmt werden. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist die Erörterung und Prüfung beider Hypothesen. In den theoretischen Grundlagen wird zunächst der Begriff Vertrauensarbeitszeit definiert und von verwandten Konzepten abgegrenzt. Anschließend werden die Theorie der Entgrenzung von Arbeit und die Arbeitszeitsouveränität dargestellt. Das dritte Kapitel zeigt zuerst die Motive der Arbeitnehmer für eine Vertrauensarbeitszeit auf und analysiert und hinterfragt im Weiteren die Merkmale dieser Arbeitsorganisation unter Einbeziehung praxisorientierter Literatur. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der vorherigen Abschnitte bezüglich der aufgestellten Hypothesen diskutiert. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick in die Zukunft ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definition der Vertrauensarbeitszeit
- Abgrenzung zu anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen
- Theorie der Entgrenzung von Arbeit
- Arbeitszeitsouveränität
- Ambivalenz entgrenzter Arbeit: Autonomie und Vereinnahmung
- Arbeitnehmerbezogene Motive von Vertrauensarbeitszeit
- Streben nach Autonomie
- Realisierung einer Work-Life-Balance
- Merkmale der Vertrauensarbeitszeit
- Vertrauenskultur
- Zielvereinbarungen
- Selbstorganisation
- Indirekte Steuerung des Individuums
- Arbeitnehmerbezogene Motive von Vertrauensarbeitszeit
- Diskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ambivalenz der Vertrauensarbeitszeit. Sie prüft die gegensätzlichen Hypothesen von vollständiger Autonomie versus vollständiger Vereinnahmung der Arbeitnehmer. Die Arbeit definiert den Begriff, grenzt ihn von anderen Modellen ab und analysiert die zugrundeliegenden Theorien der Entgrenzung von Arbeit und der Arbeitszeitsouveränität.
- Definition und Abgrenzung der Vertrauensarbeitszeit
- Theorie der Entgrenzung von Arbeit und ihre Auswirkungen
- Arbeitnehmermotive und Merkmale der Vertrauensarbeitszeit
- Analyse der Autonomie und Vereinnahmung im Kontext von Vertrauensarbeitszeit
- Diskussion der gegensätzlichen Perspektiven auf Vertrauensarbeitszeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel von traditionellen Arbeitszeitmodellen hin zu flexibleren Konzepten wie der Vertrauensarbeitszeit als Reaktion auf den Wunsch nach optimaler Kapazitätsauslastung, Kostensenkungen, besserer Kundenorientierung und größerer Arbeitnehmerflexibilität und Selbstbestimmung. Sie skizziert die historische Entwicklung und die konträre Debatte um die Auswirkungen der Vertrauensarbeitszeit auf die Beschäftigten: Autonomie versus Vereinnahmung. Das Hauptziel der Arbeit ist die Untersuchung dieser gegensätzlichen Hypothesen.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Vertrauensarbeitszeit, der sich in Theorie und Praxis als nicht homogen darstellt. Es grenzt die Vertrauensarbeitszeit von anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen ab und erläutert die Theorie der Entgrenzung von Arbeit sowie den Aspekt der Arbeitszeitsouveränität. Der Fokus liegt auf der Darstellung der theoretischen Fundamente, um die spätere empirische Analyse zu ermöglichen.
Ambivalenz entgrenzter Arbeit: Autonomie und Vereinnahmung: Dieses Kapitel untersucht die Motive der Arbeitnehmer für die Wahl einer Vertrauensarbeitszeit, insbesondere das Streben nach Autonomie und die Verbesserung der Work-Life-Balance. Im Anschluss analysiert es die Merkmale dieser Arbeitsorganisation, darunter Vertrauenskultur, Zielvereinbarungen, Selbstorganisation und indirekte Steuerung. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den positiven und negativen Aspekten der Entgrenzung von Arbeit im Kontext der Vertrauensarbeitszeit.
Schlüsselwörter
Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Entgrenzung von Arbeit, Arbeitszeitsouveränität, Autonomie, Vereinnahmung, Work-Life-Balance, Zielvereinbarungen, Selbstorganisation, Arbeitnehmermotivation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vertrauensarbeitszeit - Ambivalenz entgrenzter Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ambivalenz der Vertrauensarbeitszeit. Sie analysiert die gegensätzlichen Perspektiven von vollständiger Autonomie versus vollständiger Vereinnahmung der Arbeitnehmer und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung der Vertrauensarbeitszeit von anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen. Sie analysiert die zugrundeliegenden Theorien der Entgrenzung von Arbeit und der Arbeitszeitsouveränität. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Arbeitnehmermotiven (Autonomie, Work-Life-Balance) und den Merkmalen der Vertrauensarbeitszeit (Vertrauenskultur, Zielvereinbarungen, Selbstorganisation, indirekte Steuerung).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zur Ambivalenz entgrenzter Arbeit (Autonomie und Vereinnahmung), eine Diskussion und einen Ausblick. Die Einleitung beschreibt den Wandel zu flexibleren Arbeitsmodellen und die konträre Debatte um die Auswirkungen der Vertrauensarbeitszeit. Die theoretischen Grundlagen definieren den Begriff und erläutern die relevanten Theorien. Das Kapitel zur Ambivalenz untersucht Arbeitnehmermotive und Merkmale der Vertrauensarbeitszeit. Die Diskussion und der Ausblick runden die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Entgrenzung von Arbeit, Arbeitszeitsouveränität, Autonomie, Vereinnahmung, Work-Life-Balance, Zielvereinbarungen, Selbstorganisation, Arbeitnehmermotivation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit prüft die gegensätzlichen Hypothesen von vollständiger Autonomie versus vollständiger Vereinnahmung der Arbeitnehmer im Kontext der Vertrauensarbeitszeit. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Arbeitsform auf die Beschäftigten und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen.
Wie wird die Vertrauensarbeitszeit definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert den Begriff der Vertrauensarbeitszeit und grenzt ihn von anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen ab. Es wird auf die inhomogene Darstellung in Theorie und Praxis eingegangen.
Welche Rolle spielen Autonomie und Vereinnahmung?
Die Arbeit untersucht die Ambivalenz von Autonomie und Vereinnahmung im Kontext der Vertrauensarbeitszeit. Es wird analysiert, inwieweit die Vertrauensarbeitszeit tatsächlich zu mehr Autonomie für die Arbeitnehmer führt oder ob sie stattdessen zu einer verstärkten Vereinnahmung führt.
Welche Arbeitnehmermotive werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet das Streben nach Autonomie und die Verbesserung der Work-Life-Balance als zentrale Arbeitnehmermotive für die Wahl einer Vertrauensarbeitszeit.
Welche Merkmale der Vertrauensarbeitszeit werden analysiert?
Analysiert werden Merkmale wie Vertrauenskultur, Zielvereinbarungen, Selbstorganisation und indirekte Steuerung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Vertrauensarbeitszeit. Völlige Autonomie oder Vereinnahmung durch Entgrenzung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432834