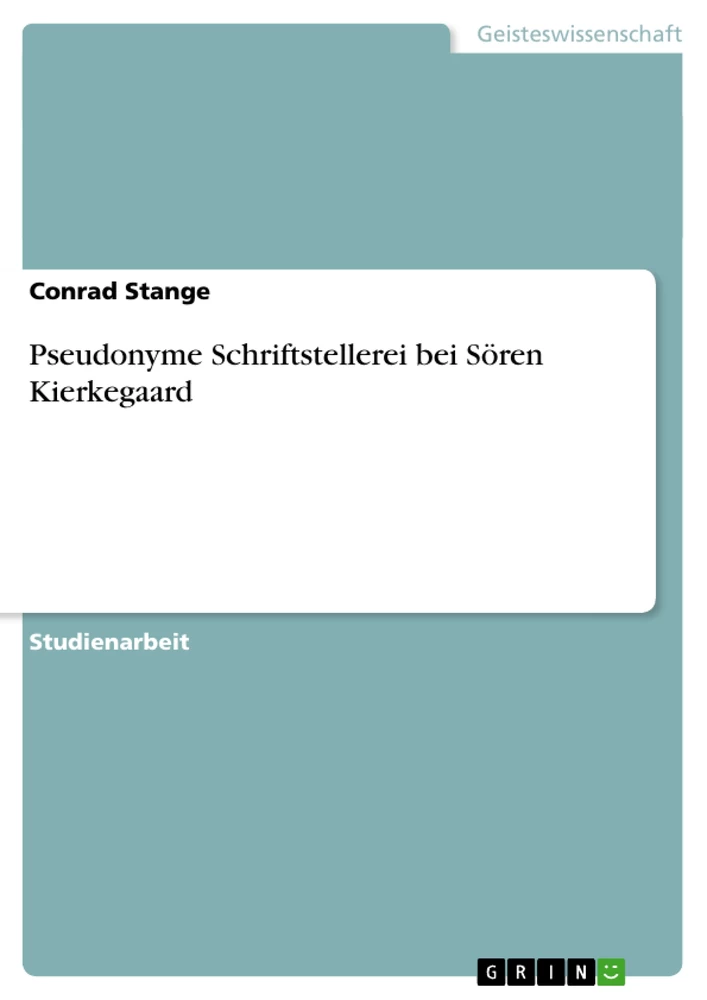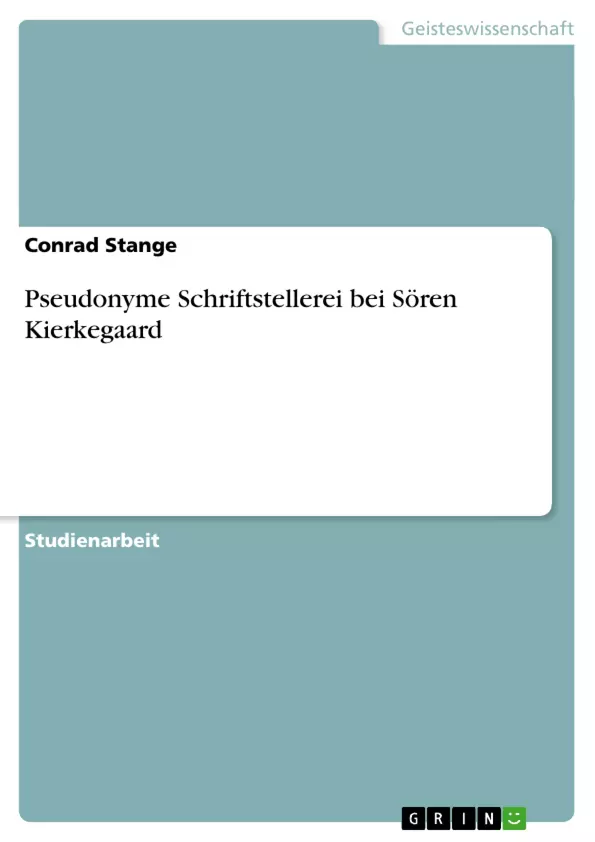Die Veröffentlichung einer Schrift unter fingiertem Namen kann mannigfache Ursachen haben, wobei es jedoch in der Mehrheit schlichtweg pragmatische Gründe sind, welche einen Verfasser zu jenem Mittel greifen lassen. Im Laufe der Zeit verwandten Dichter und Philosophen solche Maskenspiele, um dadurch ihre Werke für sich sprechen zu lassen. Große Namen wie etwa Voltaire, Jean Paul oder auch George Orwell waren derartige Ausdrücke schriftstellerischer Arbeit. Dabei ist die Funktion einer solchen Verkleidung in einigen Fällen besonders als Schutz zu erkennen, aber auch einfach die Erkenntnis, daß der Mensch ohne Zweifel viele Charaktere in sich trägt. Pseudonyme als literarische Umgangsform entstehen und verleihen bis in die Gegenwart hinein vielen Werken gern und oft ihre besondere Prägung.
In der hier nun vorliegenden Untersuchung, die mit dem Werk des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard (1813-1855) sich auseinandersetzt, spielt die pseudonyme Schrifttätigkeit eine maßgebliche Rolle. Viele Bücher und Abhandlungen hat Kierkegaard unter den weitesten Maskeraden verfasst, seine Anschauungen über Christentum und das Verhältnis von Gott, Welt und Mensch sind aller Wahrscheinlichkeit nur zu verstehen, wenn eine bewusste Reflexion über die jeweilig anzutreffenden Verfasser unternommen wird. Wohl bleibt der Philosoph nahezu unverständlich und verliert nicht unwesentlich von seiner Überzeugungskraft, so denn ein ausreichendes Verständnis der einzelnen Figuren sich nicht voraussetzt.
Nach einer kurzen Darstellung einiger von Kierkegaard geschaffener und verwandter Figuren wird sich die Ausarbeitung im besonderen mit jenem Johannes Climacus beschäftigen, einem Pseudonym, welches der Denker vorzugsweise in seinen Philosophischen Brocken (1844) und auch der zugehörigen, späteren Unwissenschaftlichen Nachschrift (1846) heranzog, um eigene Gedanken niederzulegen. Climacus scheint ein besonderer Charakter zu sein, sicher nur ein weiterer, wohl aber ein zentraler Schlüssel zu Kierkegaards Verständnis. Deshalb ist eine genaue Beleuchtung gerade dieses Adepten notwendig und förderlich.
Den Abschluss bilden eine kurze Zusammenfassung, die persönliche Stellungnahme zum Problem sowie der Versuch, des Denkers Wirkung näher zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einige Pseudonyme bei Kierkegaard
- Die Figur Johannes Climacus
- Schlusswort
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der pseudonymen Schriftstellerei des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard (1813-1855) und analysiert die Rolle, die die verschiedenen Pseudonyme im Verständnis seiner philosophischen Anschauungen spielen.
- Die Bedeutung der pseudonymen Schrifttätigkeit in Kierkegaards Werk
- Die verschiedenen Pseudonyme und ihre Charakteristika
- Die Bedeutung der Figur Johannes Climacus für Kierkegaards Philosophie
- Der Zusammenhang zwischen Kierkegaards Lebenswelt und seiner pseudonymen Schrifttätigkeit
- Die Rezeption von Kierkegaards Werk im Kontext seiner pseudonymen Schrifttätigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der pseudonymen Schriftstellerei bei Kierkegaard vor und erläutert die Bedeutung dieser für das Verständnis seiner Werke. Im zweiten Kapitel werden einige wichtige Pseudonyme Kierkegaards vorgestellt und charakterisiert, darunter Johannes de Silentio, Constantin Constantius und Vigilius Haufniensis. Die jeweiligen Figuren und ihre Funktionen in den Werken werden kurz dargestellt. Der dritte Abschnitt der Untersuchung widmet sich der Figur Johannes Climacus, einem zentralen Pseudonym in Kierkegaards Philosophie.
Schlüsselwörter
Sören Kierkegaard, pseudonyme Schriftstellerei, Johannes Climacus, Philosophie, Christentum, Existenzphilosophie, Angst, Glaube, Literatur, Pseudonym, Identität, Selbstverständnis, Werkdeutung, Rezeption
Häufig gestellte Fragen
Warum benutzte Sören Kierkegaard Pseudonyme?
Er nutzte sie als Maskenspiel, um verschiedene Charaktere und Perspektiven für sich sprechen zu lassen und den Leser zur Selbstreflexion anzuregen.
Wer ist die Figur Johannes Climacus?
Ein zentrales Pseudonym, das Kierkegaard für Werke wie die „Philosophischen Brocken“ nutzte, um subjektive Wahrheit und Christentum zu diskutieren.
Was sind weitere bekannte Pseudonyme Kierkegaards?
Dazu zählen unter anderem Johannes de Silentio, Constantin Constantius und Vigilius Haufniensis.
Kann man Kierkegaards Werk ohne Kenntnis der Pseudonyme verstehen?
Die Arbeit argumentiert, dass ein ausreichendes Verständnis der einzelnen Figuren notwendig ist, um die Überzeugungskraft seiner Philosophie zu erfassen.
Welchen Bezug hat das Pseudonym zu Kierkegaards Leben?
Die Pseudonyme spiegeln oft Kierkegaards eigene innere Zerrissenheit und seine komplexe Auseinandersetzung mit Gott und der Welt wider.
- Quote paper
- Conrad Stange (Author), 2004, Pseudonyme Schriftstellerei bei Sören Kierkegaard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43306