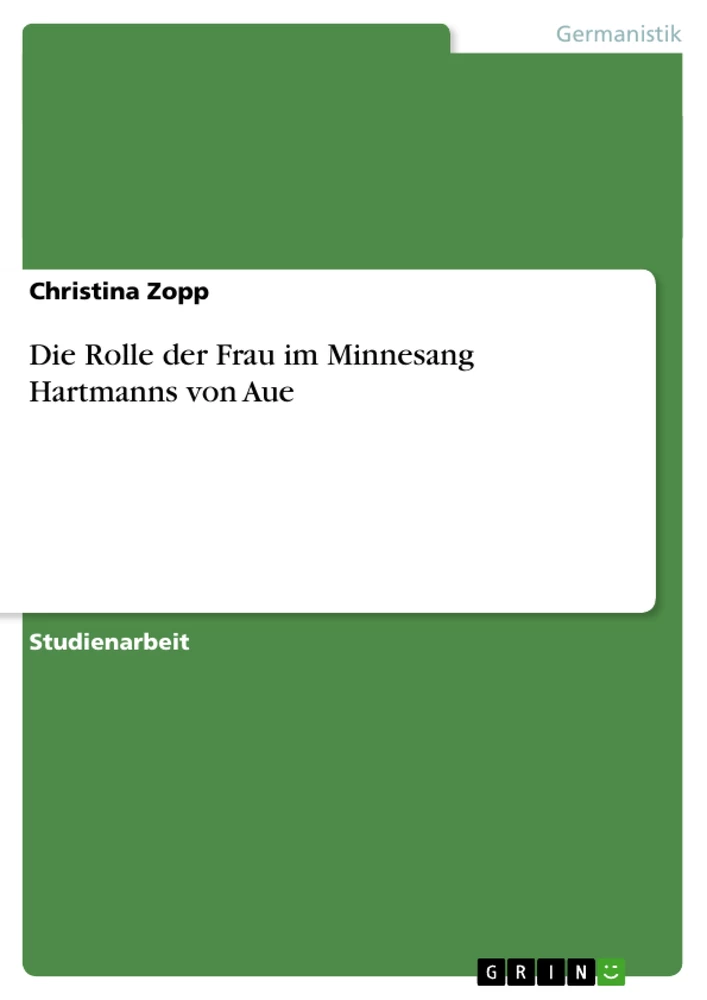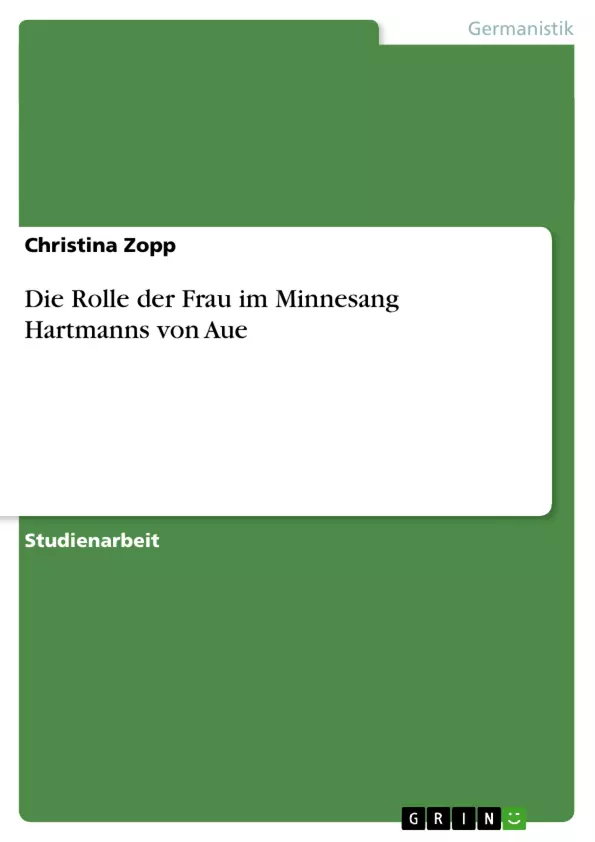Das Frauenbild der höfischen Zeit war geprägt von Fehleinschätzung und Unterdrückung. So wurde die Frau sowohl in sozialer wie auch in sexueller Hinsicht als Objekt betrachtet und hatte sich dem Mann unterzuordnen. Diese Vormundschaft des Mannes begründete sich auf den damaligen Stand der Wissenschaft, der besagte, dass die Frau an sich schwach und zudem noch anfällig für das Böse war. Der Mann dagegen, laut antiker Biologie, war der wahre und vollständige Mensch. Die höfische Dame in der höfischen Dichtung dagegen ist der literarische Gegenentwurf zur Realität. In der Dichtung erhält das Frauenbild einen fast überirdischen Aspekt, der zu einer Verehrung des Weiblichen an sic h veranlasst. Während der sogenannten „Renaissance des 12. Jahrhunderts“, also der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, vollzieht sich ein allgemeines Erwachen in der Gesellschaft, wobei der Mensch als wertvolles Einzelwesen erkannt wird.2 Somit erreicht die Verehrung des Weiblichen in der Literatur ihren Höhepunkt. Neben der göttlichen Gnade erscheint nun die Minne als Quelle und Ursprung alles Guten auf der Welt und erreicht damit den höchsten Wertebereich des menschlichen Denkens.
Die Literatur erhebt die Umworbene zur Lehnsherrin, der sich ein Ritter in größter Dienstbereitschaft unterwirft. Durch die Erhebung in eine dem Manne übergeordneten Sphäre der Vollkommenheit und Reinheit wird sie zu dessen Lehrerin und Inspiration. Sie erhält die Macht, über Zucht, Sitte und sämtliche humanen Werte zu wachen. Das idealisierte Frauenbild der höfischen Literatur spiegelt sich am deutlichsten in der Lyrik, dem Minnesang, wider. Hier soll nun anhand zweier Gattungen des Minnesangs, der Minneklage und des Frauenlieds, eine spezifische Untersuchung der Funktion der Frau im Minnesang durchgeführt werden. Nach einer Formanalyse und anschließender inhaltlicher Interpretation je eines Vertreters der beiden Gattungen folgt eine eingehende Darlegung der Funktion der Frau des jeweiligen Liedes im Kontext der vorliegenden Gattung. Hierbei handelt es sich zum einen um Hartmanns von Aue „ich sprach ich wollte ir iemer leben“ aus der Gattung der Minneklage, und zum anderen um das Frauenlied „swes vröide hin ze den bluomen stat“, das ebenfalls von Hartmann von Aue stammt.
Inhaltsverzeichnis
- Das Frauenbild zur höfischen Zeit in Verbindung mit der höfischen Dichtung
- Interpretationsansatz der Lieder „ich sprach ich wolte ir iemer leben“ und „swes vröide hin ze den bluomen stat“
- Formanalyse
- ,,ich sprach ich wolte ir iemer leben“
- ,,swes vröide hin ze den bluomen stat“
- Inhaltliche Interpretation
- ,,ich sprach ich wolte ir iemer leben“
- ,,swes vröide hin ze den bluomen stat“
- Formanalyse
- Gattungstheoretische Überlegungen
- Minneklage
- Frauenlied
- Die Funktion der Frau im Minnesang
- Gattungsspezifische Darstellung: Minneklage
- Besondere Darstellung: „ich sprach ich wolte ir iemer leben“
- Gattungsspezifische Darstellung: Frauenlied
- Besondere Darstellung: „swes vröide hin ze den bluomen stat“
- Frauenlied und Minneklage im Gesamtkontext des Minnesangs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Funktion der Frau im Minnesang Hartmanns von Aue zu untersuchen. Dabei werden zwei Gattungen des Minnesangs, die Minneklage und das Frauenlied, anhand der Lieder „ich sprach ich wolte ir iemer leben“ und „swes vröide hin ze den bluomen stat“ näher beleuchtet. Die Arbeit beleuchtet die literarische Darstellung des Frauenbilds im Kontext der höfischen Gesellschaft des 12. Jahrhunderts und untersucht, wie die Frau in der Minneklage und im Frauenlied als Figur fungiert.
- Das Frauenbild in der höfischen Literatur im Vergleich zur Realität
- Die Rolle der Frau in der Minneklage
- Die Rolle der Frau im Frauenlied
- Die Gattungsspezifischen Funktionen der Frau in der Minneklage und im Frauenlied
- Die Bedeutung der Minne und ihre Verbindung zum Frauenbild
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Frauenbild der höfischen Zeit und seine Darstellung in der höfischen Dichtung. Es wird die Diskrepanz zwischen der realen Situation der Frau und ihrem idealisierten Bild in der Literatur aufgezeigt. Das zweite Kapitel widmet sich einer Formanalyse und inhaltlichen Interpretation der Lieder „ich sprach ich wolte ir iemer leben“ und „swes vröide hin ze den bluomen stat“. Das dritte Kapitel behandelt die gattungstheoretischen Grundlagen von Minneklage und Frauenlied. Das vierte Kapitel untersucht die Funktion der Frau in den beiden Gattungen und beleuchtet die spezifische Rolle der Frau in den ausgewählten Liedern. Das fünfte Kapitel setzt die beiden Gattungen in den Kontext des Gesamtwerks von Hartmann von Aue und betrachtet ihre Bedeutung für das Frauenbild im Minnesang.
Schlüsselwörter
Frauenbild, höfische Dichtung, Minnesang, Minneklage, Frauenlied, Hartmann von Aue, „ich sprach ich wolte ir iemer leben“, „swes vröide hin ze den bluomen stat“, Minne, triuwe, Dienstbereitschaft, gesellschaftliche Normen, Literaturanalyse, Gattungstheorie.
- Quote paper
- Christina Zopp (Author), 2002, Die Rolle der Frau im Minnesang Hartmanns von Aue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43322