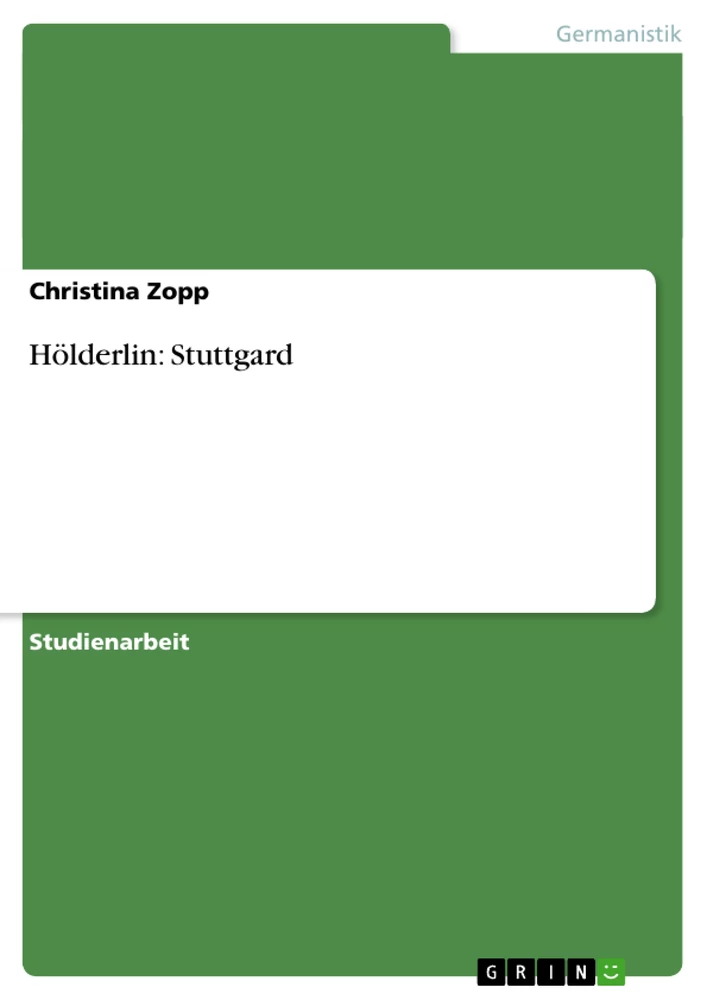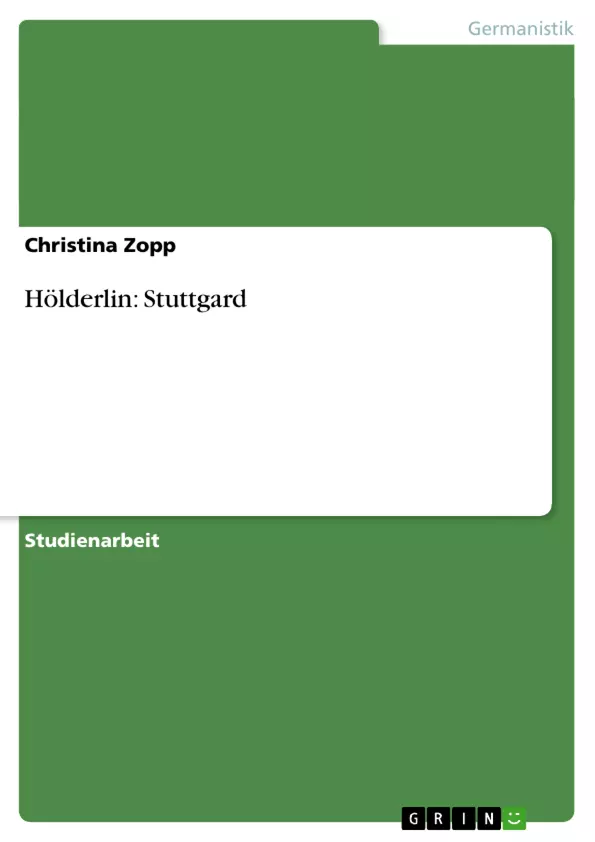Hölderlins Wirken und Arbeiten stehen im Zeichen einer kommunikativen Ebene, die es seinem Geist ermöglichen soll, sich im Dialog zu entfalten. Der Dialog, sei er in Briefform oder in Form der Widmung, gestaltet sich bei Hölderlin als fachlicher Diskurs, der Anschauungen seiner Vertrauten und Freunde miteinbezieht und somit eine Art intimes Symposium schafft.
Der Begriff des Symposiums bedeutet bei Hölderlin ein Zusammentreffen des jeweiligen Freundeskreises, der in Hölderlins jeweiliger Lebensetappe eine entscheidende Rolle für seine private, gesellschaftliche wie auch künstlerische Entwicklung spielt. Hölderlins Leben war bestimmt von diversen Freundschaftsbünden, die ihn in seiner Einsamkeit – der Isolation der Dichterexistenz – auffangen sollten. Unter anderem widmete er den Mitgliedern dieser Freundschaftsbünde einige seiner Gedichte, um ihnen seine tiefe Verbundenheit zu beweisen und gleichzeitig eine Diskussionsgrundlage für ein Thema zu liefern, womit er sich gerade beschäftigte.
Im vorliegenden Fall, der Elegie „Stuttgard“, richtet sich die Widmung an Siegfried Schmid, ein sehr enger Vertrauter Hölderlins. Siegfried Schmid war ein relativ wohlhabender Kaufmannssohn, der Theologie „ohne Neigung“ studierte und Schriftsteller-Ambitionen hegte. Doch seine Gedichte und Romane wurden kaum bis gar nicht beachtet und brachten ihm vernichtende Kritiken von Goethe und Schiller ein. In Hölderlins Widmungsdichtung bilden Titel und Widmung eine in sich geschlossene Einheit, die im Titel das Thema und in der Widmung die Kommunikations- und Freundschaftsebene impliziert. Besonders bei Hölderlin ist in diesem Zusammenhang klar zu erkennen, dass im Gedicht selbst Zwiesprache mit einem Du gehalten wird - eine „(...) feiernde, verehrende, dankende, bittende Anrufung eines Du (...)“. Die Freundschaftsebene, also die Anrufung und Einladung der Freunde, hat für Friedrich Hölderlin eine elementare Bedeutung: Freunde werden sowohl als fester Halt bei der Rückkehr zur Realität nach „(...) einer hingerissenen Schau des Höchsten (...)“ als auch in Momenten des gemeinsamen Glücks benötigt.
Inhaltsverzeichnis
- Hölderlins Werk unter dem Gesichtspunkt der Widmungsdichtung
- Interpretationsansatz zu Hölderlins „Stuttgard“
- Äußere Form
- Inhalt
- Inhaltliche Zusammenfassung der Elegie
- Darstellung der Einzelstrophen
- Motive
- Das Motiv der Religiosität
- Das Motiv der Freude
- Das Motiv des Herzens
- Das Motiv der Freundschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Friedrich Hölderlins Elegie „Stuttgard“ und untersucht deren Bedeutung im Kontext seiner Widmungsdichtung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der äußeren Form, des Inhalts und der zentralen Motive des Gedichts.
- Hölderlins Widmungsdichtung und deren kommunikative Funktion
- Die Bedeutung von Freundschaft und Gemeinschaft in Hölderlins Werk
- Die Rolle von Stuttgart und der schwäbischen Landschaft in der Elegie
- Das Motiv der Natur und die Darstellung des Herbstes
- Die Spannung zwischen Euphorie und Ernüchterung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt der Arbeit widmet sich Hölderlins Werk unter dem Gesichtspunkt der Widmungsdichtung. Er analysiert die Bedeutung von Freundschaft und Dialog in Hölderlins Leben und Werk, wobei der Fokus auf der Verbindung von literarischer Produktion und persönlicher Kommunikation liegt.
Der zweite Abschnitt befasst sich mit der Interpretation von Hölderlins „Stuttgard“. Zuerst wird die äußere Form des Gedichts anhand des Versmaßes und der Gattung der Elegie untersucht. Anschließend wird der Inhalt der Elegie in drei Sinnabschnitte unterteilt, wobei die Exposition, der Hauptteil und der Höhepunkt des Gedichts analysiert werden.
Schlüsselwörter
Widmungsdichtung, Friedrich Hölderlin, Elegie, „Stuttgard“, Freundschaft, Gemeinschaft, Natur, Herbst, Stuttgart, Schwaben, Euphorie, Ernüchterung, Religiosität, Freude, Herz, Einsamkeit
- Citation du texte
- Christina Zopp (Auteur), 2002, Hölderlin: Stuttgard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43326