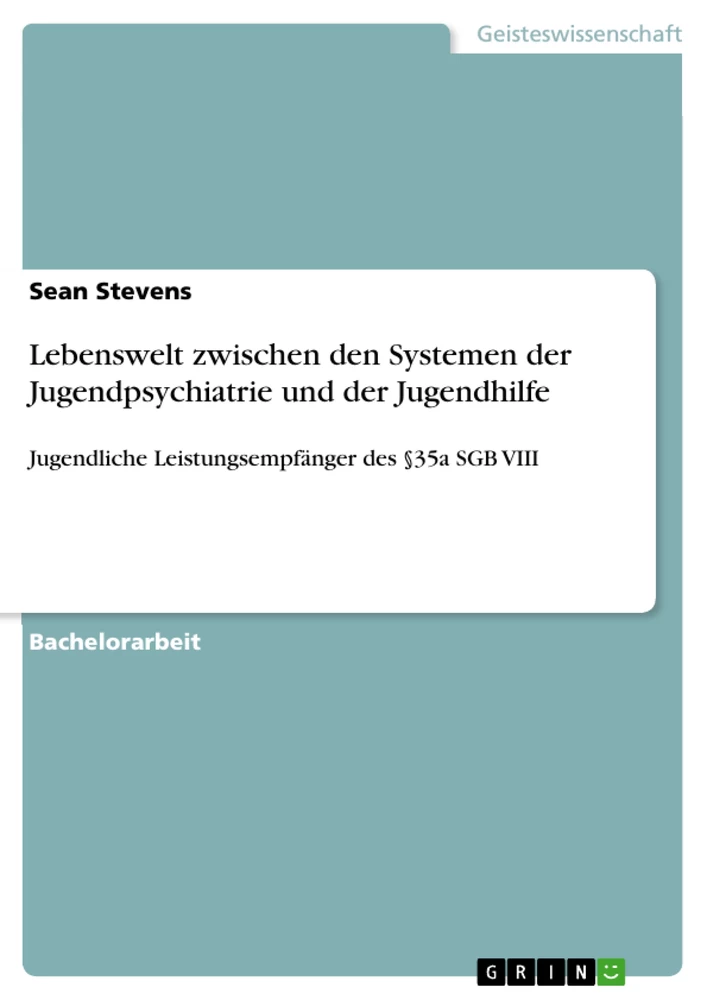Die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischer Beeinträchtigung, welche zurzeit in Einrichtungen der Stationären Jugendhilfe leben ist hoch. Für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung bilden diese Jugendlichen eine Hochrisikopopulation. Die Prävalenz von Psychischen Störungen in der stationären Jugendhilfe liegt bei 59,9%. Jugendliche mit zwei oder mehreren Störungen beträgt 37%. Diese Zahlen deuten auf eine sehr weite Verbreitung von komplexen, schwer zu behandelnden Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen, welche in der stationären Jugendhilfe leben.
Schwierige und belastende Lebenssituationen, wie z.B. zerrüttete Familienverhältnisse und massive Konflikte, schlechte Wohnverhältnisse, traumatische Erfahrungen wie Misshandlung und Vernachlässigung etc., sind deutliche Risikofaktoren zur Entwicklung einer psychischen Störung. Die meisten der Kinder, welche in Jugendhilfeeinrichtungen leben, waren schon mit einer oder mit mehreren dieser Risikofaktoren konfrontiert. Ein Großteil der Kinder, welche in Jugendhilfeeinrichtungen leben kommt aus zerrütteten Familienverhältnissen. Daher ist eine Kooperation zwischen der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie wichtig und wünschenswert. Diese Zusammenarbeit ist eigentlich im §35a SGB VIII geregelt, welcher allerdings keine konkreten Hilfeleistungen definiert. Es ist im Sinne dieses Paragraphen oft Auslegungssache, welches Hilfesystem für welches Problem zuständig ist. Gerade der Umgang mit Jugendlichen, welche nur schwer von den Hilfemaßnahmen der Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie erreicht und im Hilfesystem gehalten werden können, man spricht auch von „hard-to-reach-“ Klientengruppen, fällt angesichts der unkonkreten Formulierung des §35a sehr schwer.
Es gibt viele Ideen, welche die Kooperation konkretisieren wollen. Es gibt empirische Arbeiten, Bücher Modelle und Arbeitskreise. Dennoch ist es bei der Arbeit mit psychisch belasteten Jugendlichen wichtig, sowohl die Belastung, als auch den Jugendlichen in seiner Ganzheit zu sehen und zu verstehen. Möchte man die Modelle der Hilfesysteme optimieren, kommt man nicht daran vorbei, den Jugendlichen ein Mitspracherecht zu geben und ihre Einschätzung der Lage, als Resultat ihrer eigenen Biographie und Erfahrungen, anzuhören und ernst zu nehmen. Diese Thesis, soll die Perspektive von Jugendlichen erfassen, welche sowohl Lebenserfahrung im Bereich der stationären Jugendhilfe als auch der Jugendpsychiatrie gemacht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken
- Das Jugendalter
- Somatische Veränderungen im Zuge der Pubertät
- Körperlich sichtbare Veränderungen
- Hormonelle Veränderung
- Entwicklung des Gehirns
- Psychosoziale Entwicklungsprozesse, Chancen und Risiken im Jugendalter
- Entwicklungsphasen und -aufgaben
- Selbstkonzept und Identitätsentwicklung im Jugendalter
- Psychosexuelle Entwicklung
- Die Bedeutung von Familie und Peergroups im Jugendalter
- Kognitive Prozesse
- Soziale Lebenswelten Jugendlicher Ergebnisse der Sinusstudie
- Lebenswelttypologie der Sinus-Studie 2016
- Reflexion und Kritik am Modell der Lebenswelttypologie
- Somatische Veränderungen im Zuge der Pubertät
- Psychisch belastete Jugendliche, Erklärungsmuster und Umgang
- Störungsbilder im Jugendalter
- Psychoanalytische Perspektive
- Systemische Perspektive
- Perspektive und Umgang der Sozialen Arbeit mit belasteten Jugendlichen
- Rechtliche Grundlagen des §35a SGB VIII
- Situation in Deutschland
- Rechtlicher Umgang mit dem Begriff der Seelischen Behinderung
- Prüfung der Leistungsvorraussetzungen durch Jugendhilfe und -psychiatrie
- Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung
- Leistungsanspruch und Hilfeart
- Ambivalenzen des §35a SGB VIII
- Zuständigkeiten
- Einheitlichkeit und gemeinsames Vorgehen der Hilfesysteme
- Verhältnis von §35a zu § 27ff. SGB VIII
- Kritik am Begriff der Seelischen Behinderung
- Systeme der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Stationären Jugendhilfe
- System der Jugendhilfe im Allgemeinen
- Auftrag der Sozialen Arbeit in der Jugendhilfe
- Stationäre Jugendhilfe
- System der Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Kooperationsbedarf zwischen den Systemen
- System der Jugendhilfe im Allgemeinen
- Betrachtung der Situation aus der Perspektive der Lebensweltorientierung
- Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe
- Lebensweltorientierung und die Hilfeempfänger der §35a SGB VIII
- Kritik am lebensweltorientierten Ansatz
- Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe
- Empirische Studie: Was zeigt die Perspektive betroffener Jugendlicher im Bezug auf ihre Lebenswelt?
- Grundlagen der Studie
- Darstellung der Forschungsmotivation
- Bisheriger Forschungsstand
- Studiendesign
- Durchführung des Interviews
- Auswertung und Ergebnisdarstellung
- Darstellung der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse
- Darstellung der Kernaussagen
- Ergebnisinterpretation
- Grundlagen der Studie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit der Lebenswelt von Jugendlichen, die Leistungen nach §35a SGB VIII erhalten. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie aus der Perspektive der Jugendlichen.
- Das Jugendalter und seine besonderen Herausforderungen
- Psychische Belastung im Jugendalter und die Rolle der Jugendhilfe und der Jugendpsychiatrie
- Rechtliche Rahmenbedingungen des §35a SGB VIII und die Ambivalenzen seiner Anwendung
- Die Lebensweltorientierung als Ansatzpunkt für eine gelingende Zusammenarbeit
- Empirische Untersuchung der Lebenswelt von Jugendlichen im Kontext des §35a SGB VIII
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in das Thema und stellt die Relevanz der Arbeit dar.
- Das zweite Kapitel behandelt das Jugendalter und seine verschiedenen Entwicklungsphasen.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Besonderheiten von psychisch belasteten Jugendlichen sowie die unterschiedlichen Perspektiven der Psychoanalyse und der systemischen Therapie.
- Im vierten Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen des §35a SGB VIII erläutert, einschließlich seiner Ambivalenzen und der Kritikpunkte an seiner Anwendung.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Systemen der Jugendhilfe und der Jugendpsychiatrie, sowie deren notwendige Zusammenarbeit.
- Das sechste Kapitel beleuchtet die Lebensweltorientierung und ihre Bedeutung im Kontext der §35a SGB VIII Leistungen.
- Im siebten Kapitel wird eine empirische Studie vorgestellt, die die Perspektive betroffener Jugendlicher auf ihre Lebenswelt erforscht.
Schlüsselwörter
Jugendhilfe, Jugendpsychiatrie, §35a SGB VIII, Lebensweltorientierung, psychische Belastung, Empirische Studie, Jugendliche, Zusammenarbeit, Hilfesysteme, Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt der §35a SGB VIII?
Er regelt den Anspruch auf Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Warum ist die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie schwierig?
Unklare Zuständigkeiten und unterschiedliche Fachlogiken führen oft zu Reibungsverlusten bei der Behandlung psychisch belasteter Jugendlicher.
Was bedeutet Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe?
Dieser Ansatz stellt den Alltag und die individuelle Perspektive der Jugendlichen in den Mittelpunkt, anstatt nur das Störungsbild zu behandeln.
Wie hoch ist die Prävalenz psychischer Störungen in der Jugendhilfe?
Etwa 59,9 % der Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe weisen psychische Störungen auf.
Was sind „hard-to-reach“ Klientengruppen?
Es handelt sich um Jugendliche, die von klassischen Hilfesystemen kaum erreicht werden oder diese häufig abbrechen.
- Arbeit zitieren
- Sean Stevens (Autor:in), 2016, Lebenswelt zwischen den Systemen der Jugendpsychiatrie und der Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433518