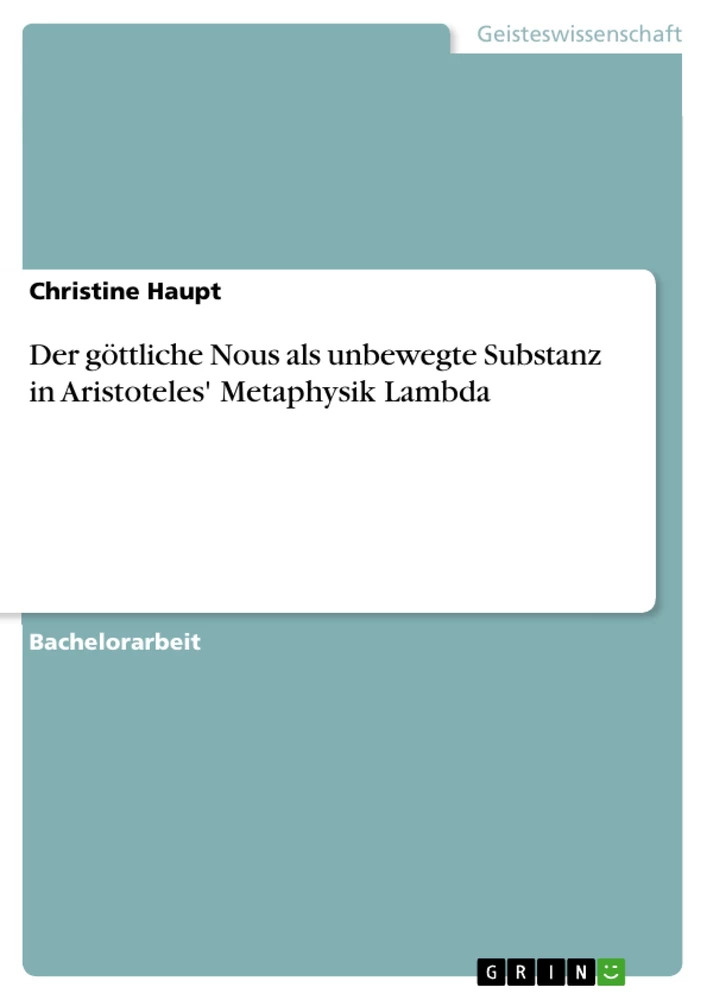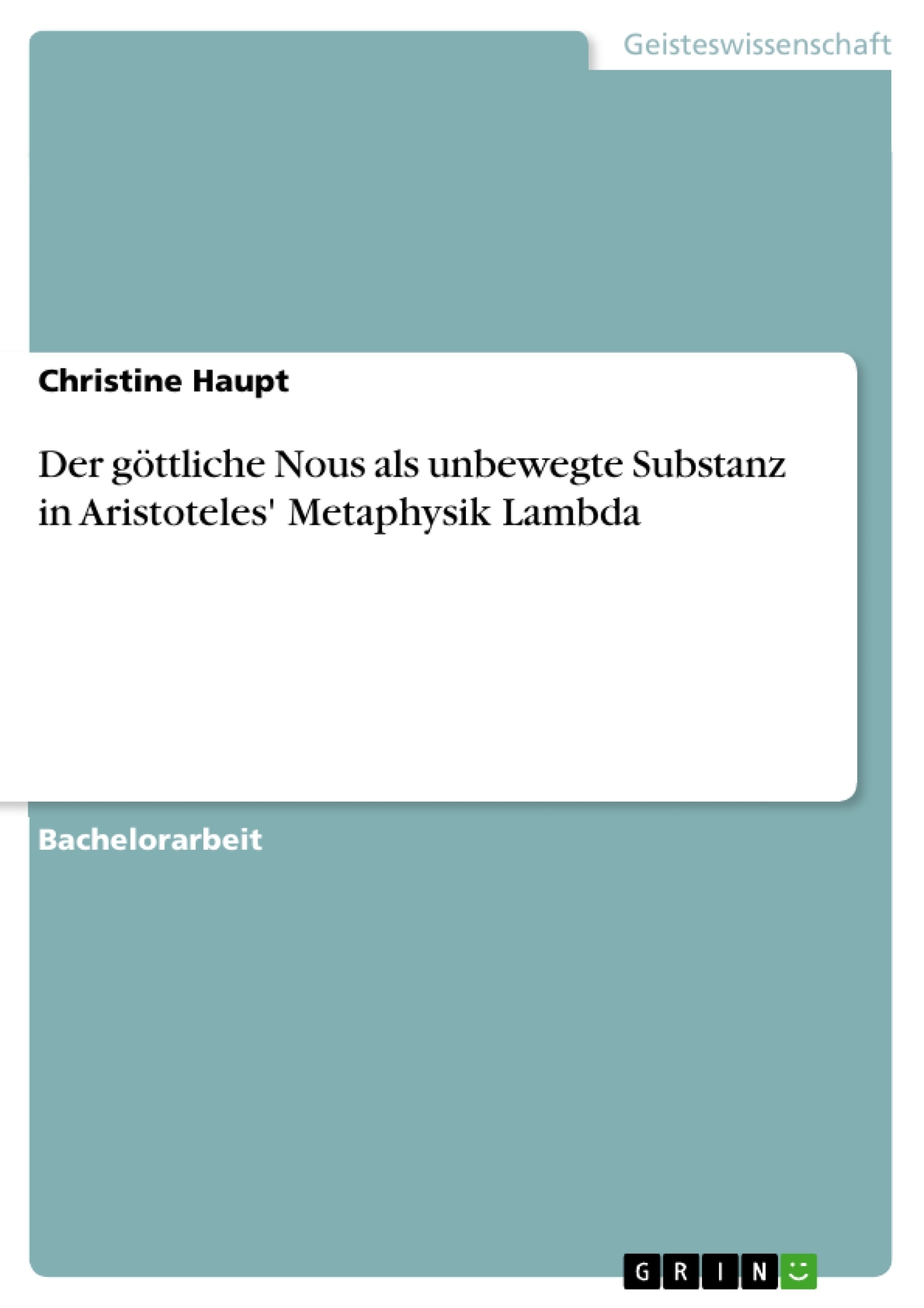Inwiefern sich die diversen Ansätze, die den göttlichen Nous betreffen, vereinen lassen oder ob letzten Endes nur die Flucht in die Aporie möglich ist, soll unter anderem in dieser Arbeit zu klären versucht werden. Zunächst erfolgt eine einleitende historische Hinführung, in welcher die Überlegungen zum "Nous" betrachtet werden. Auf Grundlage der Metaphysik und unter Heranziehung der Kategorienschrift werden die beiden Ontologie - Konzeptionen erarbeitet, um auf diese Weise Antworten auf die Frage nach dem göttlichen Nous und Hinweise auf dessen Notwendigkeit zu erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenstellung und methodisches Vorgehen
- Historische Hinführung mit Hilfe der Nous-Fragmente des Anaxagoras
- I. Was ist die Substanz?
- Metaphysik A als Grundlage der Untersuchung
- Der Begriff der Materie
- Notwendigkeit eines ersten unbewegten Bewegers
- II. Wesensbestimmungen des Göttlichen
- Wie bewegt das Göttliche alles Übrige?
- Pros-Hen-Relation
- Die teleologische Seinsordnung
- Tätigkeit des Göttlichen
- Vergleich zur Tätigkeit des menschlichen Nous
- Was ist der menschliche Nous?
- III. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem göttlichen Nous als unbewegter Substanz in Aristoteles' Metaphysik. Ziel ist es, die Rolle des Nous in Aristoteles' Kosmologie zu verstehen und seine Verbindung zur Substanzlehre zu analysieren. Dabei werden insbesondere die Metaphysik (Met. A) und die Kategorienschrift (Cat. 5) herangezogen, um die Ontologie-Konzeptionen Aristoteles' zu erarbeiten und die Notwendigkeit des Nous zu beleuchten.
- Der Begriff der Substanz in Aristoteles' Metaphysik
- Die Rolle des Nous als unbeweglicher Beweger
- Die Beziehung zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Nous
- Die ontologische Konzeption in Aristoteles' Kategorienschrift (Cat. 5)
- Vergleich von Anaxagoras' und Aristoteles' Nous-Konzeptionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Themenstellung und das methodische Vorgehen vor. Sie verdeutlicht die Bedeutung der Frage nach der Metaphysik und die Relevanz des Begriffs der Substanz für das Verständnis von Aristoteles' Kosmologie.
- Historische Hinführung: Dieses Kapitel analysiert die Nous-Fragmente des Vorsokratikers Anaxagoras, um den historischen Hintergrund der Nous-Konzeption zu beleuchten. Dabei wird die ontologische Ausgangsbasis von Anaxagoras untersucht, die den Nous von allen anderen Dingen unterscheidet.
- Was ist die Substanz?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Substanz in Aristoteles' Metaphysik. Es analysiert Metaphysik A als Grundlage der Untersuchung und beleuchtet den Begriff der Materie. Außerdem wird die Notwendigkeit eines ersten unbewegten Bewegers diskutiert.
- Wesensbestimmungen des Göttlichen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Wesensbestimmungen des Göttlichen. Es untersucht, wie das Göttliche alles Übrige bewegt und analysiert die Pros-Hen-Relation sowie die teleologische Seinsordnung. Außerdem wird die Tätigkeit des Göttlichen im Vergleich zur Tätigkeit des menschlichen Nous betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Substanz, Nous, Metaphysik, Ontologie, Aristoteles, Anaxagoras, Bewegung, Beweger, teleologische Seinsordnung, Pros-Hen-Relation, göttliche Tätigkeit, menschliche Seele, De anima, De generatione animalium.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Aristoteles unter dem „göttlichen Nous“?
Der göttliche Nous ist bei Aristoteles der „erste unbewegte Beweger“ – eine reine Substanz, die alles andere bewegt, ohne selbst bewegt zu werden.
Welche Rolle spielt die Metaphysik Lambda (Met. Λ)?
In diesem Buch seiner Metaphysik entwickelt Aristoteles seine Theologie und Kosmologie, in der er die Notwendigkeit einer ewigen, unbewegten Substanz begründet.
Was ist die Pros-Hen-Relation?
Es ist ein Prinzip der aristotelischen Ontologie, bei dem sich verschiedene Bedeutungen von „Seiendem“ auf einen einzigen zentralen Punkt (die Substanz) beziehen.
Wie unterscheidet sich der menschliche vom göttlichen Nous?
Während der menschliche Nous potenziell und diskursiv denkt, ist der göttliche Nous reine Aktualität und denkt sich selbst („Denken des Denkens“).
Was hat Anaxagoras mit Aristoteles' Nous-Lehre zu tun?
Aristoteles greift die Nous-Fragmente von Anaxagoras historisch auf, um seine eigene Theorie der ordnenden Vernunft im Kosmos abzugrenzen und weiterzuentwickeln.
Was bedeutet „teleologische Seinsordnung“?
Es beschreibt die Vorstellung, dass alles in der Natur auf ein Ziel (Telos) hin geordnet ist, wobei das Göttliche als höchstes Ziel die Welt durch „Eros“ (Streben) bewegt.
- Quote paper
- Christine Haupt (Author), 2015, Der göttliche Nous als unbewegte Substanz in Aristoteles' Metaphysik Lambda, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433550