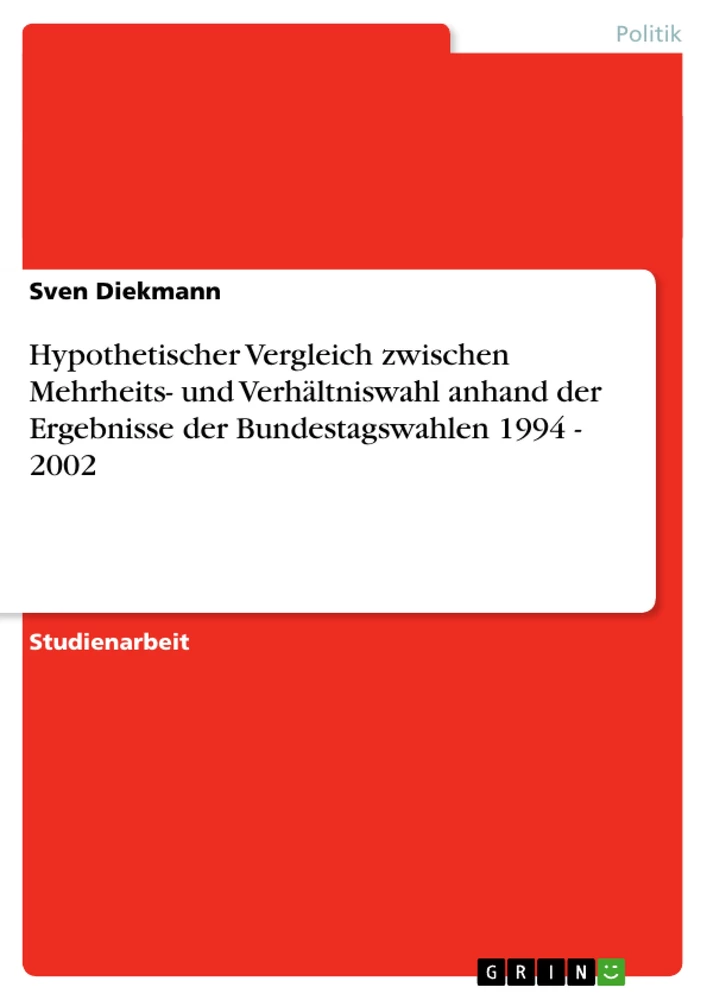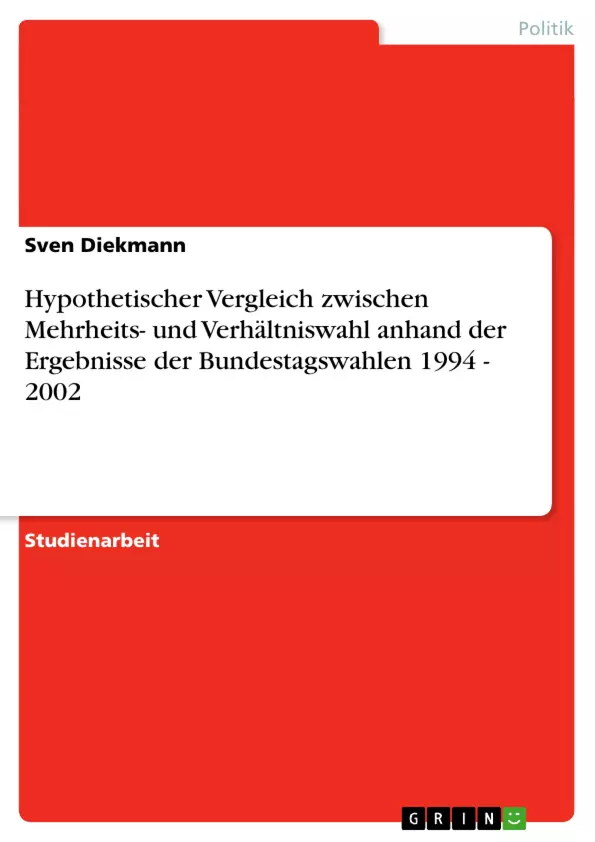Bei der Klassifizierung von Wahlsystemen wird zwischen zwei Grundtypen unterschieden: Mehrheitswahl und Verhältniswahl. Die Wahlen zum deutschen Bundestag werden nach der so genannten personalisierten Verhältniswahl durchgeführt. Dieses Wahlsystem ist eine Kombination aus dem Mehrheits- und dem Verhältniswahlrecht.
In dieser Arbeit soll anhand der Bundestagswahlen analysiert werden, welche mechanischen und psychologischen1 Auswirkungen die unterschiedlichen Wahlsysteme haben und welche Auswirkungen sie somit auf das Parteiensystem haben. Hierfür werden die Wahlergebnisse der Bundestagswahlen getrennt betrachtet, d.h. dass das personalisierte Verhältniswahlrecht in seine Mehrheits- und Verhältniswahlkomponenten aufgesplittet wird. Somit wird von hypothetischen Wahlergebnissen ausgegangen.
Der Vorteil dieser Untersuchung im Vergleich zu einem Zwei-Staaten-Vergleich ist, dass das Mehrheits- und das Verhältniswahlrecht in einem homogenen Umfeld mit gleichen Kontextvariablen verglichen werden können.
Betrachtet werden die Bundestagswahlen nach der Wiedervereinigung: 1994, 1998 und 2002. Nach dieser Einleitung folgen die Funktionsanforderungen und Effekte von Wahlsystemen. Diese Kriterien bilden das Gerüst zur Untersuchung der Wahlsysteme. Anschließend werden die Mehrheits- und Verhältniswahl, sowie die personalisierte Verhältniswahl, wie sie in Deutschland bei den Bundestagswahlen praktiziert wird, dargestellt. Bei der Untersuchung von Wahlsystemen sind Sperrklauseln und Wahlkreisgrößen ebenfalls von großer Relevanz. In der Analyse im dritten Abschnitt werden die letzten drei Bundestagswahlen auf folgende mechanische Effekte untersucht: Disproportionalität, effektive Parteienanzahl, Mehrheitsbildung. Bei dieser quantitativen Untersuchung werden die Berechnungsmethoden von Arend Lijphart (1994 und 1999) benutzt. In diesem Teil der Arbeit werden die beiden gegensätzlichen Wahlsysteme getrennt voneinander betrachtet, auch wenn sie es aus technischen und psychologischen Gründen in der Realität nicht sind. Daher werden im vierten Abschnitt diese mechanischen Auswirkungen des Wahlsystems durch die “psychologischen” Effekte des personalisierten Verhältniswahlrechtes auf die Stimmvergabe der Wähler ergänzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wahlsysteme
- Funktionsanforderungen an Wahlsysteme
- Mehrheitswahl vs. Verhältniswahl
- Personalisierte Verhältniswahl - Bundestagswahlen
- Sperrklausel
- Wahlkreisgröße/ Wahlkreiseinteilung
- Mechanische Effekte
- Disproportionalität
- Effektive Parteienanzahl
- Mehrheitsbildung
- Überhangmandate - Negatives Stimmgewicht
- Psychologische Effekte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die mechanischen und psychologischen Auswirkungen von Mehrheits- und Verhältniswahlsystemen auf das deutsche Parteiensystem anhand der Bundestagswahlen von 1994, 1998 und 2002. Die personalisierte Verhältniswahl wird dabei in ihre Komponenten aufgesplittet, um einen hypothetischen Vergleich zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich innerhalb eines homogenen Umfelds, um Kontextvariablen zu kontrollieren.
- Vergleich von Mehrheits- und Verhältniswahlsystemen
- Analyse mechanischer Effekte wie Disproportionalität und effektive Parteienanzahl
- Untersuchung der Auswirkungen auf die Mehrheitsbildung
- Berücksichtigung psychologischer Effekte auf die Wählerentscheidung
- Anwendung der Berechnungsmethoden von Arend Lijphart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wahlsysteme ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Es wird der Vergleich von Mehrheits- und Verhältniswahl anhand der deutschen Bundestagswahlen erläutert, wobei die personalisierte Verhältniswahl in ihre Komponenten zerlegt wird. Der Vorteil dieses Ansatzes gegenüber einem Zwei-Staaten-Vergleich wird hervorgehoben, da Kontextvariablen kontrolliert werden können. Die Arbeit betrachtet die Bundestagswahlen von 1994, 1998 und 2002 und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
Wahlsysteme: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Aspekte von Wahlsystemen. Es beginnt mit der Definition von Funktionsanforderungen an Wahlsysteme nach Nohlen, einschließlich Repräsentation, Konzentration, Partizipation, Einfachheit und Legitimation. Anschließend wird der Unterschied zwischen Mehrheits- und Verhältniswahl detailliert dargestellt, wobei die jeweiligen Repräsentationsprinzipien und Entscheidungsregeln beleuchtet werden. Der Abschnitt beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Systeme hinsichtlich der Mehrheitsbildung, der Repräsentation kleinerer Parteien und der Auswirkungen auf das Parteiensystem. Die Diskussion beinhaltet die Rolle von Sperrklauseln und Wahlkreisgrößen sowie die Kritik an der Trennung von Wahlsystem- und Parteiensystemanalyse nach Nohlen.
Schlüsselwörter
Mehrheitswahl, Verhältniswahl, Personalisierte Verhältniswahl, Bundestagswahlen, Parteiensystem, Disproportionalität, Effektive Parteienanzahl, Mehrheitsbildung, Mechanische Effekte, Psychologische Effekte, Sperrklausel, Wahlkreisgröße, Repräsentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Auswirkungen von Wahlsystemen auf das deutsche Parteiensystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die mechanischen und psychologischen Auswirkungen von Mehrheits- und Verhältniswahlsystemen auf das deutsche Parteiensystem. Der Fokus liegt auf den Bundestagswahlen von 1994, 1998 und 2002, wobei die personalisierte Verhältniswahl detailliert untersucht wird. Durch den Vergleich innerhalb eines homogenen Umfelds (Deutschland) sollen Kontextvariablen kontrolliert werden.
Welche Wahlsysteme werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Mehrheitswahl- und Verhältniswahlsysteme, mit besonderem Augenmerk auf die personalisierte Verhältniswahl des deutschen Bundestages. Die Funktionsanforderungen an Wahlsysteme nach Nohlen (Repräsentation, Konzentration, Partizipation, Einfachheit und Legitimation) werden ebenfalls diskutiert.
Welche Aspekte der Wahlsysteme werden untersucht?
Die Analyse umfasst mechanische Effekte wie Disproportionalität und die effektive Parteienanzahl sowie die Auswirkungen auf die Mehrheitsbildung. Psychologische Effekte auf die Wählerentscheidung werden ebenfalls berücksichtigt. Die Arbeit verwendet Berechnungsmethoden von Arend Lijphart.
Welche konkreten Themen werden in den Kapiteln behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Wahlsystemen (inkl. Funktionsanforderungen, Mehrheits- vs. Verhältniswahl, Sperrklauseln, Wahlkreisgrößen), mechanischen Effekten (Disproportionalität, effektive Parteienanzahl, Mehrheitsbildung, Überhangmandate), psychologischen Effekten und einem Fazit. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und den methodischen Ansatz.
Welche Daten werden verwendet?
Die Analyse basiert auf Daten der deutschen Bundestagswahlen von 1994, 1998 und 2002.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mehrheitswahl, Verhältniswahl, Personalisierte Verhältniswahl, Bundestagswahlen, Parteiensystem, Disproportionalität, Effektive Parteienanzahl, Mehrheitsbildung, Mechanische Effekte, Psychologische Effekte, Sperrklausel, Wahlkreisgröße, Repräsentation.
Was ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Der Ansatz besteht im Vergleich von Mehrheits- und Verhältniswahl innerhalb des gleichen politischen Systems (Deutschland), um Kontextvariablen zu kontrollieren und die Auswirkungen der Wahlsysteme präziser zu analysieren. Die personalisierte Verhältniswahl wird in ihre Komponenten zerlegt, um einen hypothetischen Vergleich zu ermöglichen.
Welche Vorteile bietet der gewählte Ansatz?
Im Gegensatz zu einem Vergleich zwischen verschiedenen Ländern, erlaubt der Fokus auf die Bundestagswahlen unter verschiedenen Wahlsystemen eine bessere Kontrolle von Kontextvariablen und ermöglicht eine präzisere Analyse der Auswirkungen des Wahlsystems auf das Parteiensystem.
- Quote paper
- Sven Diekmann (Author), 2004, Hypothetischer Vergleich zwischen Mehrheits- und Verhältniswahl anhand der Ergebnisse der Bundestagswahlen 1994 - 2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43380