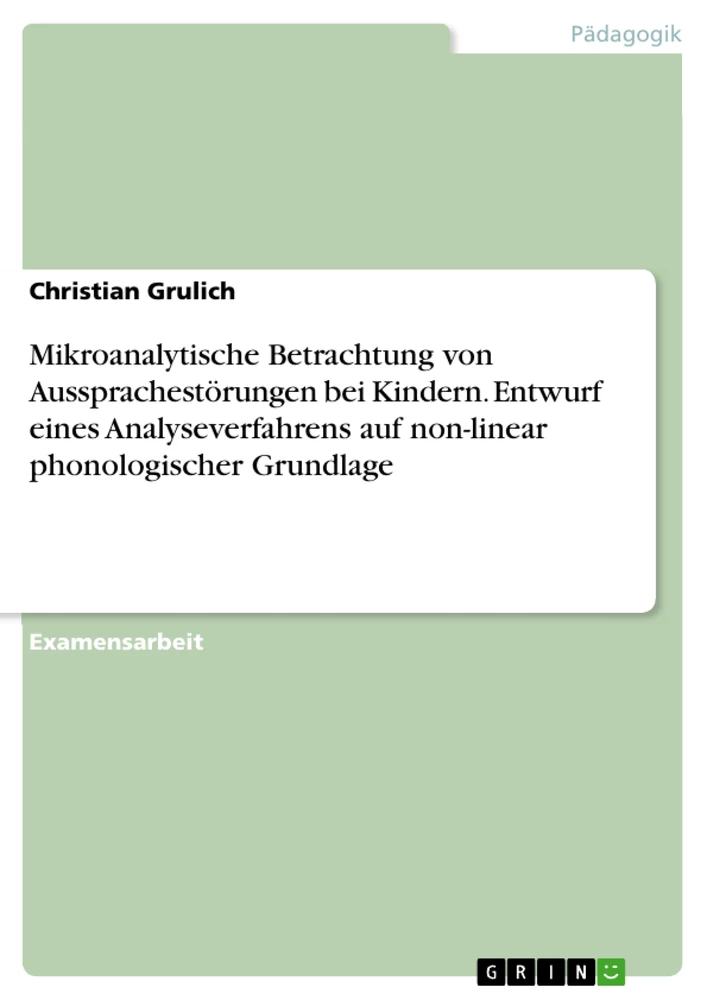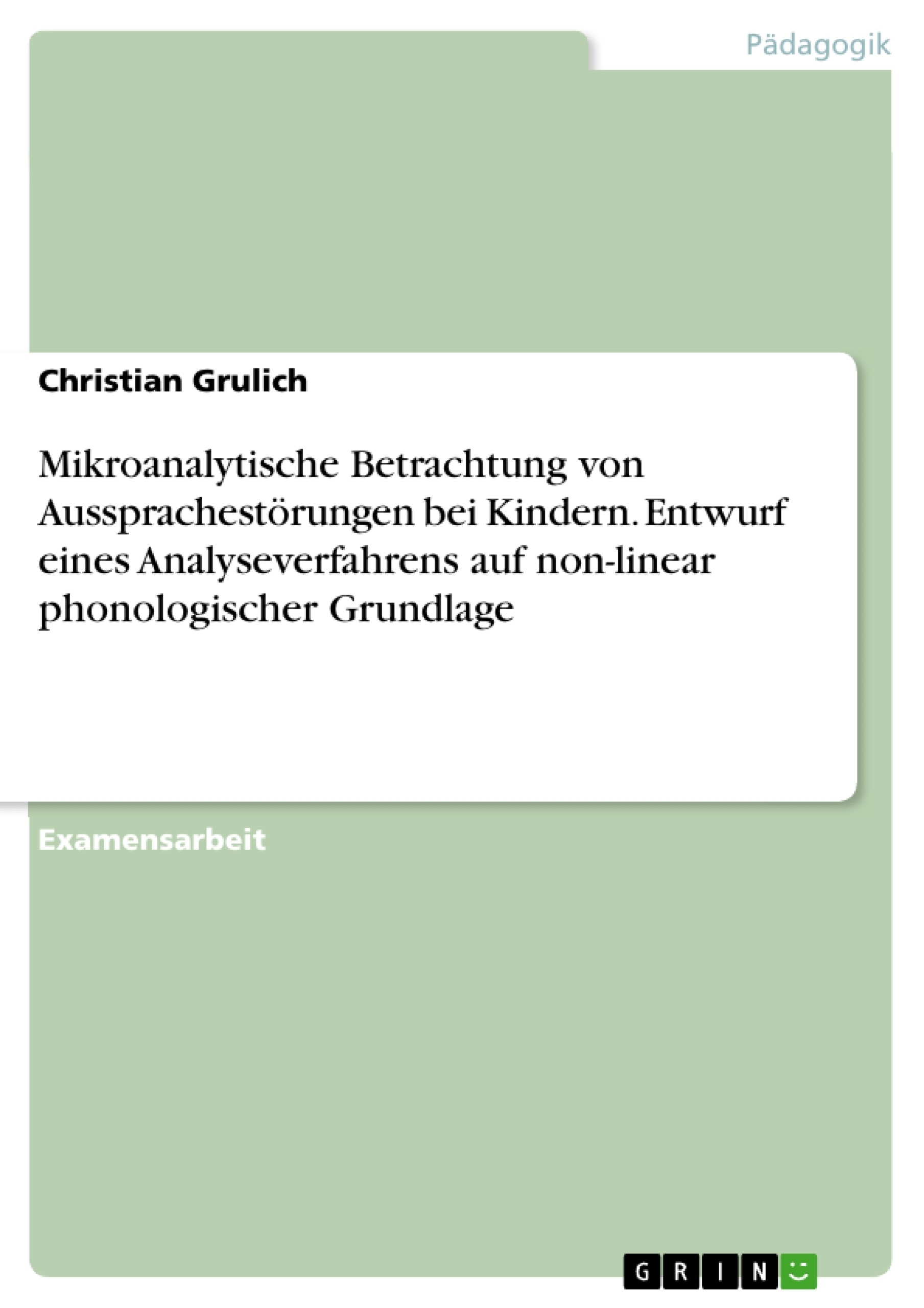Die wohl bekannteste Richtung in der Phonologie ist die so genannte „lineare Phonologie“. Dieses Theoriemodell sieht eine Äußerung als eine lineare Kette von Segmenten an. Vergleichbar ist diese Sichtweise mit der Betrachtung der geschriebenen Sprache, die sich ebenfalls durch eine Abfolge einzelner Elemente auszeichnet.
Die Entwicklung der Phonologie seit Mitte der 70er Jahren lässt sich als eine Abkehr von der Segmentorientierung bei einer gleichzeitigen Hinwendung zur Prosodik charakterisieren. Als prosodisch gilt dabei alles, was mehr als ein Segment betrifft (vgl. RAMERS ET AL, 1992, I). In diesem Rahmen hat sich die non-lineare Phonologie entwickelt. Motiviert ist diese Entwicklung durch den Anspruch, bestimmten sprachlichen Phänomenen besser gerecht werden zu können. Dies betrifft besonders diejenigen Phänomene, die sich auf Bereiche auswirken, die größer als ein Segment sind.
Diese Veränderung der Sichtweise in der Phonologie hat ebenso Auswirkungen auf die Forschung im Bereich des kindliche Spracherwerbs. So existieren mittlerweile Untersuchungen von kindlichen Sprachsystemen, die vor diesem Hintergrund entstanden sind. Diese vermögen es, Phänomene, die im Spracherwerb auftreten, detailliert zu beschreiben.
Anhand der dort entwickelten phonologischen Konstituenten und Erklärungsmodelle ist zudem eine Beschreibung gestörter Kindersprache denkbar. Betrachtet man jedoch gängige Analyseverfahren, so wird deutlich, dass diese sich nicht der Erkenntnisse der non-linearen Phonologie bedienen, sondern vielmehr auf der Grundlage der linearen Phonologie beruhen. Dies zeigt sich darin, dass das Vorgehen dieser Verfahren sich dadurch auszeichnet, dass die kindlichen Äußerungen Segment für Segment mit der Zielsprache verglichen werden. Die Abweichungen werden durch phonologische Prozesse wie beispielweise Plosivierung oder Frikativierung beschrieben. Diese besagen, das ein Segment in der linearen Kette durch einen Plosivlaut bzw. Frikativlaut ersetzt wird. Der Kontext dieses Segmentes (beispielsweise die Eigenschaften der benachbarten Laute) bleibt unberücksichtigt. Eine non-lineare Sichtweise hingegen berücksichtigt eben diesen Kontext.
Motiviert ist die vorliegende Arbeit durch eben diese fehlende Berücksichtigung der Erkenntnisse der non-linearen Phonologie in den gängigen Analyseverfahren. Auf dieser non-linear phonologischen Grundlage wird in dieser Arbeit der Entwurf eines Analyseverfahrens entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Phonologische Grundlagen
- 1.1 Distinktive Merkmale
- 1.1.1 Lineare Merkmalsrepräsentationen
- 1.1.2 Merkmalsgeometrie
- 1.2 Die Silbe
- 1.2.1 Sonorität
- 1.2.2 Das Konstituentenmodell der Silbe
- 1.2.2.1 Die extrareimische Position
- 1.2.2.2 Die extrasilbische Position
- 1.2.2.3 Ambisilbische Konsonanten
- 1.2.3 Moren - eine alternative Darstellung des Silbengewichts
- 1.3 Betonung
- 1.3.1 Der Fuß
- 1.3.2 Wortbetonungsregel des Deutschen
- 1.3.3 Komposita-Betonungsregel
- 1.3.4 Verschiedene Silbentypen
- 1.3.4.1 Die prominente Silbe
- 1.3.4.2 Die unmarkierte Silbe: nicht prominent und nicht reduziert
- 1.3.4.3 Die Reduktionssilbe
- 1.4 Prosodische Hierarchie
- 2 Aspekte der phonologischen Entwicklung
- 2.1 Distinktive Merkmale
- 2.1.1 Bestimmung von distinktiven Merkmalen
- 2.1.2 Entwicklung von distinktiven Merkmalen
- 2.1.3 Domäne der Merkmalszuweisungen
- 2.1.4 Zusammenfassung
- 2.2 Die Silbe
- 2.2.1 Der Onset
- 2.2.1.1 Einfache Onsets
- 2.2.1.2 Komplexe Onsets
- 2.2.2 Der Reim
- 2.2.3 Onset und Reim im Vergleich
- 2.3 Betonung
- 2.4 Prosodische Hierarchie
- 3 Entwurf eines Analyseverfahrens
- 3.1 Analysekriterien
- 3.1.1 Distinktive Merkmale
- 3.1.2 Silbenstrukturen
- 3.1.3 Betonung
- 3.1.4 Prosodische Hierarchie
- 3.2 Das Wortmaterial
- 3.2.1 Gruppe 1: Einsilber
- 3.2.2 Gruppe 2: Zweisilber
- 3.2.3 Gruppe 3: Dreisilber
- 3.2.4 Gruppe 4: Komposita
- 3.3 Analyse von Einsilbern – Ein Beispiel
- 3.3.1 Vergleich der Silbenstrukturen
- 3.3.2 Vergleich der Sonoritätswerte
- 3.3.3 Vergleich der segmentalen Strukturen
- 3.3.4 Phoninventar
- 3.3.5 Phonologische Kontraste
- 3.3.6 Vergleich der Merkmalszuweisungen
- 3.3.7 Vergleich der Betonungsstrukturen
- 3.4 Zusammenfassung
- 4 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein Analyseverfahren für Aussprachestörungen bei Kindern zu entwickeln, das auf der Grundlage der non-linearen Phonologie basiert. Das Verfahren soll dazu beitragen, die in der kindlichen Sprachentwicklung auftretenden Phänomene genauer zu beschreiben und zu verstehen.
- Die non-lineare Phonologie als Grundlage für die Analyse von Aussprachestörungen
- Relevante phonologische Einheiten (Distinktive Merkmale, Silben, Betonung, Prosodische Hierarchie)
- Entwicklungsphasen und Besonderheiten der phonologischen Entwicklung bei Kindern
- Entwicklung eines Analyseverfahrens, das diese Aspekte berücksichtigt
- Einbettung des Analyseverfahrens in den Rahmen der Kooperativen Sprachtherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 legt die phonologischen Grundlagen für die Analyse von Aussprachestörungen dar. Es behandelt wichtige Konzepte wie Distinktive Merkmale, Silbenstrukturen, Betonung und prosodische Hierarchie. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Aspekte der phonologischen Entwicklung bei Kindern, insbesondere die Entwicklung von distinktiven Merkmalen, die Bildung von Silben und die Rolle von Betonung und prosodischer Hierarchie im Spracherwerb. Kapitel 3 entwirft ein Analyseverfahren, das auf den Erkenntnissen aus den vorherigen Kapiteln basiert. Das Verfahren wird anhand eines Beispiels für die Analyse von Einsilbern demonstriert.
Schlüsselwörter
Non-lineare Phonologie, Aussprachestörungen, Kindersprache, Spracherwerb, Analyseverfahren, Distinktive Merkmale, Silbenstruktur, Betonung, Prosodische Hierarchie, Kooperative Sprachtherapie.
- Quote paper
- Christian Grulich (Author), 2003, Mikroanalytische Betrachtung von Aussprachestörungen bei Kindern. Entwurf eines Analyseverfahrens auf non-linear phonologischer Grundlage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43388